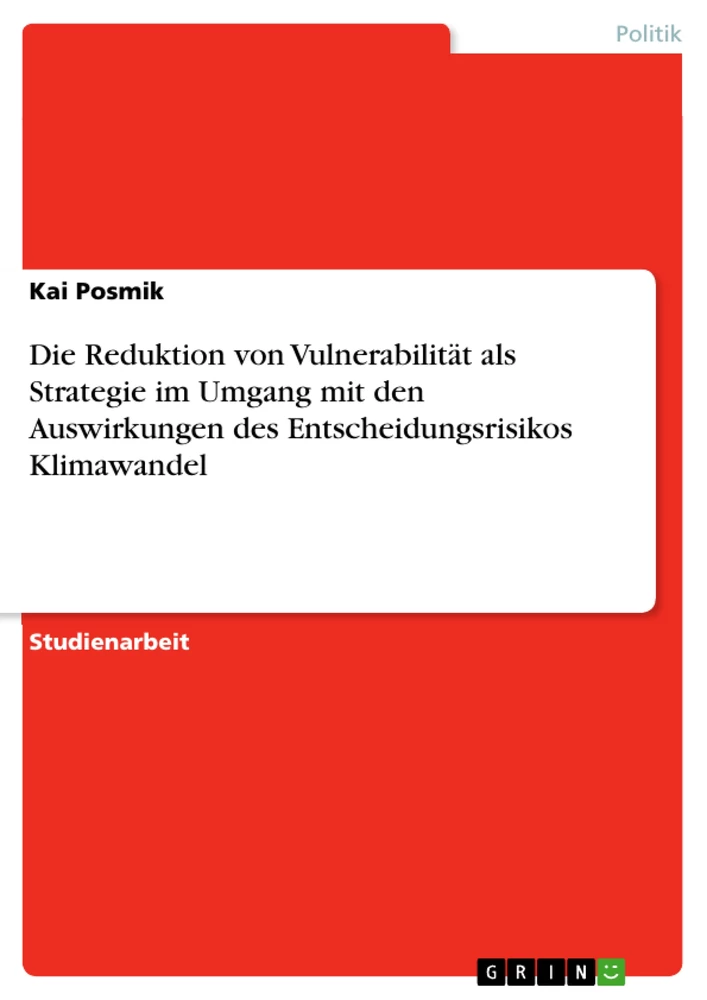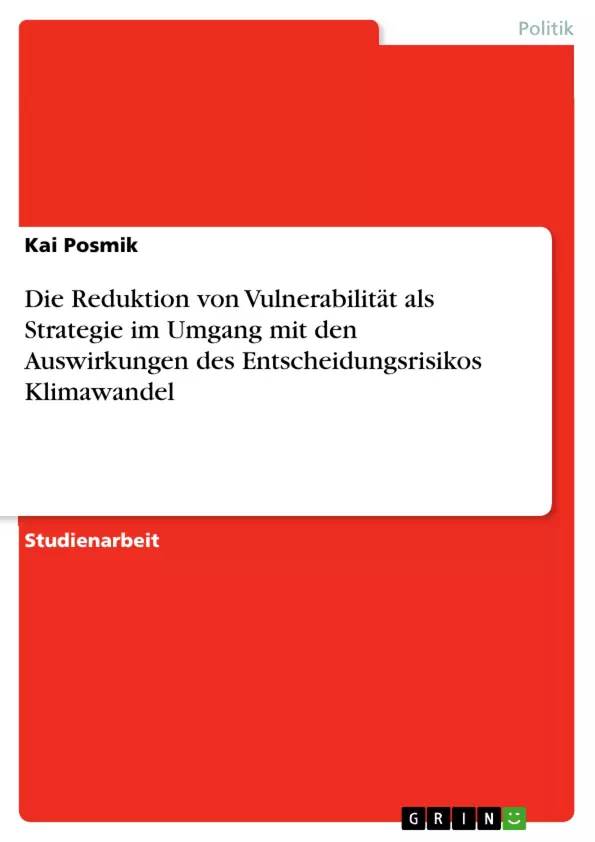Bereits in der Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, als die wachsenden ökologischen Probleme offenkundig und auch öffentlich diskutiert, aber von der erst später einsetzenden und insbesondere durch die Massenmedien forcierten Globalperzeption noch weit entfernt waren, warf Niklas Luhmann die Frage auf, ob die moderne Gesellschaft in der Lage sei, sich auf die ökologische Gefährdung einzustellen. Nur zwei Jahrzehnte danach wird offenbar, dass die Gesellschaft in zunehmendem Maße durch die „Effekte rückbetroffen [ist], die sie in ihrer Umwelt selbst ausgelöst hat.“ Mit anderen Worten: „Es ist das Eingriffs- und Transformationspotential des Menschen ihm selbst zum Hindernis, zum Problem geworden.“ Demnach darf die Frage nicht mehr lauten, ob die Gesellschaft sich auf ökologische Probleme einstellen kann (sie muss es einfach), sondern schlichtweg wie sie es tut.
Der Frage nachzugehen, wie die Gesellschaft als soziales System auf eine, die Systemstabilität bedrohende, ökologische Krise reagieren kann, soll Gegenstand dieser Arbeit sein. In diesem Kontext wird sich die Untersuchung auf das augenscheinlich öffentlichkeitswirksamste aller ökologischen Probleme fokussieren, den vornehmlich durch die Dominanz der fossilen Energieerzeugung verursachten und damit zum großen Teil anthropogenen Klimawandel, der unseren Planeten erfasst hat. Dass der Klimawandel inzwischen als scheinbar objektive Tatsache den ökologischen Diskurs beherrscht, ist offensichtlich, wenngleich es sich immer noch um ein mit Unsicherheit behaftetes Phänomen handelt, das sich, trotz enormer Fortschritte insbesondere der Naturwissenschaften, wegen seines hohen Grades an Komplexität niemals bis ins letzte Detail wird fassen lassen.
Eben diese Fortschritte in den Naturwissenschaften generierten jedoch einen entscheidenden Nachteil in der Problemperzeption und Lösungssuche. Ihre jahrelange Dominanz reduzierte den Klimawandel zuvorderst auf ein vorrangig technologisch zu behandelndes und lösendes Problem, wodurch die viel tiefer liegenden Ursachen und Wirkungen dieser Krise aus dem Blick gerieten. Der Klimawandel darf jedoch keinesfalls nur als eine (exogene) Störung der Natur begriffen und behandelt werden, denn gestört ist nicht die Natur als solche, sondern unser gesellschaftliches Verhältnis zu ihr. Letztendlich ist ‚Natur’ eine menschliche Konstruktion und selbst die scheinbar so objektivistischen Naturwissenschaften sind nur unsere Art über ‚Natur’ zu kommunizieren.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Entscheiden unter Unsicherheit und Risiko
- B. I. Klimawandel als Entscheidungsrisiko
- B. II. Objektivierender versus reflexiver Zugriff
- C. Vulnerabilität und Klimawandel
- C. I. Vulnerabilität als dynamische Systemeigenschaft
- C. II. Vulnerabilität sozialer Systeme in Bezug auf Klimawandel
- D. Anpassung als Strategie der Reduktion von Vulnerabilität
- E. Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Reduktion von Vulnerabilität als Strategie im Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels. Sie argumentiert, dass die Reduktion von Vulnerabilität, also der Verletzlichkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels, eine vielversprechende Strategie darstellt, insbesondere angesichts der Schwierigkeiten und Unsicherheiten in Bezug auf die Reduktion von Treibhausgasen.
- Entscheidungsrisiko im Kontext des Klimawandels
- Vulnerabilität als dynamische Systemeigenschaft
- Anpassungsstrategien zur Reduktion von Vulnerabilität
- Das Verhältnis von Natur- und Sozialwissenschaften im Umgang mit dem Klimawandel
- Die Rolle des politischen Entscheidungsfindungsprozesses
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit dar: Wie kann die Gesellschaft auf die ökologische Krise des Klimawandels reagieren? Sie beleuchtet die Dominanz der Naturwissenschaften in der bisherigen Problembearbeitung und plädiert für eine stärkere Berücksichtigung sozialwissenschaftlicher Perspektiven.
Kapitel B beschäftigt sich mit dem Entscheiden unter Unsicherheit und Risiko im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Es werden Konzepte und Definitionen des Risikos im Kontext des Klimawandels beleuchtet und die Problematik des Verhältnisses von Natur- und Sozialwissenschaften in der Problemlösung untersucht.
Kapitel C definiert Vulnerabilität als dynamische Systemeigenschaft und untersucht die Vulnerabilität sozialer Systeme in Bezug auf den Klimawandel. Es wird das Differenzierungs-Paradigma von Niklas Luhmann vorgestellt, um Vulnerabilität und ihre Ursachen besser zu verstehen und entsprechende Gegenmaßnahmen zu entwickeln.
Kapitel D skizziert mögliche Maßnahmen zur Reduktion von Vulnerabilität und stellt die Reduktion von Vulnerabilität als gleichwertige Strategie zur Mitigation dar. Die Arbeit betont die Notwendigkeit, den Klimawandel als ein komplexes Problem zu begreifen, das sowohl natur- als auch sozialwissenschaftliche Perspektiven erfordert.
Schlüsselwörter
Klimawandel, Entscheidungsrisiko, Vulnerabilität, Anpassung, Mitigation, Soziales System, Natur- und Sozialwissenschaften, Politischer Entscheidungsfindungsprozess.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Vulnerabilität“ im Kontext des Klimawandels?
Vulnerabilität beschreibt die Verletzlichkeit sozialer Systeme gegenüber den negativen Auswirkungen klimatischer Veränderungen und deren Fähigkeit, darauf zu reagieren.
Warum reicht ein rein technologischer Ansatz beim Klimawandel nicht aus?
Da der Klimawandel auch eine Krise des gesellschaftlichen Verhältnisses zur Natur ist, müssen soziologische und politische Faktoren ebenso berücksichtigt werden wie technische Lösungen.
Was ist der Unterschied zwischen Mitigation und Anpassung?
Mitigation zielt auf die Vermeidung von Treibhausgasen ab, während Anpassung (Adaptation) Strategien zur Reduktion der Vulnerabilität gegenüber bereits eintretenden Klimafolgen umfasst.
Wie sieht Niklas Luhmann die Reaktion der Gesellschaft auf ökologische Krisen?
Luhmann hinterfragt, ob die moderne Gesellschaft als soziales System strukturell in der Lage ist, die von ihr selbst ausgelösten ökologischen Gefährdungen rechtzeitig zu verarbeiten.
Welche Rolle spielt politische Unsicherheit beim Klimaschutz?
Entscheidungen müssen unter hoher Komplexität und wissenschaftlicher Unsicherheit getroffen werden, was die strategische Reduktion von Vulnerabilität zu einer notwendigen Sicherheitsmaßnahme macht.
- Citation du texte
- Kai Posmik (Auteur), 2006, Die Reduktion von Vulnerabilität als Strategie im Umgang mit den Auswirkungen des Entscheidungsrisikos Klimawandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84439