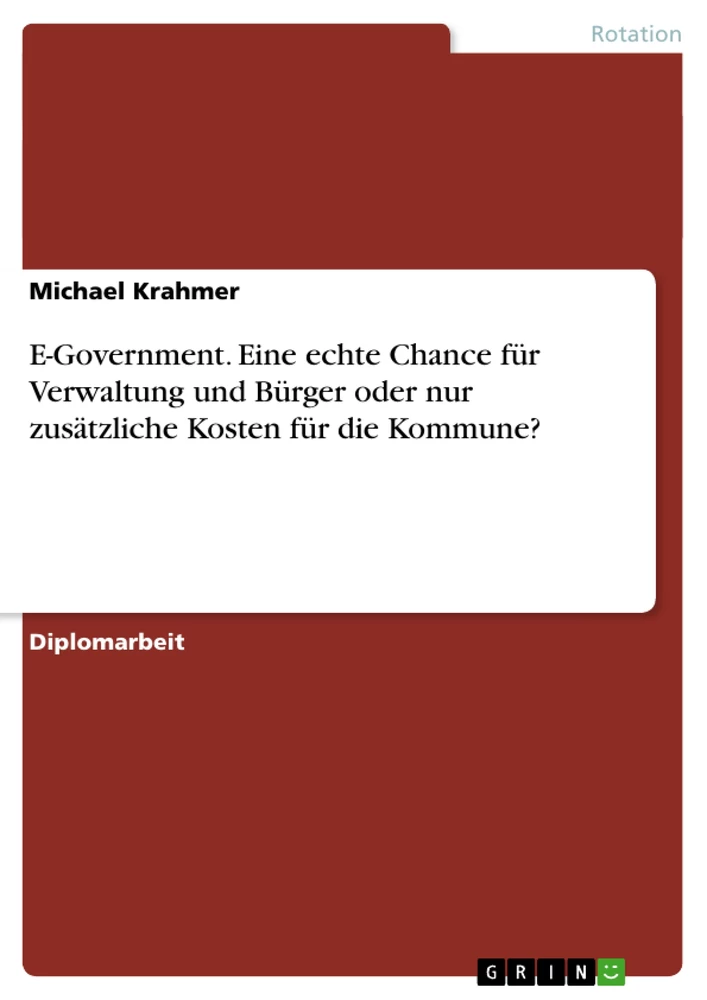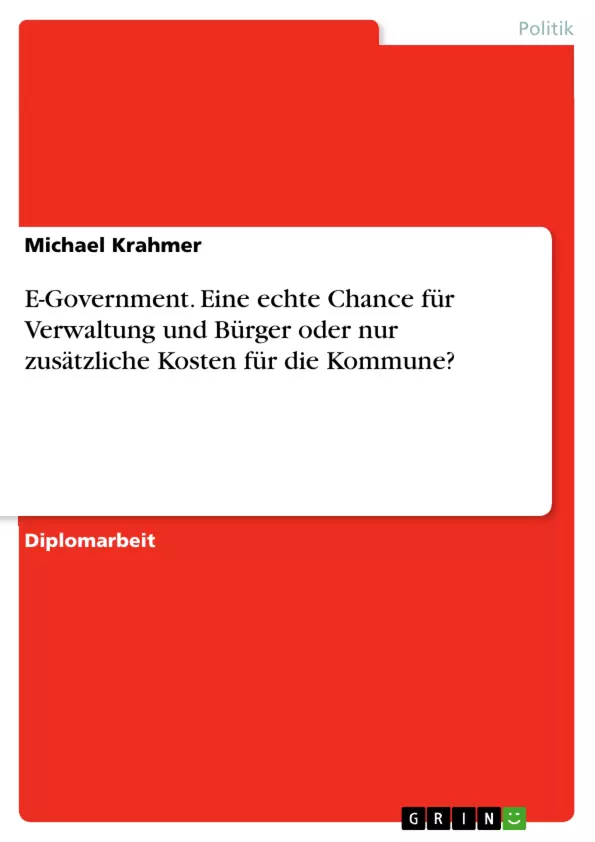Momentan befinden sich die Verwaltungen in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess.
Hierbei wird nicht nur versucht, die klassischen Elemente des Neuen Steuerungsmodells (NSM), wie beispielsweise die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), in den Kommunen einzusetzen, sondern durch Einsatz neuer Informationstechnologien (IT) soll die Effektivität und Transparenz der staatlichen Leistungserstellung deutlich verbessert werden.
Besonders die Kommunikation der Kommunen mit Bürgern, der Wirtschaft und anderen Behörden stehen im Vordergrund der Einführung des E-Government.
Auf europäischer Ebene erklärte ein Gremium der Europäischen Kommission auf der „Conference on eGovernment“ , die Entwicklung von E-Government auf hoher politischer Ebene voranzutreiben.
Die deutschen Bundesbehörden sind ebenfalls auf dem Weg, durch mehr und gezielteren Technikeinsatz, Reformbemühungen zu unterstützen.
Auf einem Kongress der Initiative BundOnline 2005 am 14. Mai 2001 kündigte Kanzler Schröder an, dass beispielsweise die Bundesverwaltung sich im Rahmen eines 10-Punkte-Programms verpflichtet hat, bis zum Jahr 2005 alle ihre Dienstleistungen auch online anzubieten .
Selbstverständlich müssen ebenfalls die Stadtverwaltungen, wenn auch aufgrund von Finanzengpässen zu einem späteren Zeitpunkt, das gleiche Ziel verfolgen und die entsprechende Infrastruktur verwaltungsintern schaffen.
Aufgrund der Komplexität des Themenbereiches kann dieses Buch als Ergebnis keinen Leitfaden mit umfassenden Kostenanalysen für die Einführung des E-Government in der Verwaltung darstellen.
Hier sollen Voraussetzungen und Vorteile für eine sinnvolle Einführung des E-Government aufgezeigt werden.
Gleichfalls soll die Chance der Behörden, durch den Einsatz der neuen Informations- und Kommunikationstechniken den notwendigen Reformprozess zu fördern, dargestellt werden.
Nach der Hinführung zum Thema E-Government wird im zweiten Kapitel anhand von zwei KMPG-Studien der bundesweite Stand und nachfolgend die bisherigen Aktivitäten der Stadt Pulheim, der Stadt Hagen und des Pilotprojektes vom NwStGB aufgezeigt.
Das dritte Kapitel beschreibt zu den drei Hauptbeziehungsgeflechten die Anwendungsmöglichkeiten und die damit verbundenen Zielvorstellungen.
Im vierten Kapitel werden die soft- und hardwaremäßigen sowie die sonstigen Voraussetzungen dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- INHALTSVERZEICHNIS
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- TABELLENVERZEICHNIS
- LINKVERZEICHNIS
- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- HINFÜHRUNG ZUM THEMA E-GOVERNMENT
- Begriffsdefinition
- Historische Entwicklung des E-Government
- BISHERIGE AKTIVITÄTEN IM BEREICH E-GOVERNMENT
- Aktueller Stand deutscher Behörden anhand von zwei KPMG-Studien
- Aktivitäten bei der Stadt Pulheim
- Aktivitäten bei der Vorzeigestadt Hagen: „Virtuelles Rathaus“
- Pilotprojekt des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes (NwStGB)
- ANWENDUNGSBEREICHE, ZIELE UND NUTZEN DES E-GOVERNMENT
- Anwendungsbereiche, Ziele und Nutzen des E-Government innerhalb der Kommune inklusive der politischen Gremien
- Anwendungsbereiche
- Internetbasierte Informationssysteme und sonstige Anwendungen
- Intranet der Verwaltung
- Ziele und Nutzen
- Zeitvorteil
- Organisatorische Verbesserung
- Kosteneinsparung
- Kommunikation
- Information
- Anwendungsbereiche
- Anwendungsbereiche, Ziele und Nutzen des E-Government zwischen Kommune, Bürger und Wirtschaft
- Internetbasierte Systeme
- Ziele und Nutzen
- Erreichbarkeit
- Transparenz
- Gebührenreduzierung für den Bürger und andere externe Benutzergruppen
- Zeitvorteil
- Kommunikation
- Information
- Transaktion
- Kosteneinsparung
- Anwendungsbereiche, Ziele und Nutzen des E-Government zwischen den Kommunen und den übergeordneten Behörden
- Anwendungsbereiche
- Internetportale der Kommunen
- Anwendungsbereiche
- Anwendungsbereiche, Ziele und Nutzen des E-Government innerhalb der Kommune inklusive der politischen Gremien
- Einführung des E-Government in der Verwaltung
- Voraussetzungen und Vorteile des E-Government
- Reformprozess durch Einsatz von Informations- und Kommunikationstechniken
- Verbesserung der Effektivität und Transparenz der staatlichen Leistungserstellung
- Kommunikation mit Bürgern, Wirtschaft und anderen Behörden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Thematik des E-Government und untersucht die Voraussetzungen und Vorteile für eine sinnvolle Einführung in der Verwaltung. Die Arbeit beleuchtet die Möglichkeiten, den notwendigen Reformprozess durch den Einsatz von neuen Informations- und Kommunikationstechniken zu fördern. Im Fokus steht insbesondere die Verbesserung der Effektivität und Transparenz der staatlichen Leistungserstellung, insbesondere in der Kommunikation mit Bürgern, Wirtschaft und anderen Behörden.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition des Begriffs E-Government und einer Darstellung der historischen Entwicklung. Anschließend werden der aktuelle Stand deutscher Behörden anhand von zwei KPMG-Studien sowie die bisherigen Aktivitäten der Stadt Pulheim, der Stadt Hagen und des Pilotprojektes vom NwStGB vorgestellt. Das dritte Kapitel widmet sich den Anwendungsbereichen, Zielen und dem Nutzen des E-Government in unterschiedlichen Beziehungsebenen: innerhalb der Kommune, zwischen Kommune, Bürger und Wirtschaft sowie zwischen Kommunen und übergeordneten Behörden. Abschließend werden die soft- und hardwaremäßigen sowie sonstige Voraussetzungen für die Einführung des E-Government dargestellt.
Schlüsselwörter
E-Government, Verwaltung, Bürger, Wirtschaft, Behörden, Informationstechnologie, Kommunikation, Effektivität, Transparenz, Reformprozess, KPMG-Studien, Stadt Pulheim, Stadt Hagen, NwStGB, Anwendungsbereiche, Ziele, Nutzen, Voraussetzungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel von E-Government in Kommunen?
Ziel ist die Verbesserung der Effektivität und Transparenz der Verwaltung sowie eine optimierte Kommunikation mit Bürgern und der Wirtschaft durch moderne Informationstechnologien.
Welche Vorteile bietet E-Government für den Bürger?
Bürger profitieren von besserer Erreichbarkeit der Behörden, Zeitvorteilen durch Online-Dienste, Transparenz der Prozesse und potenziell reduzierten Gebühren.
Ist E-Government nur mit zusätzlichen Kosten verbunden?
Obwohl Initialkosten entstehen, zielt E-Government langfristig auf Kosteneinsparungen durch organisatorische Verbesserungen und effizientere interne Prozesse ab.
Welche Voraussetzungen müssen für die Einführung erfüllt sein?
Es bedarf sowohl technischer Infrastruktur (Hard- und Software) als auch organisatorischer Anpassungen und der Bereitschaft zum Reformprozess innerhalb der Verwaltung.
Welche Vorbilder für E-Government werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit nennt unter anderem die Stadt Hagen mit ihrem „Virtuellen Rathaus“ und Pilotprojekte des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes als Beispiele.
- Quote paper
- Michael Krahmer (Author), 2002, E-Government. Eine echte Chance für Verwaltung und Bürger oder nur zusätzliche Kosten für die Kommune?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8464