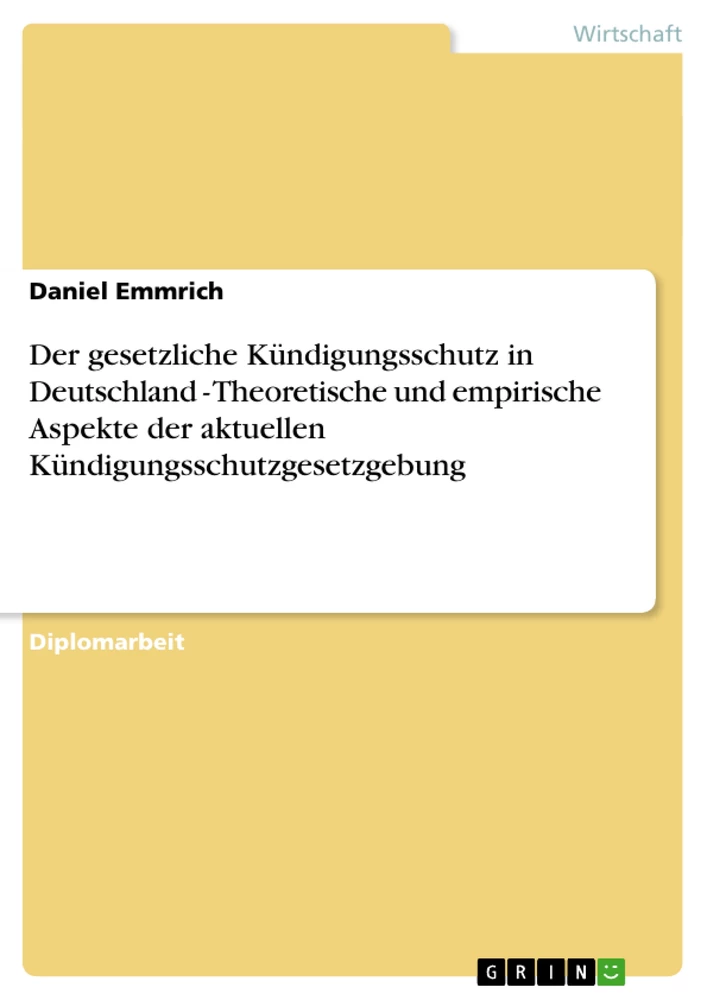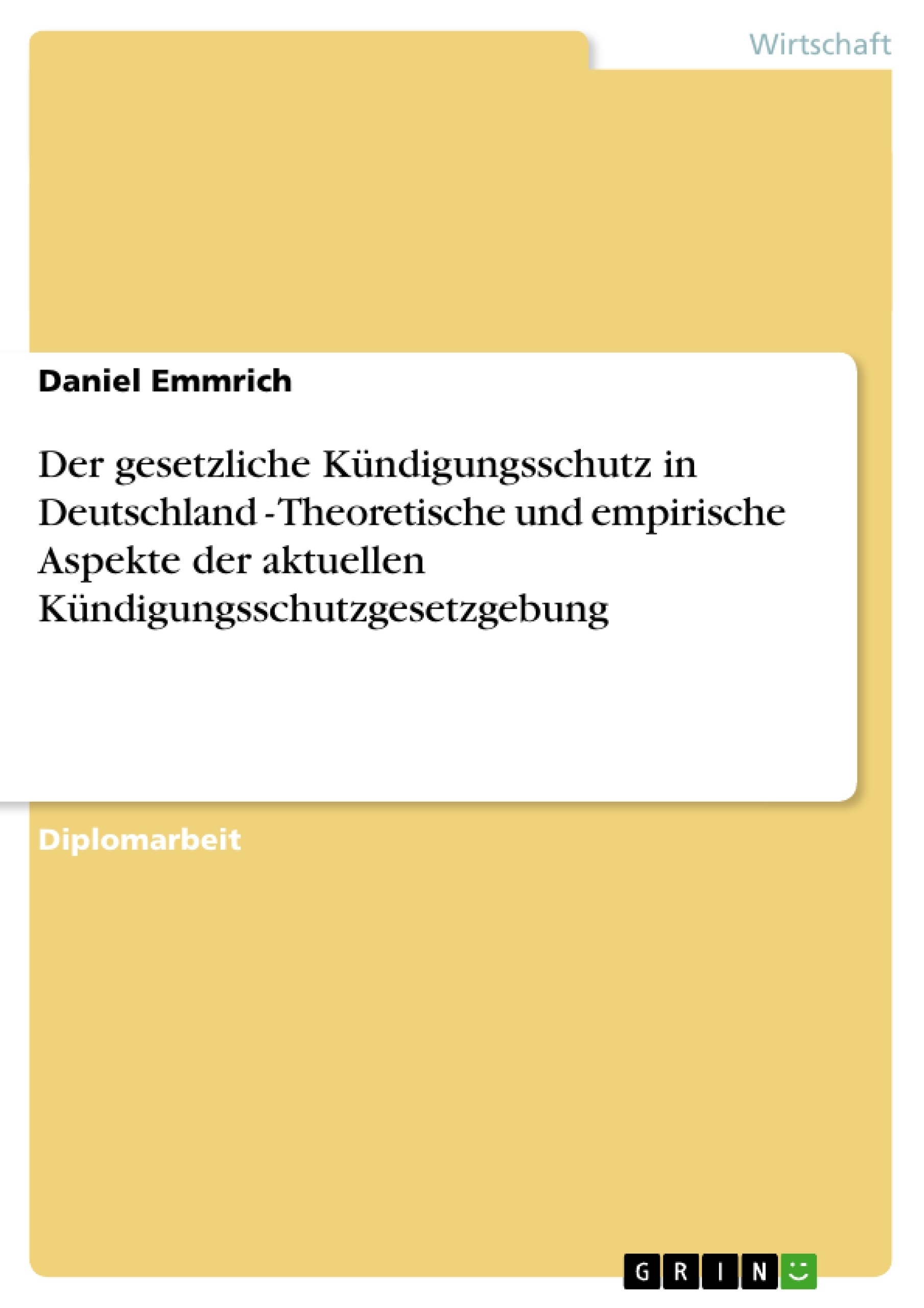Angesichts der anhaltend hohen Massenarbeitslosigkeit in Deutschland und Teilen Westeuropas wird in Politik und Wirtschaftswissenschaft seit Jahrzehnten über die möglichen Ursachen debattiert. Weitgehend herrscht Einigkeit darüber, dass die Arbeitslosigkeit nicht nur konjunktureller Natur sein kann, sondern vor allem auf strukturelle Faktoren zurückzuführen ist. In diesem Zusammenhang wird immer wieder auf die mangelnde Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Arbeitsmärkte hingewiesen. Hauptverantwortlich für diesen Zustand sind demnach anreizschwache und überdimensionierte Sozialsysteme, ausgeprägter gewerkschaftlicher Einfluss auf den Lohnbildungsprozess und eine übergroße Regulierungsdichte im Arbeitsrecht. Dies hemmt das Beschäftigungswachstum und verstärkt die Begleiterscheinungen wirtschaftlicher Krisen, indem beispielsweise Arbeitslosen die Rückkehr in den Arbeitsmarkt durch institutionelle Hindernisse erschwert wird und Langzeitarbeitslosigkeit entsteht.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Beschäftigungswirkung des gesetzlichen Kündigungsschutzes, mit besonderer Berücksichtigung der Situation am deutschen Arbeitsmarkt und der geltenden gesetzlichen und institutionellen Regelungen, theoretisch und empirisch zu beleuchten. Dabei wird zunächst der institutionelle Rahmen des gesetzlichen Kündigungsschutzes in Deutschland vorgestellt, sowie einige Bemerkungen zum Ausmaß und zur Regulierung der befristeten Beschäftigung gemacht, die im Vergleich zum regulären Beschäftigungsverhältnis seit Jahren an Bedeutung hinzugewinnt und immer weniger als ,,atypische'' Beschäftigung angesehen werden kann.
Im theoretischen Teil werden dann auf Grundlage der neoklassischen Arbeitsmarktlehre einige grundlegende Zusammenhänge zwischen der Arbeitsnachfrage und den Arbeitskosten entwickelt. Anschließend werden Kündigungsschutztheorien aus der Institutionenökonomik und schließlich die juristische Sichtweise auf den Kündigungsschutz dargestellt.
Der empirische Teil der Arbeit leitet mit einer Übersicht zur mittlerweile umfangreichen Literatur auf dem Gebiet staatlicher Regulierung insgesamt und dem Kündigungsschutz im Besonderen ein. Im Folgenden werden drei Studien vorgestellt, die in ihrer Methodik zwar verschiedenartig sind, aber alle zum Ziel haben, die Wirkungen von Kündigungsschutzregelungen auf den Arbeitsmarkt und die Beschäftigung zu erforschen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesetzlicher Kündigungsschutz in Deutschland
- Kündigungsgründe
- Personenbedingte Kündigung
- Verhaltensbedingte Kündigung
- Betriebsbedingte Kündigung
- Geltung des KSchG
- Befristete Beschäftigung
- Abfindungen
- Kündigungsgründe
- Theoretische Aspekte des gesetzlichen Kündigungsschutzes
- Arbeitsnachfrage
- Statische Arbeitsnachfrage
- Anpassungskosten der dynamischen Arbeitsnachfrage
- Intertemporale Arbeitsnachfrage
- Institutionenökonomische Aspekte
- Beschäftigungsfixkosten
- Externe Effekte
- Asymmetrische Informationen
- Kooperation
- Insidermacht
- Juristische Sichtweise
- Arbeitsnachfrage
- Empirische Aspekte des gesetzlichen Kündigungsschutzes
- Literaturüberblick
- Studien auf Makroebene
- Studien auf Mikroebene
- Indikatorenansatz der OECD
- Methodologie
- Ergebnisse
- Kritische Betrachtung
- IW-Umfrage
- Methodologie
- Ergebnisse
- Kritische Betrachtung
- REGAM - Studie der Böcklerstiftung
- Methodologie
- Ergebnisse
- Kritische Betrachtung
- Literaturüberblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht den gesetzlichen Kündigungsschutz in Deutschland und dessen ökonomische Auswirkungen. Ziel ist es, die wichtigsten Argumente für und gegen den Kündigungsschutz zu beleuchten und die empirischen Befunde zu den Folgen des Kündigungsschutzes für die Arbeitsmärkte zu analysieren.
- Die verschiedenen Formen des Kündigungsschutzes und deren rechtliche Grundlagen
- Die ökonomischen Auswirkungen des Kündigungsschutzes auf die Arbeitsnachfrage und das Beschäftigungswachstum
- Die Rolle des Kündigungsschutzes in der deutschen Arbeitsmarktpolitik
- Die empirischen Befunde zu den Folgen des Kündigungsschutzes auf die Arbeitsmärkte
- Die Diskussion um den Kündigungsschutz in der Politik und Wissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in das Thema und stellt die Relevanz des Kündigungsschutzes in der aktuellen Debatte um die Arbeitsmarktpolitik dar. Kapitel 2 beleuchtet den gesetzlichen Kündigungsschutz in Deutschland, beschreibt die verschiedenen Kündigungsgründe und geht auf die Geltung des KSchG ein. Außerdem werden befristete Beschäftigung und Abfindungen als wichtige Aspekte des Kündigungsschutzes behandelt.
Im dritten Kapitel werden die theoretischen Aspekte des Kündigungsschutzes betrachtet. Die Kapitel analysieren die Arbeitsnachfrage unter Berücksichtigung der statischen und dynamischen Arbeitsnachfrage sowie der intertemporalen Arbeitsnachfrage. Weiterhin werden institutionenökonomische Aspekte, wie Beschäftigungsfixkosten, externe Effekte, asymmetrische Informationen, Kooperation und Insidermacht, diskutiert. Abschließend wird die juristische Sichtweise auf den Kündigungsschutz beleuchtet.
Kapitel 4 widmet sich den empirischen Aspekten des Kündigungsschutzes. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Studien, die die Auswirkungen des Kündigungsschutzes auf die Arbeitsmärkte untersuchen. Es werden sowohl Studien auf Makroebene als auch auf Mikroebene betrachtet. Außerdem werden die Indikatorenansätze der OECD und IW-Umfragen sowie die REGAM-Studie der Böcklerstiftung vorgestellt und kritisch analysiert.
Schlüsselwörter
Gesetzlicher Kündigungsschutz, Arbeitsmarkt, Arbeitsnachfrage, Beschäftigungswachstum, Kündigungsgründe, Befristete Beschäftigung, Abfindungen, Institutionelle Rahmenbedingungen, Arbeitsmarktpolitik, Empirische Studien, Makroökonomie, Mikroökonomie, OECD, IW-Umfrage, REGAM-Studie
Häufig gestellte Fragen
Welche Kündigungsgründe gibt es im deutschen Kündigungsschutzgesetz?
Man unterscheidet zwischen personenbedingten, verhaltensbedingten und betriebsbedingten Kündigungen.
Wie wirkt sich Kündigungsschutz auf die Arbeitsnachfrage aus?
Theoretisch kann ein hoher Kündigungsschutz die Einstellungsbereitschaft hemmen, da er die Anpassungskosten bei wirtschaftlichen Krisen erhöht.
Was ist der "Indikatorenansatz der OECD"?
Dies ist eine Methode der OECD, um die Strenge des Kündigungsschutzes international vergleichbar zu machen und dessen Einfluss auf die Beschäftigung zu messen.
Welche Rolle spielen Abfindungen im deutschen System?
Abfindungen dienen oft als Ausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes und werden häufig in Aufhebungsverträgen oder nach Kündigungsschutzprozessen vereinbart.
Ist befristete Beschäftigung eine Lösung für starre Arbeitsmärkte?
Unternehmen nutzen Befristungen oft als Flexibilisierungsinstrument, um den strengen Regelungen des regulären Kündigungsschutzes zu entgehen.
- Citation du texte
- Diplom-Volkswirt Daniel Emmrich (Auteur), 2007, Der gesetzliche Kündigungsschutz in Deutschland - Theoretische und empirische Aspekte der aktuellen Kündigungsschutzgesetzgebung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84696