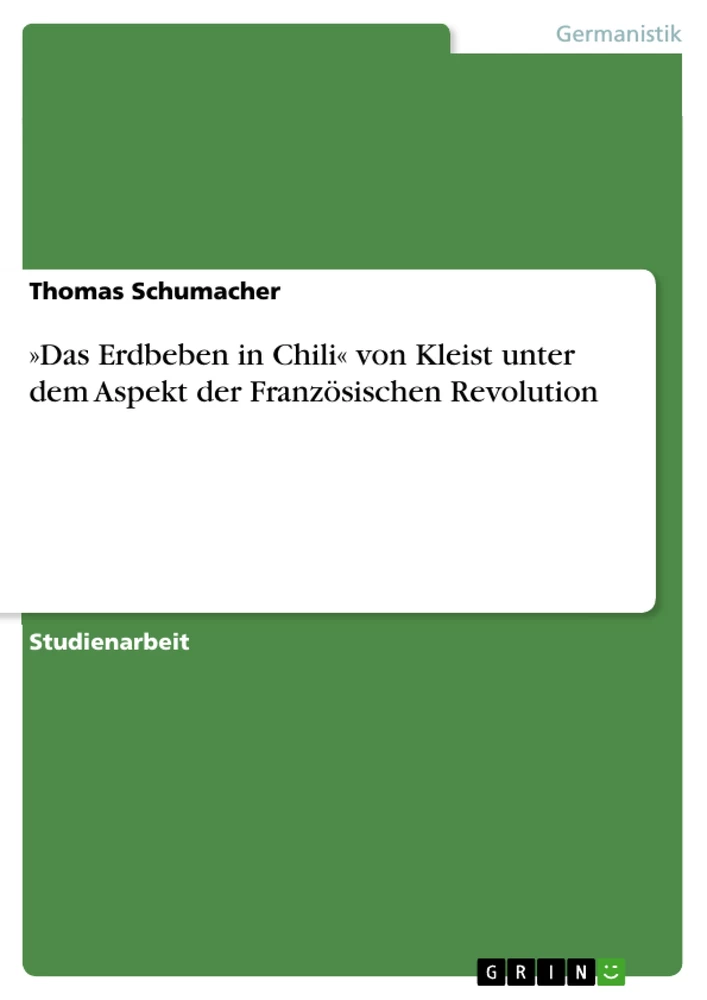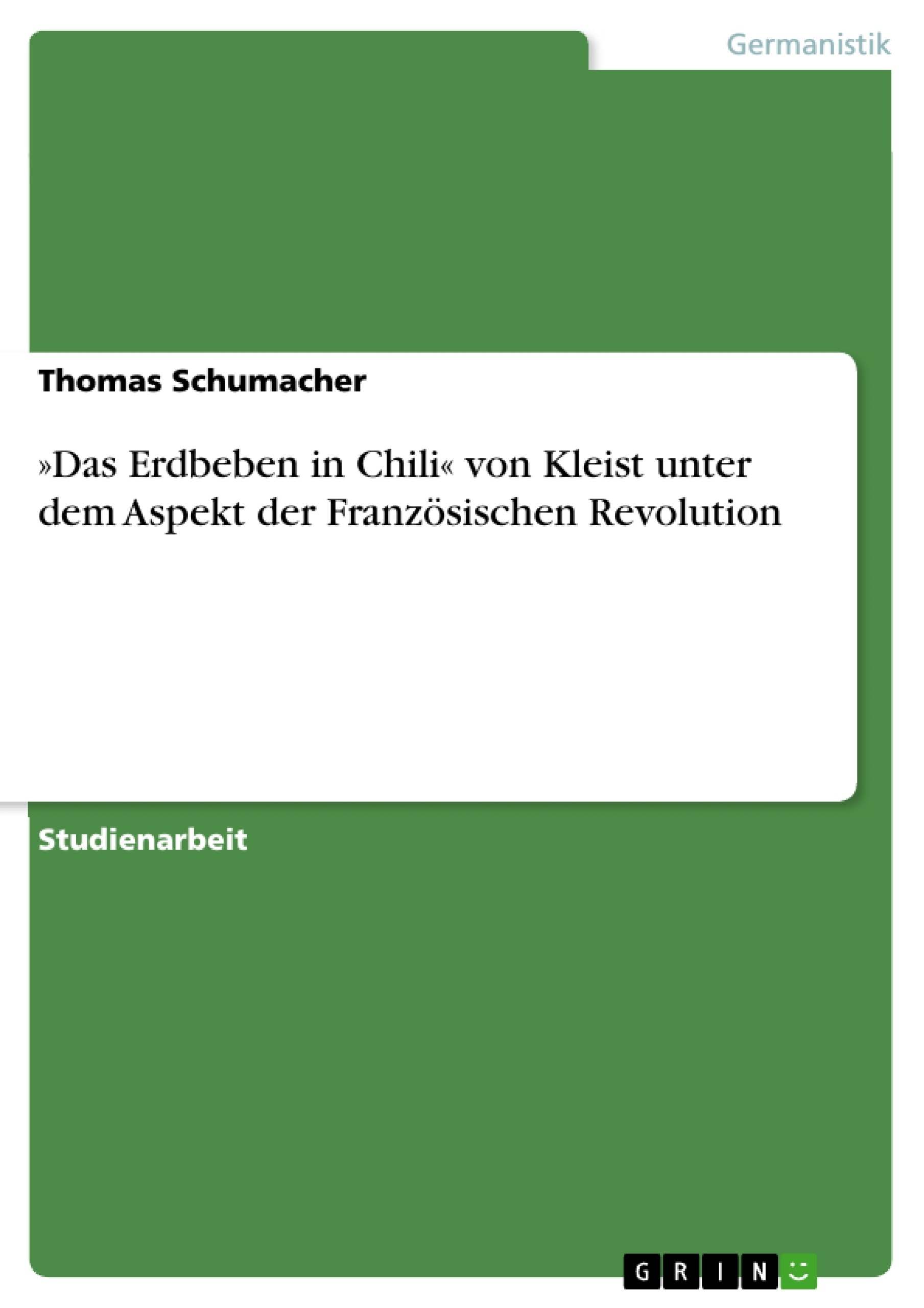In dieser Arbeit soll es nicht um Schlagworte wie Humanität oder Theologenschelte (Thomas Mann 1951), Sozialproblematik (Wolff 1954), Ironie (Wittkowski 1969), anarchische Gesellschaft (Horn 1978), Bewusstseinskritik (Beckmann 1978), Theodizee (Ledanff 1986), patriarchalische Ordnung (Zimmermann 1989), Paradiesvorstellungen (Emmrich 1990), Katastrophenbewältigung (Moucha 2000) und die mehr als fragwürdige „Verteidigung der Weltordnung“ (Pongs 1969), sondern um politisch-soziale Momente in Kleists »Erdbeben« gehen. Um diese Elemente im Text ausfindig machen zu können, muß man die allegorische Erzählweise Kleists beachten: »Allegorisches Erzählen heißt ein Erzählen mit Absichten, mit einem intellektuellen Einsatz, mit Wertvorstellungen im Hintergrund, die verteidigt oder etabliert werden müssen, oft in dieser Zeit auch: mit Gegenwartskritik. […] Zum allegorischen Erzählen gehört, daß nicht direkte Gegenbilder der Wirklichkeit in der Literatur zu finden sind und umgekehrt: daß die Literatur nicht direkt und unverändert die Wirklichkeit projektiert« (KOOPMANN 1990).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Vorwort
- 1.2 Zur Zitierweise und zur Literatur
- 2. Analyse mit produktionsästhetischem Schwerpunkt
- 3. Ein kurzer Überblick über Handlung und Struktur
- 4. Einige Interpretationsansätze
- 4.1 Der Mittelteil der Erzählung
- 4.2 Das Ende der Erzählung
- 4.3 Fazit
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Heinrich von Kleists Erzählung "Das Erdbeben in Chili" unter dem Aspekt der Französischen Revolution. Die Zielsetzung besteht darin, die politisch-soziale Kritik Kleists im Kontext seiner allegorischen Erzählweise zu analysieren und die Autorintention im Hinblick auf die damalige Staatswirklichkeit zu beleuchten. Die Metapher des Erdbebens wird nicht als abstrakte Allegorie, sondern als Spiegelbild der gesellschaftlichen und politischen Umbrüche verstanden.
- Die allegorische Erzählweise Kleists und ihr Einsatz zur Gesellschaftskritik
- Der Einfluss der Französischen Revolution auf Kleists Werk
- Politisch-soziale Momente in "Das Erdbeben in Chili"
- Die Darstellung der Staatswirklichkeit zu Kleists Lebzeiten
- Kleists literarische Technik der maßlosen Übertreibung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses einführende Kapitel erläutert die Schwierigkeiten bei der Themenwahl aufgrund der vielschichtigen Interpretationen von Kleists "Das Erdbeben in Chili". Der Autor wählt die politische und soziale Kritik als zentralen Fokus, im Gegensatz zu rein theologischen Deutungen, um eine wesentliche Facette der Autorintention zu beleuchten. Es wird die allegorische Erzählweise Kleists und deren Anwendung zur Gesellschaftskritik hervorgehoben, die auch bei zeitgenössischen Autoren wie Eichendorff, Chamisso, Brentano und Novalis zu finden ist. Die maßlose Übertreibung in Kleists Erzählung wird als legitim und wirkungsvoll dargestellt, um die Nachwirkungen der Revolution zu verdeutlichen.
2. Analyse mit produktionsästhetischem Schwerpunkt: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte von Kleists Erzählung, ihre Veröffentlichung im "Morgenblatt" und die mögliche zeitliche Einordnung in Bezug auf andere Werke des Autors. Es werden verschiedene Hypothesen zur Entstehungszeit diskutiert, einschließlich Parallelen zu Schillers Wallenstein-Drama. Die Änderung des Titels durch Kleist wird analysiert und im Kontext seiner Absicht interpretiert, die Erzählung als Ereignis von allgemeiner Bedeutung zu etablieren. Der Einfluss der Französischen Revolution und der Aufklärung auf Kleists Weltanschauung und seine literarische Tätigkeit wird durch ein Zitat aus einem Brief Kleists an Karoline von Schlieben veranschaulicht, der seine Eindrücke aus dem postrevolutionären Paris beschreibt.
Schlüsselwörter
Heinrich von Kleist, Das Erdbeben in Chili, Allegorie, Französische Revolution, Gesellschaftskritik, Politische Kritik, Staatswirklichkeit, Produktionsästhetik, Allegorisches Erzählen, Maßlose Übertreibung.
Häufig gestellte Fragen zu Heinrich von Kleists "Das Erdbeben in Chili"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Heinrich von Kleists Erzählung "Das Erdbeben in Chili" unter dem Aspekt der Französischen Revolution. Der Fokus liegt auf der politisch-sozialen Kritik Kleists, seiner allegorischen Erzählweise und der Autorintention im Hinblick auf die damalige Staatswirklichkeit. Die Metapher des Erdbebens wird als Spiegelbild gesellschaftlicher und politischer Umbrüche interpretiert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Kleists allegorische Erzählweise und deren Einsatz zur Gesellschaftskritik; den Einfluss der Französischen Revolution auf Kleists Werk; politisch-soziale Momente in "Das Erdbeben in Chili"; die Darstellung der Staatswirklichkeit zu Kleists Lebzeiten; und Kleists literarische Technik der maßlosen Übertreibung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Die Einführung beleuchtet die Schwierigkeiten der Themenwahl aufgrund vielschichtiger Interpretationen und begründet die Fokussierung auf die politische und soziale Kritik. Das Kapitel Analyse mit produktionsästhetischem Schwerpunkt behandelt die Entstehungsgeschichte, Veröffentlichung und mögliche zeitliche Einordnung der Erzählung sowie den Einfluss der Französischen Revolution und der Aufklärung auf Kleists Werk. Weitere Kapitel befassen sich mit einem Überblick über Handlung und Struktur sowie verschiedenen Interpretationsansätzen, einschließlich des Mittelteils, des Endes und eines Fazits. Schließlich findet sich ein Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Heinrich von Kleist, Das Erdbeben in Chili, Allegorie, Französische Revolution, Gesellschaftskritik, Politische Kritik, Staatswirklichkeit, Produktionsästhetik, Allegorisches Erzählen, Maßlose Übertreibung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung besteht darin, die politisch-soziale Kritik Kleists im Kontext seiner allegorischen Erzählweise zu analysieren und die Autorintention im Hinblick auf die damalige Staatswirklichkeit zu beleuchten.
Wie wird die Metapher des Erdbebens interpretiert?
Die Metapher des Erdbebens wird nicht als abstrakte Allegorie, sondern als Spiegelbild der gesellschaftlichen und politischen Umbrüche verstanden.
Welche Autoren werden im Zusammenhang mit Kleists Erzählweise genannt?
Im Kontext der allegorischen Erzählweise werden zeitgenössische Autoren wie Eichendorff, Chamisso, Brentano und Novalis erwähnt.
- Citation du texte
- Thomas Schumacher (Auteur), 2001, »Das Erdbeben in Chili« von Kleist unter dem Aspekt der Französischen Revolution, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84722