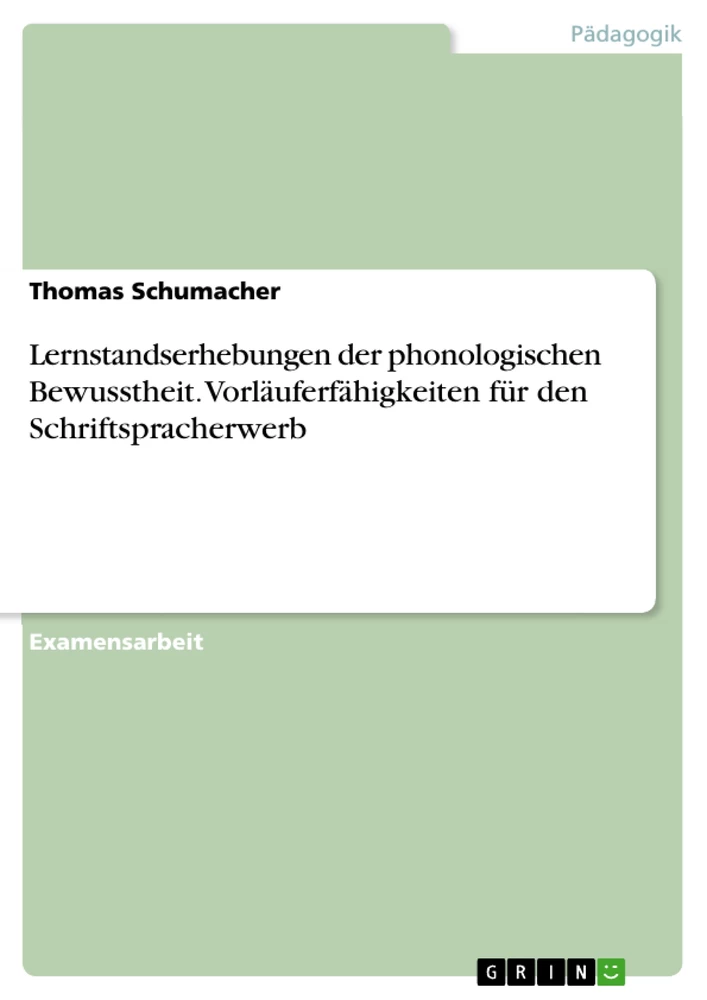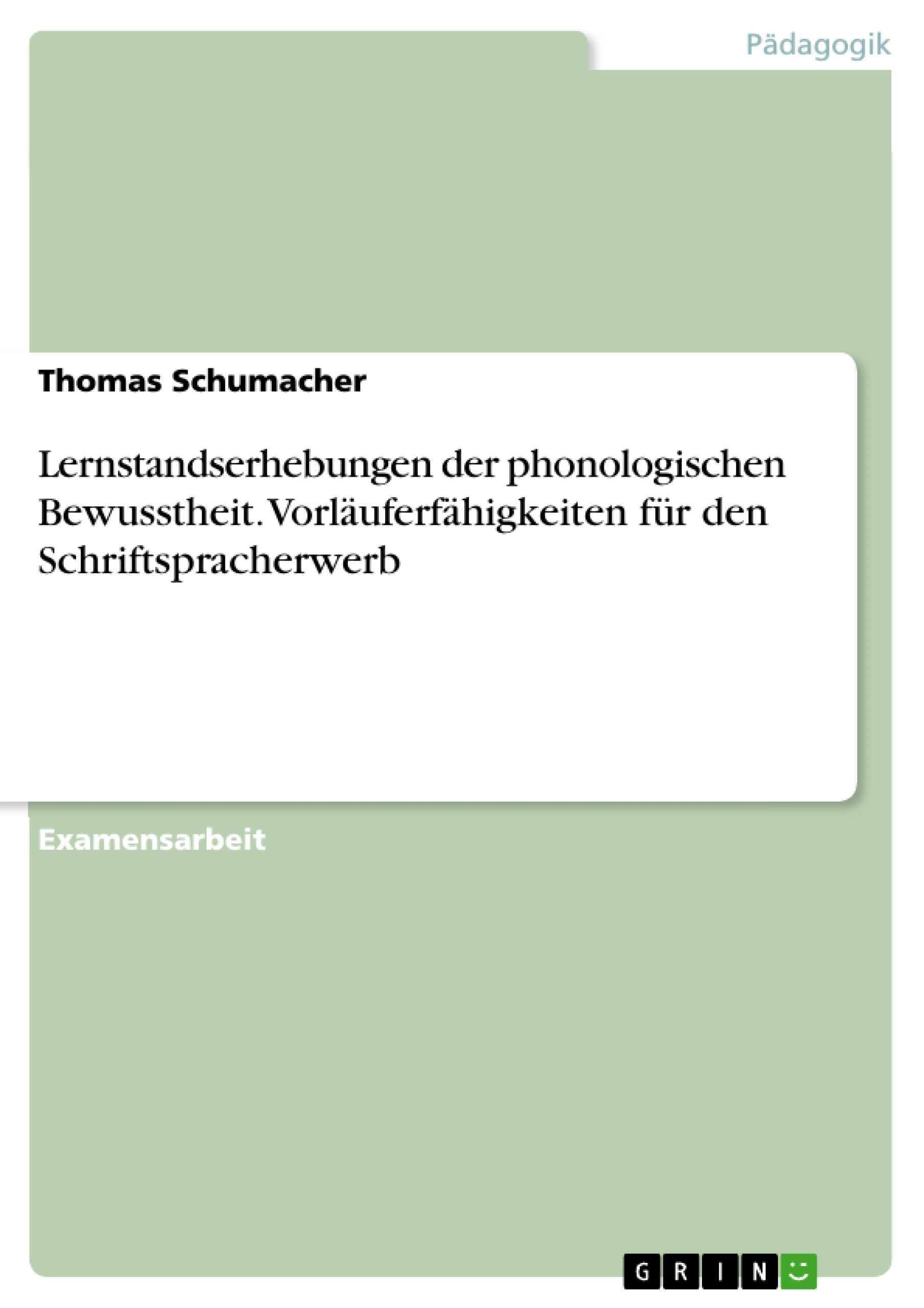Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit entwickelt sich in Anlehnung an das neue Berliner Schulgesetz von 2004, das die Grundlagen für tiefgreifende Veränderungen im Bildungswesen geschaffen hat. Die konzeptuelle Neugestaltung der Schulanfangsphase (SAPh) und die damit einhergehende vorgezogene Schulpflicht zählen diesbezüglich zu den wesentlichsten Reformen.
Entsprechend sieht sich die Berliner Grundschule zunehmend mit neuen Aufgaben konfrontiert. Den hohen Anstieg der Zahl der Kinder mit verminderten motorischen und sensorischen Erfahrungen verdeutlicht die Tatsache, dass sich die Lebensbedingungen und damit auch die Lernvoraussetzungen immer weiter auseinander entwickeln und somit die Heterogenität besonders bei Schulanfängern zunimmt. Einschränkungen in der motorischen und sensorischen Entwicklung stehen in einer engen Wechselwirkung mit der sprachlichen Entwicklung. Hinsichtlich der unterschiedlichen Kompetenzen in den Bereichen Bewegung, Wahrnehmung und Sprache stellt sich die Frage, wie die neue flexible Schulanfangsphase dieser Heterogenität begegnen kann?
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Lernstandserhebungen in der Schulanfangsphase der Berliner Schule
- Theoretische und didaktische Grundlagen der phonologischen Bewusstheit
- Phonologische Bewusstheit - Begriffsklärung
- Phonologische Bewusstheit - Rahmenlehrplanbezug
- Der Einfluss der phonologischen Bewusstheit auf die Lese-Rechtschreibkompetenz
- Zur Bedeutung der phonologischen Bewusstheit bei Schulanfängern
- Überprüfung der phonologischen Bewusstheit bei Schulanfängern
- Zum geplanten Vorgehen
- Durchführung der Lernstandserhebungen
- Überprüfung grundlegender Kompetenzen sowie LauBe - Verhalten während der Überprüfung und Ergebnisse
- Gruppentests PB-LRS - Verhalten während der Überprüfung und Ergebnisse
- Interpretation der Ergebnisse
- Beschreibung der temporären Lerngruppe hinsichtlich phonologischer Kompetenzen und Ableitung individueller Förderziele
- Entwicklung unterrichtsrelevanter Fördermaßnahmen zur Verbesserung der phonologischen Bewusstheit
- Vorüberlegungen und Legitimierung
- Darstellung der Förderprogramme und Begründung für deren Verwendung
- Organisatorisch-methodische Rahmenbedingungen der Förderung
- Vorfachlicher Unterricht und „Wochenplanarbeit von Anfang an“
- Temporäre Lerngruppen
- Darstellung von Planung, Durchführung und Analyse der Förderung
- Aufbau der Diagnostik und Fördereinheit
- Darstellung einer Förderstunde zur Silbensegmentierung am 17.10.2006
- Zielsetzung
- Didaktisch-methodische Überlegungen
- Verlaufsplanung
- Darstellung und Analyse
- Darstellung einer Förderstunde zur Anlautanalyse am 10.11.2006
- Zielsetzung
- Didaktisch-methodische Überlegungen
- Verlaufsplanung
- Darstellung und Analyse
- Erneute Überprüfung der phonologischen Bewusstheit nach Abschluss der temporären Förderung
- Gesamtreflexion und Ausblick
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit im Kontext des Berliner Schulgesetzes von 2004, das die Schulanfangsphase neu gestaltet und die vorgezogene Schulpflicht einführt. Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Lernstandserhebungen zur Feststellung der phonologischen Bewusstheit bei Schulanfängern, sowohl mit als auch ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Das Ziel der Arbeit ist es, durch die Analyse der Ergebnisse dieser Lernstandserhebungen, individuelle Förderziele zu entwickeln und geeignete Fördermaßnahmen zu planen und durchzuführen.
- Einfluss der phonologischen Bewusstheit auf die Lese-Rechtschreibentwicklung
- Entwicklung und Durchführung von Lernstandserhebungen zur Überprüfung der phonologischen Bewusstheit
- Entwicklung und Umsetzung individueller Fördermaßnahmen basierend auf den Ergebnissen der Lernstandserhebungen
- Analyse der Effektivität der Fördermaßnahmen
- Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für die Gestaltung der Schulanfangsphase
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den aktuellen Kontext des Berliner Schulgesetzes von 2004 und die damit einhergehende Neugestaltung der Schulanfangsphase beleuchtet. Sie analysiert die Herausforderungen, die sich aus der Heterogenität der Schülerschaft ergeben, insbesondere im Bereich der motorischen und sensorischen Entwicklung und ihrer Auswirkungen auf die sprachliche Entwicklung.
Das erste Kapitel konzentriert sich auf die Bedeutung von Lernstandserhebungen in der Schulanfangsphase. Es untersucht, wie diese Erhebungen als konzeptueller Bestandteil der Schulanfangsphase eingesetzt werden können, um die individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder im basalen und sprachlichen Bereich zu analysieren.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den theoretischen und didaktischen Grundlagen der phonologischen Bewusstheit. Es klärt den Begriff der phonologischen Bewusstheit, setzt ihn in den Kontext des Rahmenlehrplans und beleuchtet seinen Einfluss auf die Lese-Rechtschreibkompetenz. Darüber hinaus wird die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für Schulanfänger hervorgehoben.
Das dritte Kapitel behandelt die Überprüfung der phonologischen Bewusstheit bei Schulanfängern. Es beschreibt das geplante Vorgehen bei der Durchführung der Lernstandserhebungen und erläutert die verschiedenen Methoden, die eingesetzt werden, um die phonologischen Kompetenzen der Kinder zu testen. Die Ergebnisse dieser Tests werden anschließend analysiert und interpretiert.
Das vierte Kapitel beschreibt eine temporäre Lerngruppe, ihre phonologischen Kompetenzen und die Ableitung individueller Förderziele. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der Entwicklung von unterrichtsrelevanten Fördermaßnahmen, die auf die Verbesserung der phonologischen Bewusstheit abzielen. Es stellt verschiedene Förderprogramme vor, begründet deren Verwendung und erläutert die organisatorischen und methodischen Rahmenbedingungen der Förderung.
Das sechste Kapitel beschreibt die Planung, Durchführung und Analyse der Förderung. Es zeigt den Aufbau der Diagnostik und Fördereinheit und stellt zwei konkrete Förderstunden vor: eine zur Silbensegmentierung und eine zur Anlautanalyse. Die Zielsetzung, didaktisch-methodische Überlegungen, Verlaufsplanung und Darstellung der jeweiligen Förderstunde werden detailliert beschrieben und analysiert.
Das siebte Kapitel beschäftigt sich mit der erneuten Überprüfung der phonologischen Bewusstheit nach Abschluss der temporären Förderung. Es betrachtet die Ergebnisse der erneuten Tests und analysiert den Einfluss der durchgeführten Fördermaßnahmen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Schulanfangsphase, Lernstandserhebungen, phonologische Bewusstheit, Lese-Rechtschreibkompetenz, individuelle Förderung, Fördermaßnahmen, didaktische Methoden, Analyse und Evaluation.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter phonologischer Bewusstheit?
Es ist die Fähigkeit, die lautliche Struktur der Sprache zu erkennen, wie z. B. das Zerlegen von Wörtern in Silben oder das Identifizieren von Anlauten.
Warum ist die phonologische Bewusstheit für Schulanfänger so wichtig?
Sie gilt als zentrale Vorläuferfähigkeit für den Schriftspracherwerb. Defizite in diesem Bereich sind oft Vorboten für spätere Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS).
Was änderte das Berliner Schulgesetz von 2004 für die Grundschulen?
Es führte die flexible Schulanfangsphase (SAPh) und die vorgezogene Schulpflicht ein, was eine stärkere Berücksichtigung der kindlichen Heterogenität erfordert.
Wie werden Lernstandserhebungen in der Schulanfangsphase durchgeführt?
Durch standardisierte Gruppentests (z. B. PB-LRS) und Beobachtungsverfahren werden die basalen Kompetenzen der Kinder systematisch erfasst.
Was ist das Ziel einer temporären Lerngruppe?
Sie dient der gezielten, zeitlich begrenzten Förderung von Kindern mit ähnlichen Defiziten, um individuelle Lernrückstände in Bereichen wie der Silbensegmentierung auszugleichen.
Welche Fördermaßnahmen werden in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt konkrete Einheiten zur Silbensegmentierung und Anlautanalyse sowie die Integration dieser Förderung in die Wochenplanarbeit.
- Quote paper
- Thomas Schumacher (Author), 2006, Lernstandserhebungen der phonologischen Bewusstheit. Vorläuferfähigkeiten für den Schriftspracherwerb, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84728