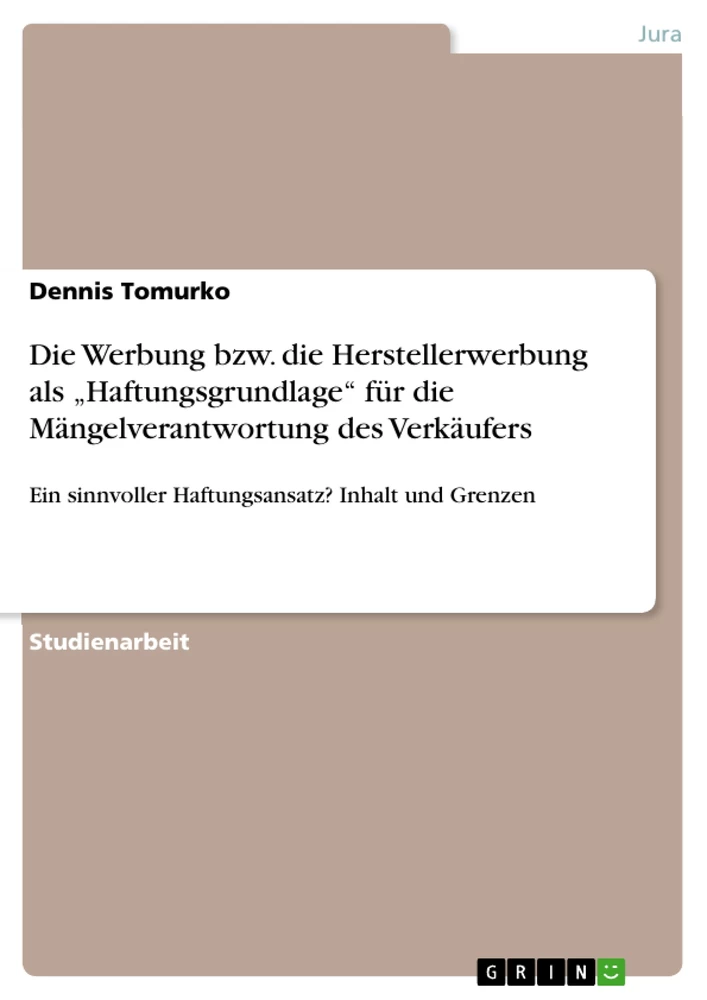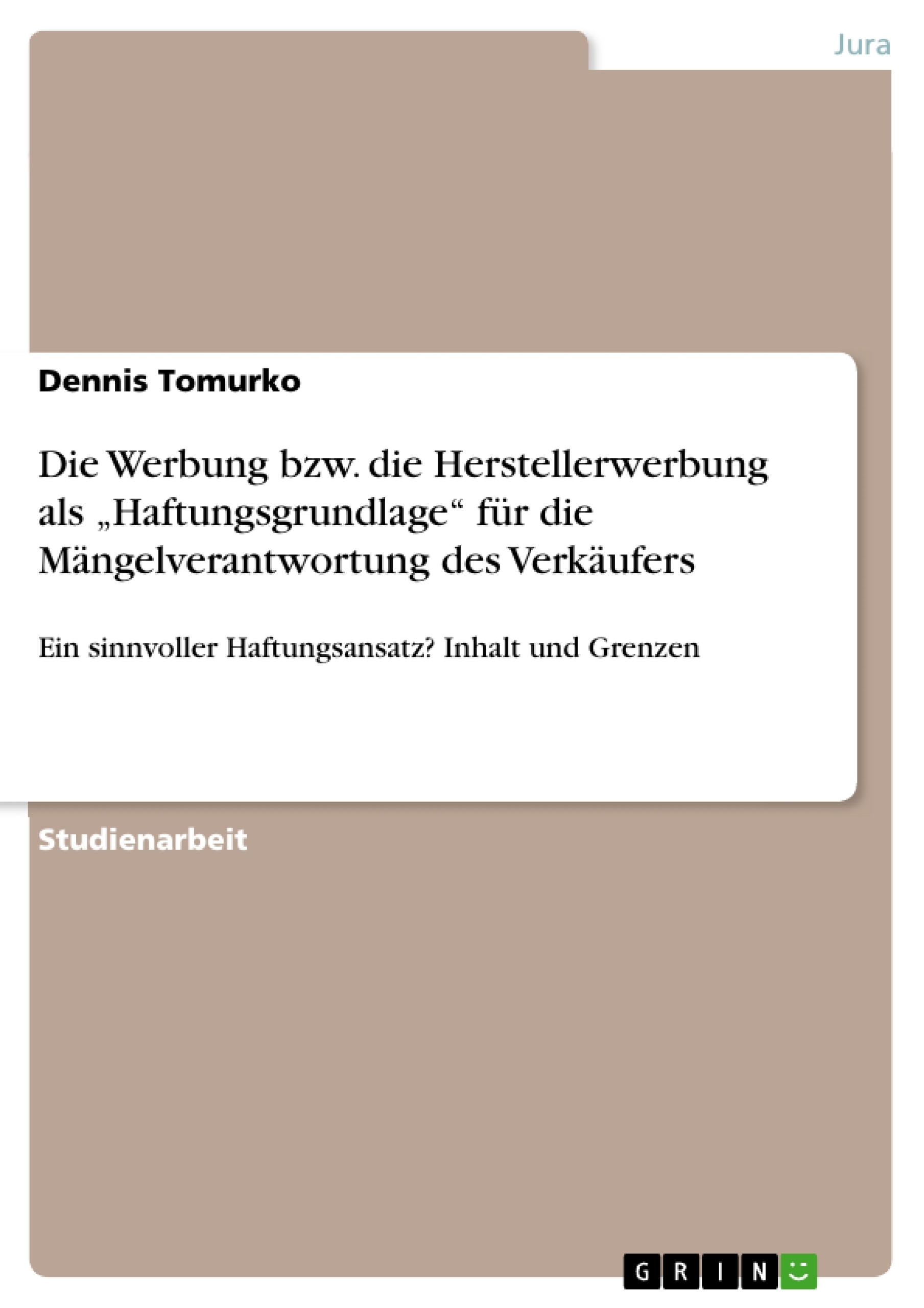Das Europäische Parlament und der Europäische Rat haben am 25.05.1999 die Verbrauches-güterkauf-Richtlinie 1999/44/EG beschlossen. Diese Richtlinie galt ab dem 07.07.1999 und sollte von den EG-Mitgliedsstaaten bis zum 01.01.2002 in nationales Recht umgesetzt wer-den. Die Umsetzung dieser Richtlinie in deutsches Recht erfolgte schließlich am 26.11.2001 durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz.
Diese Richtlinie regelte u.a. den Sachmangelbegriff, die Verbraucherrechte bei Sachmängeln, die Verjährungsfristen, die Anforderungen an Garantien und den Rückgriff der Unternehmen in der Lieferkette. Der Zweck dieser Richtlinie bestand darin, ein harmonisches Kauf- und Leistungsstörungsrecht in den EU-Ländern zu schaffen, weil disharmonische Rechtsvorschriften über die Sachmängelhaftung beim Kauf und über die Garantiehaftung den freien Warenverkehr zwischen den Mitgliedsländern erschweren. Außerdem hat früher das Wettbewerbsrecht durch die §§ 3, 4, 13a UWG den Konsumenten ungenügend geschützt.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem § 434 I 3 BGB. Dieser soll umfassend dargestellt und bewertet werden, vor allem die Ausschlusstatbestände. Im Mittelpunkt der Arbeit steht nur die Verkäuferhaftung für die Werbung des Herstellers oder Dritten.
§ 434 BGB umfasst lediglich den Sachkauf. Mit dem Rechtskauf und mit dem Kauf anderer „Gegenstände“ als Sache beschäftigt sich § 453 BGB, welcher die Vorschriften über den Sachkauf für entsprechend anwendbar erklärt.
Zuerst wird der Sachmangelbegriff genau erläutert. Dem folgt – auf dem Vorhergehenden aufbauend – die Darstellung von Begrifflichkeiten des § 434 I 3 BGB.
Der Begriff „Garantie“ gem. § 443 BGB fällt unter bestimmten Voraussetzungen unter den Begriff „die Öffentlichkeit der Äußerungen“. § 443 BGB führt in bestimmten Konstellationen zur Verkäuferhaftung für Herstellergarantie. Der Fehlerbegriff des § 3 ProdHaftG umfasst zwar Mängel, die nicht unter den § 434 BGB fallen, weist aber mit dem Begriff der Darbietung in § 3 I a) ProdHaftG gewisse Parallelen zu der Regelung des § 434 I 3 BGB auf, vor allem zum Begriff der Werbung und zum Bewertungsmaßstab. Aus diesen Gründen beschäftigt sich die vorliegende Arbeit auch mit den § 443 BGB und § 3 I a) ProdHaftG.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Sachmangel i.S.d. § 434 I BGB
- Beschaffenheitsbegriff
- Sachmangelbegriff des § 434 I 3 BGB
- Begrifflichkeiten
- Der erste Ausschlusstatbestand gem. § 434 I 3 BGB
- Der zweite Ausschlusstatbestand nach § 434 I 3 BGB
- Der dritte Ausschlusstatbestand gem. § 343 I 3 BGB
- Rechtsfolgen beim Vorliegen eines Sachmangels
- Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie i.S.d. § 433 BGB
- Voraussetzungen einer wirksamen Garantie
- Garantiegeber
- Garantiefrist
- Garantieerklärung
- Angegebene Bedingungen
- Geltendmachung der Rechte aus einer Garantie
- Beweislastfragen
- Bewertung des § 443 BGB
- Fehler i.S.d. § 3 I a) ProdHaftG
- Produktfehler
- Fehlerkategorie Instruktionsfehler
- Darbietung nach § 3 I a) ProdHaftG
- Der Maßstab der berechtigten Sicherheitserwartungen
- Berücksichtigung aller Umstände
- Abgrenzung zur Mängelhaftung
- Bewertung der Vorschrift des § 434 I 3 BGB im Hinblick auf die Verkäuferhaftung für Dritte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die rechtliche Problematik der Herstellerwerbung als Grundlage für die Mängelverantwortung des Verkäufers. Dabei steht im Zentrum der Untersuchung, ob dieser Haftungsansatz sinnvoll ist und welche Grenzen ihm gesetzt sind.
- Die Rolle der Herstellerwerbung als maßgebliche Quelle für den Beschaffenheitsbegriff im Kaufvertrag
- Die Grenzen der Haftung des Verkäufers für Mängel, die durch Herstellerwerbung verursacht wurden
- Die Abgrenzung der Haftung des Verkäufers von der Produkthaftung des Herstellers
- Die Bedeutung von Garantien im Zusammenhang mit der Haftung des Verkäufers
- Die Auswirkungen des ProdHaftG auf die Haftung des Verkäufers
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über das Thema und die Fragestellung der Hausarbeit. Es stellt die rechtliche Problematik der Herstellerwerbung als Grundlage für die Mängelverantwortung des Verkäufers dar und skizziert die zu bearbeitenden Themenfelder.
- Sachmangel i.S.d. § 434 I BGB: In diesem Kapitel wird der Beschaffenheitsbegriff des § 434 I BGB näher beleuchtet. Es werden unterschiedliche Ansichten in der Literatur dargestellt und die Bedeutung der Herstellerwerbung für die Bestimmung der Beschaffenheit des Kaufgegenstands diskutiert. Die Autorin positioniert sich in diesem Punkt und zieht ein Fazit.
- Sachmangelbegriff des § 434 I 3 BGB: Dieses Kapitel behandelt den Sachmangelbegriff des § 434 I 3 BGB. Es werden die relevanten Begrifflichkeiten wie Hersteller, Gehilfe und Öffentlichkeit der Äußerungen definiert. Besonderes Augenmerk liegt auf der Bedeutung von Werbung als öffentliche Äußerung, die den Beschaffenheitsbegriff beeinflussen kann. Der Fokus liegt dabei auf der Abgrenzung zwischen zulässiger und unzulässiger Werbung und deren Auswirkungen auf die Haftung des Verkäufers.
- Rechtsfolgen beim Vorliegen eines Sachmangels: Dieses Kapitel beleuchtet die Rechtsfolgen, die sich aus dem Vorliegen eines Sachmangels ergeben. Es werden die verschiedenen Anspruchsmöglichkeiten des Käufers sowie die Haftungsregelungen des BGB und des ProdHaftG in diesem Kontext dargestellt.
- Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie i.S.d. § 433 BGB: Dieses Kapitel behandelt die rechtlichen Rahmenbedingungen von Garantien im Zusammenhang mit der Mängelhaftung des Verkäufers. Es werden die Voraussetzungen einer wirksamen Garantie, die Rolle des Garantiegebers, die Bedeutung der Garantiefrist und die Geltendmachung der Rechte aus einer Garantie erläutert. Abschließend werden wichtige Beweislastfragen im Zusammenhang mit Garantien behandelt.
- Bewertung des § 443 BGB: In diesem Kapitel wird die rechtliche Bedeutung des § 443 BGB im Kontext der Mängelhaftung des Verkäufers bewertet.
- Fehler i.S.d. § 3 I a) ProdHaftG: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff des Produktfehlers im Sinne des ProdHaftG. Es werden verschiedene Kategorien von Produktfehlern, darunter auch Instruktionsfehler, dargestellt. Darüber hinaus wird die Darbietung des Produkts in Bezug auf die Haftung des Herstellers untersucht, wobei die Bedeutung der Produktbeschreibung und der Werbung im Fokus steht. Abschließend werden die Abgrenzung zur Mängelhaftung und die Berücksichtigung der berechtigten Sicherheitserwartungen des Verbrauchers beleuchtet.
- Bewertung der Vorschrift des § 434 I 3 BGB im Hinblick auf die Verkäuferhaftung für Dritte: In diesem Kapitel wird die Vorschrift des § 434 I 3 BGB in Hinblick auf die Haftung des Verkäufers für Dritte bewertet. Es werden die Argumente für und gegen eine Haftung des Verkäufers für Mängel, die durch Herstellerwerbung verursacht wurden, diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Themenfeld der Mängelhaftung des Verkäufers im Zusammenhang mit Herstellerwerbung. Im Fokus stehen dabei die Rechtsfolgen für den Verkäufer, wenn er durch die Werbung des Herstellers für bestimmte Eigenschaften des Kaufgegenstands in die Irre geführt wurde. Im Zentrum der Untersuchung stehen die §§ 434 I 3, 443 BGB sowie das ProdHaftG. Wesentliche Themenbereiche sind der Beschaffenheitsbegriff, die Haftung für Instruktionsfehler, die Darbietung des Produkts und die Bedeutung der berechtigten Sicherheitserwartungen des Verbrauchers. Auch die Rolle von Garantien und die Abgrenzung zur Produkthaftung werden analysiert.
- Citation du texte
- Dennis Tomurko (Auteur), 2005, Die Werbung bzw. die Herstellerwerbung als „Haftungsgrundlage“ für die Mängelverantwortung des Verkäufers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84821