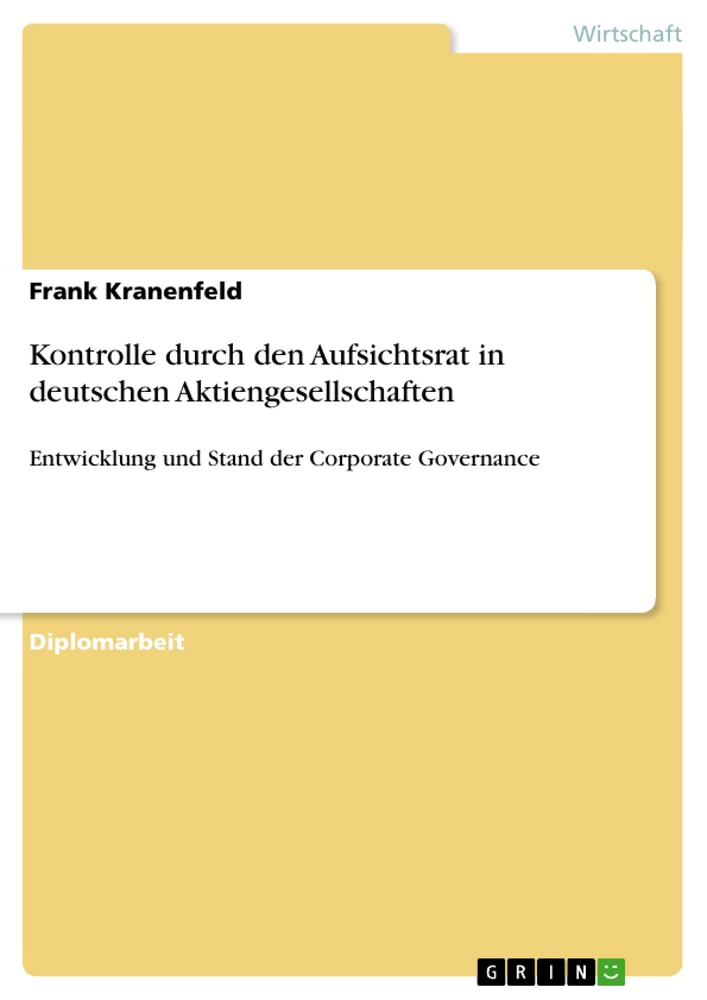Aktiengesellschaften zählen weltweit zu den bedeutendsten Wirtschaftsunternehmen. Die in ihr verkörperte Trennung von Unternehmenseigentum und Unternehmensführung entwickelte sich seit Beginn der Industrialisierung mit dem damit aufkommenden Kapitalbedarf zu einer vorherrschenden Unternehmensform. Durch ihre diversifizierte Kapitalstärke, die einer spezialisierten Führungsebene anvertraut ist, lassen sich entscheidende Wettbewerbsvorteile im Wege kapitalintensiver Investitionsvorhaben realisieren. Doch gerade der Vorteil einer spezialisierten Unternehmensführung bildet zugleich die Achillesferse der fremdgeführten Gesellschaft, beinhaltet diese doch sämtliche Elemente einer klassischen Agency-Beziehung mit den damit einhergehenden Opportunismusgefahren aufgrund eines Informationsgefälles. In großen Wirtschaftsnationen offenbarten Unternehmensschieflagen und Konkurse in bis dahin unerreichten Größenordnungen die Konsequenzen solch interessendivergierenden Verhaltens. Als Mechanismus zur Lösung oder zumindest Entschärfung dieser Probleme wurden Corporate Governance Strukturen in die Unternehmen implementiert. Auch in Deutschland wurden entsprechende Anstrengungen unternommen und ein national einheitlicher Corporate Governance Kodex geformt, um effektive Informations- und Kontrollsysteme der Gesellschaftsorgane zu gewährleisten. Ein für die USA erschreckendes Beispiel von Bilanzfälschungen des Energiekonzerns Enron im Jahre 2001 machte deutlich, dass die Notwendigkeit bestand, Strukturen zur Unternehmenssteuerung und vor allem seiner Kontrolle zu überdenken. Und auch in Deutschland entbrannte die Diskussion um effektive Aufsichts- und Kontrollinstanzen durch die jüngst aufgetretenen Wirtschaftskandale. Vertretend aufzuführen seien hierfür die Korruptionsaffäre der Siemens AG, der Fall Mannesmann oder der Streitfall um die Aktienverflechtungen des VW-Aufsichtsratsvorsitzenden Piëch mit der Porsche AG. Die Aufsichtsräte der genannten Gesellschaften mussten sich nunmehr den Vorwurf gefallen lassen, ihrer Überwachungsaufgabe nur unzureichend nachgekommen zu sein oder sie gar bewusst vernachlässigt zu haben. Ebenfalls stellte sich die Sinnfrage nach der Effizienz eines auf mehrheitlich unverbindlichen Regeln basierenden Governance Kodex. Die vorliegende Arbeit entwickelt Nutzen, Möglichkeiten und Grenzen des Organs "Aufsichtsrat" als Prinzipal des Vorstands und Agent der Aktionäre und beleuchtet hierzu die Lösungskonzepte des Deutschen Corporate Governance Kodex.
Inhaltsverzeichnis
- Ziel der Arbeit und Erläuterung der Vorgehensweise
- Einleitende Motivation
- Aufbau und Ablauf der Arbeit
- Das Begriffsverständnis von Corporate Governance
- Entstehungsgeschichte und Hintergrund der Corporate Governance
- OECD-Grundsätze der Corporate Governance
- Bezugsrahmen der Corporate Governance
- Differenzierung von internen und externen Governance Mechanismen
- Stakeholder vs. Shareholder Sichtweise
- Stakeholder Sichtweise
- Shareholder Sichtweise
- Hintergrund und Aufbau der deutschen Aktiengesellschaft
- Der Begriff der Unternehmensverfassung
- Dualistische Board Verfassung in Deutschland
- Unternehmensmitbestimmung innerhalb einer Aktiengesellschaft
- Der Vorstand
- Die Hauptversammlung
- Der Aufsichtsrat
- Der Begriff der Unternehmensverfassung
- Institutionenökonomische Ansätze
- Property Rights Theorie
- Transaktionskosten Theorie
- Prinzipal Agent Theorie
- Adverse Selection vor Vertragsabschluss
- Moral Hazard nach Vetragsabschluss
- Lösungsansätze der Prinzipal Agent Theorie
- Mehrstufige Prinzipal Agent Probleme
- Prinzipal Agent Probleme zwischen Aktionären und Vorstand
- Moral Hazard Gefahren
- Konsum nicht-pekuniärer Vorteile
- Mangelnder Arbeitseinsatz
- Horizont Problem
- Risikopräferenzproblem
- Kontrolle des Managements durch externe Marktmechanismen
- Kapitalmarkt
- Primärmärkte
- Sekundärmärkte
- Arbeitsmarkt für Manager
- Institutionelle Investoren und Banken
- Absatz- und Beschaffungsmärkte
- Kapitalmarkt
- Verminderung von Informationsasymmetrien
- Direktive Verhaltenssteuerung - Verhaltenskontrolle
- Anreizsysteme – Ergebniskontrolle
- Senkung von Moral Hazard Gefahren
- Konsum nicht-pekuniärer Vorteile
- Mangelnder Arbeitseinsatz, Risikoaufteilung und Entlohnungsstrukturen
- Stock Options als Anreizmechanismus
- Aufteilung der Überwachungsmethoden des Aufsichtsrats
- Prinzipal Agent Probleme zwischen Aufsichtsrat und Vorstand
- Das Informationsproblem
- Prinzipal Agent Problem zwischen Aufsichtsrat und Anteilseignern
- Adverse Selektion und Moral Hazard
- Kollusionen zwischen Aufsichtsrat und Vorstand
- Lösungsmöglichkeiten
- Monitoring der Aufsichtsratsarbeit
- Bonding durch Anreizinstrumente für den Aufsichtsrat
- Weitere verhaltensdisziplinierende Wirkungen auf den Aufsichtsrat
- Zusammenfassung und Zwischenfazit
- Corporate Governance als Mittel zur Senkung von Agency Kosten
- Struktur und Organisation des Aufsichtsrats
- Unabhängigkeit des Aufsichtsrats
- Abbau von Informationsasymmetrien
- Überwachungskompetenzen des Aufsichtsrats
- Informationsversorgung des Aufsichtsrats
- Monitoring
- Entsprechenserklärung
- Haftungsregelungen
- Bonding durch anreizorientierte Vergütung
- Signaling des Aufsichtsrats
- Signaling des Vorstands
- Einstufige Board Modelle (One-Tier Systeme)
- Optionsmodelle
- Akzeptanz der Deutschen Corporate Governance
- Kritik an deutschen Corporate Governance Strukturen
- Die Institution Aufsichtsrat: empirische Kritik und Würdigung
- Kritik an anglo-amerikanischer Corporate Governance
- Konvergenz oder Wettbewerb der Systeme ?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Rolle des Aufsichtsrats in deutschen Aktiengesellschaften und analysiert die Entwicklung und den Stand der Corporate Governance im Kontext der Prinzipal-Agent-Theorie. Die Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen der Kontrolle des Managements durch den Aufsichtsrat und beleuchtet die Bedeutung von Informationsasymmetrien und Moral Hazard. Darüber hinaus werden verschiedene Ansätze zur Lösung von Agency-Konflikten und die Relevanz des Deutschen Corporate Governance Kodex in diesem Zusammenhang betrachtet.
- Die Entwicklung und der Stand der Corporate Governance in Deutschland
- Die Rolle des Aufsichtsrats in der Kontrolle des Managements
- Die Prinzipal-Agent-Theorie und ihre Anwendung im Kontext der Corporate Governance
- Informationsasymmetrien und Moral Hazard als Herausforderungen der Kontrolle
- Der Deutsche Corporate Governance Kodex und seine Relevanz für den Aufsichtsrat
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel erläutert die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den Aufbau und die Vorgehensweise.
- Im zweiten Kapitel wird das Begriffsverständnis von Corporate Governance beleuchtet. Es werden die Entstehungsgeschichte, die OECD-Grundsätze, der Bezugsrahmen und die Differenzierung zwischen internen und externen Governance-Mechanismen vorgestellt. Darüber hinaus wird die Stakeholder- und Shareholder-Sichtweise auf Corporate Governance diskutiert.
- Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Hintergrund und dem Aufbau der deutschen Aktiengesellschaft. Es werden die Unternehmensverfassung, insbesondere die dualistische Board-Verfassung, die Unternehmensmitbestimmung und die Aufgaben von Vorstand, Hauptversammlung und Aufsichtsrat dargestellt.
- Kapitel vier präsentiert verschiedene institutionenökonomische Ansätze, die für das Verständnis der Corporate Governance relevant sind. Hierzu gehören die Property Rights Theorie, die Transaktionskosten Theorie und die Prinzipal-Agent-Theorie, einschließlich der Problemfelder Adverse Selection und Moral Hazard sowie Lösungsansätzen.
- Im fünften Kapitel werden die Prinzipal-Agent-Probleme zwischen Aktionären und Vorstand untersucht. Es werden die Moral Hazard-Gefahren, die Kontrolle des Managements durch externe Marktmechanismen und verschiedene Lösungsansätze beleuchtet.
- Kapitel sechs widmet sich der Institution Aufsichtsrat und den Möglichkeiten zur Lösung von Agency-Konflikten. Es werden Ansätze zur Verminderung von Informationsasymmetrien und Senkung von Moral Hazard-Gefahren vorgestellt, sowie die Aufteilung der Überwachungsmethoden des Aufsichtsrats analysiert.
- Kapitel sieben befasst sich mit den mehrstufigen Agency-Konflikten in Aktiengesellschaften, insbesondere mit den Problemen zwischen Aufsichtsrat und Vorstand sowie Aufsichtsrat und Anteilseignern. Es werden Lösungsansätze für diese Konflikte erörtert, wie z.B. Monitoring und Bonding.
- Das achte Kapitel analysiert die Rolle des Aufsichtsrats im Deutschen Corporate Governance Kodex. Es werden die Struktur und Organisation des Aufsichtsrats, die Unabhängigkeit, der Abbau von Informationsasymmetrien, das Monitoring, das Bonding durch Anreizinstrumente und das Signaling betrachtet.
- Kapitel neun gibt einen Einblick in die internationale Corporate Governance. Es werden einstufige Board-Modelle (One-Tier Systeme) und Optionsmodelle vorgestellt.
- Im zehnten Kapitel werden dualistische und monistische Corporate Governance-Strukturen miteinander verglichen. Es werden die Akzeptanz der Deutschen Corporate Governance, die Kritik an deutschen Corporate Governance-Strukturen, insbesondere die Institution Aufsichtsrat, sowie die Kritik an anglo-amerikanischer Corporate Governance diskutiert. Zum Abschluss wird die Frage nach Konvergenz oder Wettbewerb der Systeme erörtert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themengebieten Corporate Governance, Aufsichtsrat, Prinzipal-Agent-Theorie, Informationsasymmetrien, Moral Hazard, Agency-Konflikte, Deutscher Corporate Governance Kodex, Stakeholder-Sichtweise, Shareholder-Sichtweise, dualistische Board-Verfassung, Unternehmensmitbestimmung und internationale Corporate Governance.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle hat der Aufsichtsrat in einer Aktiengesellschaft?
Der Aufsichtsrat fungiert als Kontrollorgan, das den Vorstand überwacht und berät, um die Interessen der Aktionäre zu wahren und Fehlentwicklungen vorzubeugen.
Was ist das Prinzipal-Agent-Problem in der Corporate Governance?
Es beschreibt den Interessenkonflikt zwischen Eigentümern (Aktionären) und Management (Vorstand), der durch Informationsasymmetrien und unterschiedliche Risikopräferenzen entsteht.
Wie bekämpft der Corporate Governance Kodex Korruption?
Durch Richtlinien für Transparenz, Unabhängigkeit der Aufsichtsräte und klare Haftungsregelungen sollen Kontrollmechanismen gestärkt und Skandale wie bei Siemens oder Enron verhindert werden.
Was bedeutet die dualistische Board-Verfassung in Deutschland?
Sie sieht eine strikte Trennung zwischen dem Leitungsorgan (Vorstand) und dem Überwachungsorgan (Aufsichtsrat) vor, im Gegensatz zum einstufigen System in den USA.
Können Stock Options Agency-Konflikte lösen?
Aktienoptionen sollen die Interessen des Vorstands an die der Aktionäre koppeln, bergen aber auch das Risiko kurzfristiger Gewinnmaximierung zulasten der langfristigen Stabilität.
- Citation du texte
- Frank Kranenfeld (Auteur), 2007, Kontrolle durch den Aufsichtsrat in deutschen Aktiengesellschaften , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84978