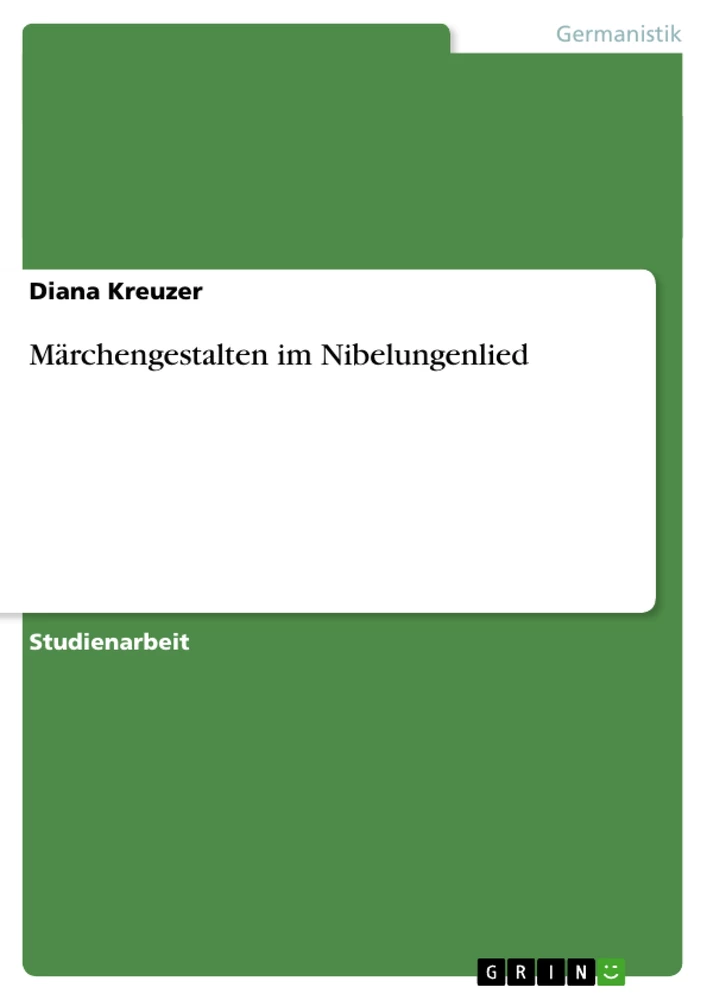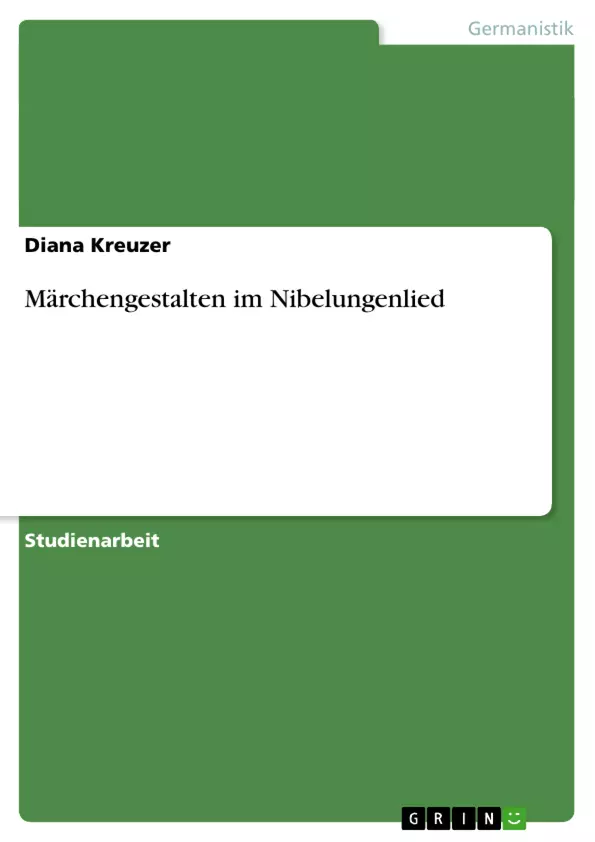Das Nibelungenlied als unser kulturelles Erbe und unser literarisch-historisches Gut regt Wissenschaftler schon seit Jahrhunderten zu Forschungen an und gehört mit Sicherheit zu den meist untersuchten Werken der Literatur. Es gibt viele verschiedene Aspekte, Richtungen und Probleme, die in der Forschung reflektiert worden sind – von der Geschichte der Entstehung und Überlieferung bis ins Detail gehenden Personenanalysen.
Die Fragestellung, auf die unter anderem in dieser Arbeit eingegangen wird, befasst sich mit dem Verhältnis zwischen dem Sagenhaften und Märchenhaften (und Mythischen) im Nibelungenlied. Um klarer das Ziel der vorliegenden Arbeit vorzustellen, benötigen wir eine Abgrenzung von den Begriffen, die in einem engen Zusammenhang zueinander stehen: Mythos, Sage, Märchen und Märchenmotiv. Es ist kompliziert, eine einheitliche Definition zu finden, weil die Grenzen zwischen Mythos, Sage und Märchen fließend sind und die Meinungen von den Forschern teilweise auseinander gehen. In meiner Arbeit habe ich mich bei den Begriffsdefinitionen grundsätzlich an H. Naumann und F. Panzer orientiert, weil die Sichtweise von beiden Wissenschaftler mir nahe liegt.
Mythos und Heldensage sind zeitlich bedingte und wieder vorübergegangene höhere Stilformen von Märchen und Sage; ihre Bausteine sind die gleichen: die primitiven Motive, die aus dem Erzählungsgut der primitiven Gemeinschaft geschöpft sind. Für Zeiten, aus denen uns Märchen und Sage nicht überliefert sind, erschließen wir sie [Motive] also aus Mythos und Heldensage, z. B. aus Edda, aus Bibel und aus Homer und Ovid (vgl.: Naumann, 1922:63).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Märchengestalten im Nibelungenlied
- 2.1 Drache
- 2.1.1 Drache als Motiv im Volksglauben und in der Literatur
- 2.1.2 Drache im Nibelungenlied
- 2.2 Zwerge
- 2.2.1 Zwerge als Motiv im Volksglauben und in der Literatur
- 2.2.2 Zwerg Alberich im Nibelungenlied
- 2.3 Riesen
- 2.3.1 Riesen als Motiv im Volksglauben und in der Literatur
- 2.3.2 Riesen im Nibelungenlied
- 2.4 Meerfrauen
- 2.4.1 Meerfrauen als Motiv im Volksglauben und in der Literatur
- 2.4.2 Meerfrauen im Nibelungenlied
- 2.1 Drache
- 3. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Analyse märchenhafter Gestalten im Nibelungenlied und untersucht deren Rolle im Kontext von Volksglauben und Literatur. Sie zielt darauf ab, die Verbindung von Sagenhaftem und Märchenhaftem in dem Werk aufzuzeigen und die Bedeutung dieser Figuren für die Handlung zu beleuchten.
- Märchenhafte Wesen und deren Präsenz im Nibelungenlied
- Vergleich von Märchenmotiven im Volksglauben und in der Literatur
- Bedeutung von mythischen Gestalten für die Handlung des Nibelungenliedes
- Untersuchung der Verbindung von Wirklichkeit und Irrealität in der Darstellung der Figuren
- Analyse der Rolle von „wunderbaren Gegenständen“ in der Handlung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit der Einordnung des Nibelungenliedes in den Forschungsbereich und führt die Begriffsdefinitionen von Mythos, Sage, Märchen und Märchenmotiv ein. Sie erläutert die Notwendigkeit, diese Begriffe zu differenzieren, um das Ziel der Arbeit klarzustellen.
Kapitel 2 widmet sich der detaillierten Analyse von verschiedenen Märchengestalten im Nibelungenlied. Es werden jeweils die Drachen, Zwerge, Riesen und Meerfrauen im Kontext von Volksglauben und Literatur betrachtet, um ihre Rolle im Nibelungenlied zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen wie Märchenmotiv, Sagenhaft, Mythisch, Nibelungenlied, Volksglauben, Drachen, Zwerge, Riesen, Meerfrauen, Handlung, Literatur, Wirklichkeit, Irrealität, Wunderbarer Gegenstand.
Häufig gestellte Fragen
Welche Märchengestalten kommen im Nibelungenlied vor?
Im Epos treten unter anderem Drachen, Zwerge (wie Alberich), Riesen und Meerfrauen (Nixen) auf.
Wie wird der Drache im Nibelungenlied dargestellt?
Der Drache ist das zentrale Motiv für Siegfrieds Unverwundbarkeit und seinen Heldenstatus, wobei die Arbeit den Drachen als Motiv im Volksglauben und in der Literatur vergleicht.
Welche Rolle spielt der Zwerg Alberich?
Alberich ist der Hüter des Nibelungenhortes und Besitzer der Tarnkappe. Er repräsentiert das Motiv des übernatürlichen Helfers oder Widersachers.
Was ist die Funktion der Meerfrauen in der Handlung?
Die Meerfrauen begegnen den Burgundern an der Donau und fungieren als Seherinnen, die den Untergang der Helden voraussagen.
Wie unterscheiden sich Mythos, Sage und Märchen im Text?
Die Grenzen sind fließend; die Arbeit nutzt Definitionen von Forschern wie Naumann und Panzer, um die Bausteine dieser Erzählformen im Nibelungenlied abzugrenzen.
- Quote paper
- Magistra Artium Diana Kreuzer (Author), 2006, Märchengestalten im Nibelungenlied, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84996