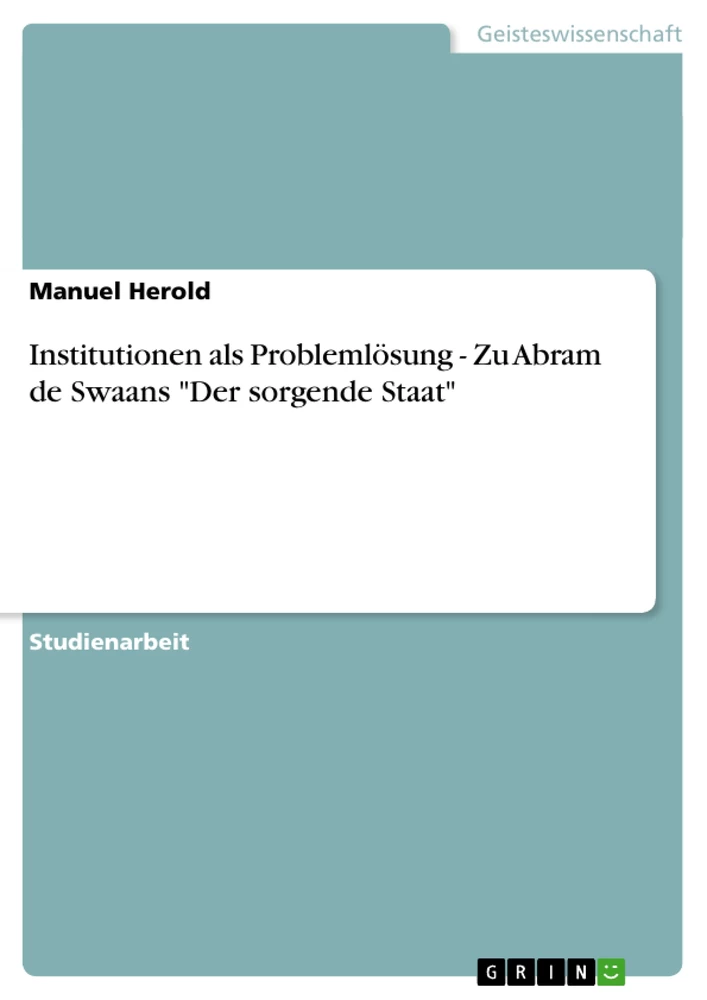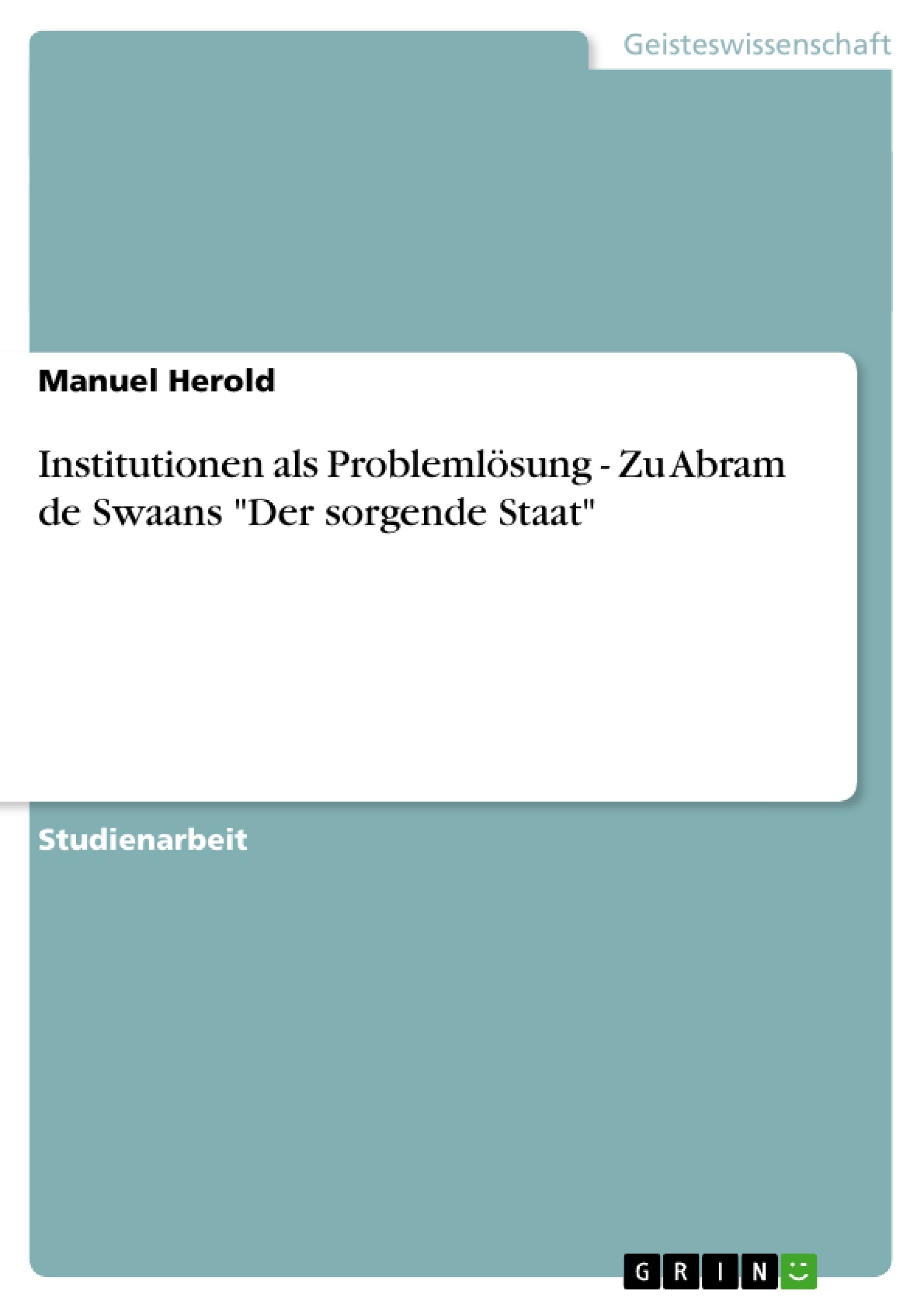Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Institutionen als Problemlösung und dabei mit den Erklärungsansätzen von Abram de Swaan in seinem Werk „Der sorgende Staat“. De Swaan untersucht die Kollektivierung im Gesundheits-, Bildungs- und Fürsorgewesen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und den USA in einem historischen Vergleich, den er mit der Theorie kollektiven Handelns verbindet. Um die Gründe für die Etablierung kollektiver und landesweite Einrichtungen gegen Risiken und Defizite zu erläutern, werden die die Ansätze der Wohlfahrtsökonomik (externe Effekte), sowie der Soziologie von Norbert Elias (Interdependenzketten) herangezogen. Dabei spielt ein Muster voneinander abhängiger Menschen eine zentrale Rolle (Figuration). Mit der Wohlfahrtsöko-nomik analysiert De Swaan komplexe Konstellationen von Interdependenzen und mit der historischen Soziologie den Einfluss externer Effekte auf die gesellschaftliche Entwicklung. Die Interdependenz zwischen Bürgern durch Staatenbildung, Kapitalismus, Urbanisierung und Säkularisation führte zu neuen externen Effekten durch individuelle Risiken und Defizite. Im Kollektivierungsprozess spielen die Interdependenzen zwischen Armen und Reichen eine zentrale Rolle. Die Armen stellten für reichere Bevölkerungsteile sowohl Gefahren als auch Chancen dar, weshalb Wohlhabende durch die externen Effekte der Armut kollektiv betroffen waren. De Swaan zeigt das Dilemma der Wohlfahrtsökonomik, wonach jede gemeinsame Anstrengung der Reichen gegen die Folgen der Armut auch den Menschen nutzte, die nichts dazu beigetragen hatten.
Er zeigt drei Hauptaspekte der Kollektivierung von Fürsorgemaßnahmen auf wonach die Maßnahmen im Lauf der Zeit ganze Nationen in ihr Spektrum einschlossen oder bestimmte Gruppen abgrenzten. Daneben wurden die Maßnahmen immer kollektiver und vom Staat oder öffentlichen Anstalten getragen. Der Staat erreichte so genügend Autorität um sich den Verwaltungsapparat zu schaffen. Für die Durchsetzung kollektiver Zwangsvorkehrungen definiert De Swaan Bedingungen, die diese Maßnahmen beschleunigen: Zum einen die Ungewissheit über den Zeitpunkt und das Ausmaß der Notlage, die Ungewissheit über die Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen, sowie die Ungewissheit über das Ausmaß und die Reichweite externer Effekte für nicht Betroffene.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Institutionen kommunaler Fürsorge
- Das Problem des kollektiven Handelns
- Der Wechsel von der kommunalen Fürsorge zu einem regionalen Gleichgewicht
- Ein Spielmodell mit 2 Personen
- Die Institution des Arbeitshauses und die Rolle zentraler Behörden
- Der Einfluss des Arbeitshauses im Spielmodell
- Institutionen der Bildung und Kommunikation
- Die Blütenfiguration von Kommunikationsnetzen
- Eine statistische Betrachtung der Kommunikationspotentiale
- Die Rolle des Klerus und des Landadels im Erziehungswesen
- Die Institutionen zur Massenerziehung in den untersuchten Ländern
- Institutionen im Gesundheitswesen
- Die Cholera als Beispiel für Interdependenz
- Die stadtweite Ausdehnung der kollektiven Einrichtungen
- Institutionen zur Vorsorge: Arbeiterhilfsvereine und die Sozialversicherung
- Der Wechsel von den Hilfsvereine zur staatlichen Sozialversicherung
- Die Akkumulation von Transferkapital in einer vierseitigen Figuration
- Die Zwangsakkumulation
- Risiken des Erwerbslebens
- Die Entstehung der Sozialversicherung in den untersuchten Ländern
- Die Kollektivierung nach 1945
- Die Entwicklung der Mittelschicht, Expertenregimes und der Zivilisation
- Die Rolle der Ärzteschaft
- Kollektivierung und Zivilisation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Entstehung und Entwicklung kollektiver Institutionen im Gesundheits-, Bildungs- und Fürsorgewesen in verschiedenen europäischen Ländern und den USA. Die Arbeit nutzt die Theorien von Abram de Swaan, der die Kollektivierung als Antwort auf das Problem des kollektiven Handelns betrachtet. Dabei wird die Interdependenz zwischen Menschen und die Folgen von externen Effekten auf die gesellschaftliche Entwicklung untersucht.
- Die Rolle von Institutionen als Problemlösungen für gesellschaftliche Herausforderungen
- Die Entstehung und Entwicklung von kollektiven Institutionen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen
- Die Bedeutung der Interdependenz und externen Effekte in der gesellschaftlichen Entwicklung
- Der Einfluss von Wohlfahrtsökonomik und historischer Soziologie auf die Analyse von kollektiven Institutionen
- Die Rolle des Staates und der staatlichen Autorität bei der Etablierung und Durchsetzung kollektiver Maßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die zentralen Thesen und Forschungsmethoden vor. Kapitel 2 befasst sich mit den Institutionen der kommunalen Fürsorge und analysiert das Problem des kollektiven Handelns im Kontext von Armut und sozialer Ungleichheit. Kapitel 3 beleuchtet die Entwicklung von Bildungseinrichtungen und Kommunikationsnetzen, während Kapitel 4 die Entstehung und Ausbreitung von Einrichtungen im Gesundheitswesen analysiert. Kapitel 5 befasst sich mit der Entwicklung von Arbeiterhilfsvereinen und der Sozialversicherung als Institutionen zur Vorsorge gegen Risiken des Erwerbslebens.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der Kollektivierung, der Interdependenz, externen Effekten, Institutionen, Wohlfahrtsökonomik, historischer Soziologie, Fürsorge, Bildung, Gesundheitswesen, Sozialversicherung, Armut, Ungleichheit, Zivilisation, Expertenregimes und dem Problem des kollektiven Handelns. Dabei werden insbesondere die Werke von Abram de Swaan und Norbert Elias herangezogen.
Häufig gestellte Fragen
Wie erklärt Abram de Swaan die Entstehung des Wohlfahrtsstaates?
De Swaan sieht den Wohlfahrtsstaat als Ergebnis eines Kollektivierungsprozesses, der als Lösung für Probleme des kollektiven Handelns bei der Bewältigung gesellschaftlicher Risiken entstand.
Was bedeutet „Interdependenz“ in de Swaans Theorie?
Interdependenz beschreibt die gegenseitige Abhängigkeit der Menschen (z. B. zwischen Armen und Reichen), die durch Urbanisierung und Kapitalismus so stark wurde, dass individuelle Risiken zu kollektiven Problemen wurden.
Warum beteiligten sich die Reichen an der Armenpflege?
Armut erzeugte „externe Effekte“ wie Krankheiten (z. B. Cholera) oder soziale Unruhen, von denen auch die Wohlhabenden direkt betroffen waren, was kollektives Handeln notwendig machte.
Welche Rolle spielt die Bildung im Kollektivierungsprozess?
Bildung wurde durch die Staatenbildung und neue Kommunikationsnetze zu einer kollektiven Aufgabe, um nationale Identität und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu sichern.
Was ist das „Problem des kollektiven Handelns“?
Es beschreibt das Dilemma, dass gemeinsame Anstrengungen oft scheitern, weil Einzelne von den Ergebnissen profitieren können, ohne selbst einen Beitrag zu leisten (Trittbrettfahrer-Problem).
Wie beeinflusste die Cholera die Entwicklung des Gesundheitswesens?
Die Cholera verdeutlichte die räumliche Interdependenz: Da Krankheiten nicht an Klassengrenzen haltmachen, mussten stadtweite, kollektive sanitäre Einrichtungen geschaffen werden.
- Citar trabajo
- Manuel Herold (Autor), 2006, Institutionen als Problemlösung - Zu Abram de Swaans "Der sorgende Staat", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85038