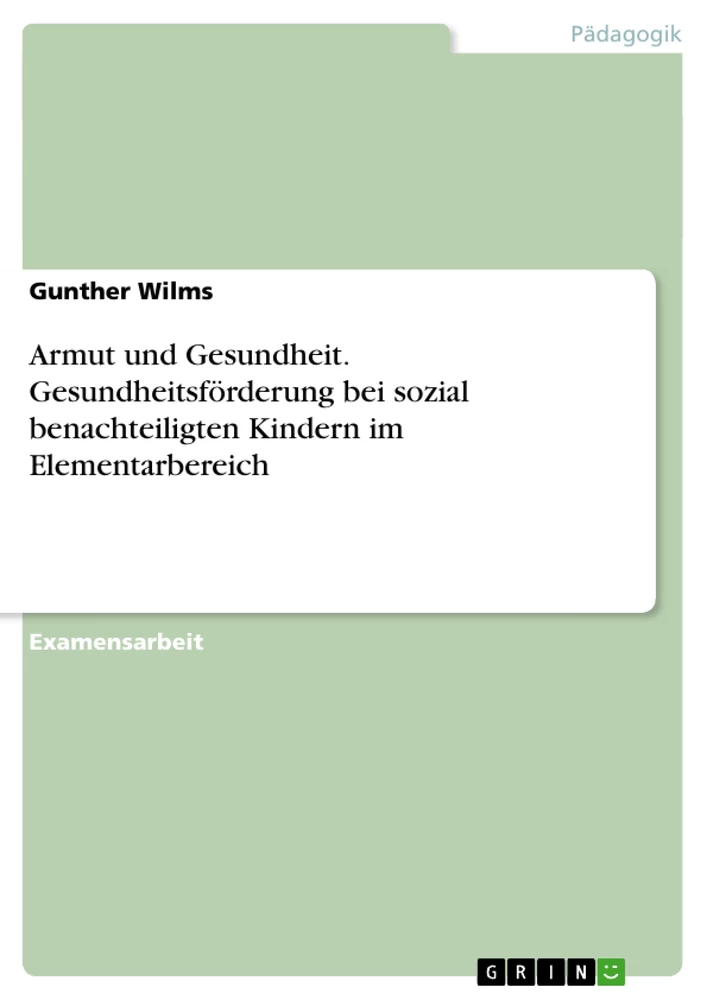Derzeit wächst eine erhebliche Zahl von Kindern in sozialer Benachteiligung und in Einkommensarmut auf. So betrug im Jahr 2003 bei Kindern unter 16 Jahren das Risiko für Einkommensarmut 15 Prozent. Folglich war 2003 fast jedes siebte Kind unter 16 Jahren von Einkommensarmut bedroht. Zudem waren 1,1 Millionen Kinder unter 18 Jahren auf Sozialhilfe angewiesen. Damit bildeten sie unter den Sozialhilfebezieher/-innen die mit Abstand größte Gruppe. Einkommensarmut und soziale Benachteiligung stellen – wie im Laufe dieser Arbeit analysiert wird – Risiken für die Gesundheit des Einzelnen dar und insbesondere in der frühen Kindheit sozial benachteiligter und armer Kinder können gesundheitsgefährdende Lebensweisen entstehen und sich stabilisieren. Infolgedessen sind bei Kindern aus sozial benachteiligten Familien frühzeitige Interventionen durch Gesundheitsförderung dringend erforderlich.
Der Kindertagesstätte kommt für die Bildung und Erziehung von Kindern eine besondere
Bedeutung zu. So stellt Renate Zimmer fest, dass heute an keine Bildungsinstitution so hohe und so unterschiedliche Erwartungen gestellt werden wie an die Kindertagesstätte:
Ein Ort des Ausgleichs sozialer Benachteiligung solle sie sein, der allseitigen Förderung
der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, der Integration sinnlicher Erfahrungen und der Ergänzung elterlicher Erziehung. Tatsächlich bietet die Kindertagesstätte, in der Kinder aus allen sozialen Schichten vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt gebildet und erzogen werden, die Chance, frühzeitige und altersgerechte Maßnahmen der Gesundheitsförderung und damit eine Stärkung der Gesundheitsressourcen zu realisieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 GRUNDLEGENDE ASPEKTE DER GESUNDHEITSFÖRDERUNG BEI SOZIAL BENACHTEILIGTEN KINDERN
- 2.1 Gesundheit als Prozess
- 2.2 Gesundheitsförderung und Prävention
- 2.2.1 Prävention
- 2.2.2 Gesundheitsförderung
- 2.2.3 Unterscheidung von Gesundheitsförderung und Prävention
- 2.3 Historische Entwicklung der Gesundheitsförderung
- 2.4 Das Salutogenesemodell von Aaron Antonovsky
- 2.4.1 Gesundheits-Krankheits-Kontinuum
- 2.4.2 Kohärenzgefühl
- 2.4.3 Relevanz des Salutogenesemodells für die Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten Kindern
- 2.5 Setting und Setting-Ansatz
- 2.5.1 Setting
- 2.5.2 Setting-Ansatz
- 2.6 Soziale Ungleichheit und Armut
- 2.6.1 Soziale Ungleichheit
- 2.6.2 Absolute Armut und relative Armut
- 2.6.2.1 Absolute Armut
- 2.6.2.2 Relative Armut
- 2.6.2.3 Relative Armut von Familien und Kindern in Deutschland
- 2.6.2.4 Kumulative Armut
- 3 BEDINGUNGSFELDER DER GESUNDHEITSFÖRDERUNG BEI SOZIAL BENACHTEILIGTEN KINDERN IM ELEMENTARBEREICH
- 3.1 Konnexes zwischen sozialer Ungleichheit und gesundheitlicher Ungleichheit
- 3.1.1 Soziale Ungleichheit – Ausgangspunkt gesundheitlicher Ungleichheit von Kindern
- 3.1.2 Unterschiede in den gesundheitlichen Belastungen
- 3.1.3 Unterschiede in den Bewältigungsressourcen
- 3.1.4 Unterschiede in der gesundheitlichen Versorgung
- 3.1.5 Unterschiede im Gesundheits- und Krankheitsverhalten bzw. im Lebensstil
- 3.1.6 Gesundheitliche Ungleichheit
- 3.1.7 Kindliche Entwicklung zwischen Wohlergehen und multipler Deprivation
- 3.1.8 Bewältigung von sozialer Ungleichheit und gesundheitlicher Ungleichheit
- 3.2 Kognitive Voraussetzungen des Vorschulkindes
- 3.2.1 Selbstbildung und Eigenaktivität
- 3.2.2 Der Egozentrismus des Kindes nach Jean Piaget
- 3.2.3 Widerlegungen und Relativierungen von Piagets Auffassungen hinsichtlich des kindlichen Egozentrismus'
- 3.3 Das gesundheitsfördernde Setting Kindertagesstätte
- 3.3.1 Stärken und Chancen des Settings Kindertagesstätte
- 3.3.2 Schwächen und Nachteile des Settings Kindertagesstätte
- 4 MABNAHMEN DER GESUNDHEITSFÖRDERUNG BEI SOZIAL BENACHTEILIGTEN KINDERN IM SETTING KINDERTAGESSTÄTTE
- 4.1 Zieldimensionen und Themenfelder
- 4.2 Interventionsdimensionen der Gesundheitsförderung
- 4.2.1 Interventionen laut des Gesundheits-Krankheits-Kontinuums
- 4.2.2 Verhaltensorientierte und verhältnisorientierte Gesundheitsförderung
- 4.3 Intersektoralität und Kooperation
- 4.3.1 Kooperationspartner der Kindertagesstätte
- 4.3.2 Erziehungspartnerschaft zwischen Kindertagesstätte und Eltern
- 4.4 Gesundheitsförderung im vorschulkindlichen Spiel und durch Modelllernen
- 4.4.1 Das vorschulkindliche Spiel
- 4.4.2 Das Lernen am Modell nach Albert Bandura
- 4.4.2.1 Aufmerksamkeitsprozesse
- 4.4.2.2 Behaltensprozesse
- 4.4.2.3 Motorische Reproduktionsprozesse
- 4.4.2.4 Motivationale Prozesse
- 4.4.3 Ausblick
- 4.5 Maßnahmen in ausgewählten Bereichen
- 4.5.1 Ernährung
- 4.5.2 Bewegung
- 4.5.3 Zahnpflege
- 4.5.4 Weitere Bereiche
- Das Konzept der Gesundheitsförderung und seine Bedeutung für sozial benachteiligte Kinder
- Die Folgen sozialer Ungleichheit und Armut für die Gesundheit von Kindern
- Die Rolle der Kindertagesstätte als gesundheitsförderndes Setting
- Mögliche Maßnahmen und Interventionen zur Gesundheitsförderung im Elementarbereich
- Die Bedeutung von Intersektoralität und Kooperation im Bereich der Gesundheitsförderung
- Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Relevanz der Thematik vor dem Hintergrund wachsender Kinderarmut in Deutschland dar.
- Kapitel 2 beleuchtet grundlegende Aspekte der Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten Kindern. Es werden wichtige Konzepte wie das Salutogenesemodell, der Setting-Ansatz und die Zusammenhänge zwischen sozialer Ungleichheit und Armut vorgestellt.
- Kapitel 3 analysiert die Bedingungsfelder der Gesundheitsförderung im Elementarbereich. Es werden die Auswirkungen von sozialer Ungleichheit auf die gesundheitliche Entwicklung von Kindern und die spezifischen Herausforderungen des Settings Kindertagesstätte beleuchtet.
- Kapitel 4 befasst sich mit Maßnahmen der Gesundheitsförderung im Setting der Kindertagesstätte. Es werden verschiedene Interventionen, Themenfelder und Kooperationspartner für die praktische Umsetzung der Gesundheitsförderung vorgestellt.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten Kindern im Elementarbereich. Das Hauptziel der Arbeit ist es, die Zusammenhänge zwischen Armut und Gesundheit aufzuzeigen und konkrete Ansätze zur Gesundheitsförderung im Setting der Kindertagesstätte zu entwickeln.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Gesundheitsförderung, soziale Benachteiligung, Armut, Kinder, Elementarbereich, Kindertagesstätte, Setting-Ansatz, Salutogenesemodell, Intersektoralität, Kooperation, Ernährung, Bewegung, Zahnpflege.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Armut und Gesundheit bei Kindern zusammen?
Kinder in Armut haben ein höheres Risiko für gesundheitsgefährdende Lebensweisen und geringere Bewältigungsressourcen, was zu gesundheitlicher Ungleichheit führt.
Was ist das Salutogenesemodell von Aaron Antonovsky?
Es ist ein Modell, das Gesundheit als Prozess betrachtet und das „Kohärenzgefühl“ als zentrale Ressource zur Bewältigung von Belastungen in den Mittelpunkt stellt.
Warum ist die Kita ein wichtiges „Setting“ für Gesundheitsförderung?
Die Kita erreicht Kinder aus allen sozialen Schichten frühzeitig und bietet die Chance, altersgerechte Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheitsressourcen umzusetzen.
Welche Bereiche umfasst die Gesundheitsförderung im Elementarbereich?
Wichtige Themenfelder sind eine gesunde Ernährung, ausreichende Bewegung, Zahnpflege sowie die Stärkung sozial-emotionaler Kompetenzen.
Was bedeutet „Intersektoralität“ in diesem Kontext?
Es beschreibt die notwendige Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren wie Kitas, Eltern, Gesundheitsämtern und anderen sozialen Diensten zur Förderung der Kindergesundheit.
- Quote paper
- Gunther Wilms (Author), 2007, Armut und Gesundheit. Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten Kindern im Elementarbereich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85163