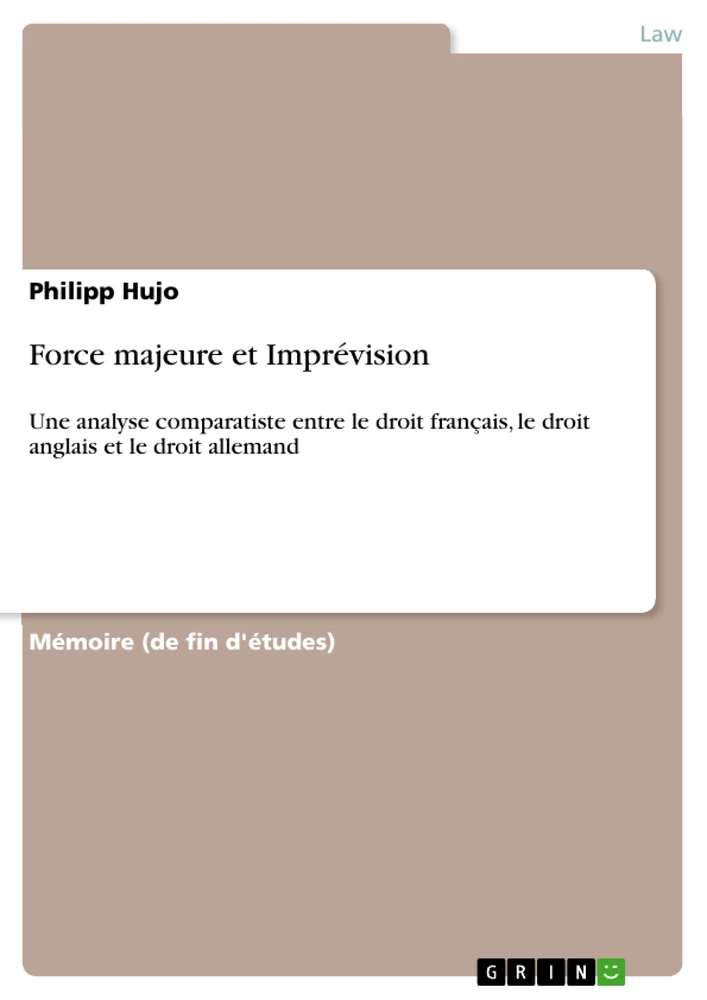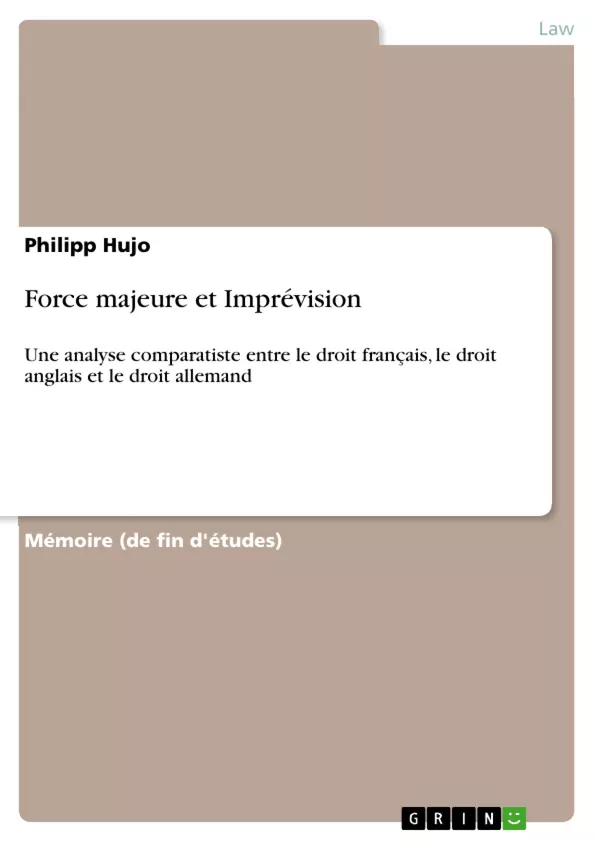Die Behandlung der Fälle der Leistungserschwernis, die im deutschen Recht unter den Stichworten „Wegfall der Geschäftsgrundlage“ und „Unmöglichkeit“, im englischen Recht unter dem Titel „Frustration“, aber auch „Hardship“ und schließlich im französischen Recht unter dem Titel „Impossibilité“ und „Imprévision“ diskutiert werden, zeigt uns vergleichsweise anschaulich und eindringlich die unterschiedlichen juristischen Lösungen eines häufigen und aufgrund seiner wirtschaftlichen Bedeutung auch sehr praxisrelevanten Problems auf. Die rechtsvergleichende Würdigung des behandelten Themas konnte sich nur aus einer intensiven und ausführlichen Darstellung der historischen Entwicklung der einzelnen Rechtsinstitute ergeben. Methodisch hat sich der Autor deshalb dafür entschieden, das Fallrecht (und zwar nicht nur das für das englische Recht typische Case-Law) stark und ausführlich einzubeziehen und darzustellen. Entsprechend dem „Case-Law approach“ von Basil Markesinis ermöglicht dies dem Leser sich schneller in das ihm (noch) fremde Recht hineinzuarbeiten. Erst and der höchstrichterlichen Rechtssprechung zeigt sich die tatsächliche Handhabe eines Rechtsproblems, welches sich durch eine Normexegese wohl nicht erschließen lässt, abgesehen einmal von der Heranziehung der Motive des Gesetzgebers. Der von Markesinis beschriebene „factual approach“ erlaubt somit ein gewisses „Hineinversetzen“ in die fremde Rechtsordnung. Neben die Jurisprudenz tritt die Darstellung derjenigen Normen, die sich mit diesem Problemkreis befassen. Interessant ist in diesem Zusammenhang das französische Reformprojekt „Catala“, benannt nach dem französischen Professor Pierre Catala, der das Projekt dem französischen Justizminister vorgestellt hat. Schließlich soll ein kurzer Blick auf die transnationalen Projekte und Vorschläge geworfen werden. In diesem Sammelsurium von Vorschlägen, die von verschiedenen Institutionen, wie etwa der Lando-Kommission, dem Unidroit-Institut, den PECL aber auch auf Ebene des UN-Kaufrechts (CISG) entworfen wurden, finden sich viele brauchbare Ansätze, die letztlich auf die Ideen der untersuchten Rechtsordnungen zurückgehen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Le droit français
- I. De l'impossibilité par force majeure
- II. au problème de l'imprévision dans les contrats
- 1. L'arrêt de principe Canal de Craponne
- 2. Les critiques
- 3. L'Avant-projet Catala
- 4. Clauses contractuelles
- B. Le droit anglais
- I. << Doctrine of Frustration >>
- 1. Définition
- 2. Doctrine des contrats absolus Paradine v. Jane
- 3. L'introduction de la doctrine Frustration après Taylor v Caldwell
- 5. Champ d'application
- 6. Théories de justification
- 7. Solutions alternatives:
- C. Le droit allemand
- I. De l'impossibilité de la prestation ...
- II. à la << Störung oder Wegfall der Geschäftsgrundlage >>
- 1. Wegfall der Geschäftsgrundlage
- 2. L'introduction de l'article § 313 BGB
- 3. Le développement: La jurisprudence
- 4. Point de vue comparatiste
- D. Principes du droit européen du contrat
- E. Le droit du commerce international
- I. Principes d'UNIDROITS
- II. L'Avant-projet du Code Européen des Contrats (« Gandolfi-Code >>)
- III. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
- F. Remarques conclusives
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, die Konzepte von Force Majeure und Imprévision im französischen, englischen und deutschen Recht vergleichend zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der jeweiligen Rechtsgrundlagen, der Rechtsprechung und der praktischen Anwendung dieser Konzepte im Vertragsrecht. Die Arbeit untersucht, wie diese Konzepte mit unvorhergesehenen Ereignissen und deren Auswirkungen auf vertragliche Verpflichtungen umgehen.
- Vergleichende Analyse von Force Majeure und Imprévision
- Untersuchung der Rechtsgrundlagen in Frankreich, England und Deutschland
- Analyse der Rechtsprechung und der praktischen Anwendung
- Auswirkungen unvorhergesehener Ereignisse auf vertragliche Verpflichtungen
- Suche nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Rechtssystemen
Zusammenfassung der Kapitel
A. Le droit français: Dieses Kapitel befasst sich mit dem französischen Recht und analysiert das Konzept der Unmöglichkeit aufgrund höherer Gewalt (Force Majeure) und das Problem der Imprévision in Verträgen. Es untersucht den wegweisenden Rechtsfall "Canal de Craponne", die darauf folgende Kritik und den Versuch einer gesetzlichen Regelung im Avant-projet Catala. Zusätzlich werden die Bedeutung und die Ausgestaltung vertraglicher Klauseln im Kontext von Force Majeure und Imprévision beleuchtet. Das Kapitel bietet eine umfassende Übersicht über die französische Rechtslage und die verschiedenen Ansätze zur Bewältigung unvorhergesehener Ereignisse in Vertragsverhältnissen.
B. Le droit anglais: Dieses Kapitel befasst sich mit der englischen Rechtslage zum Thema Force Majeure und Imprévision, wobei der Fokus auf der "Doctrine of Frustration" liegt. Es definiert den Begriff und untersucht dessen historische Entwicklung, beginnend mit der Doktrin der absoluten Verträge in Paradine v. Jane bis hin zur Einführung der Frustrationslehre nach Taylor v. Caldwell. Das Kapitel analysiert verschiedene Anwendungsfälle der Frustrationslehre, einschließlich des Untergangs des Vertragsgegenstandes, des Ausbleibens eines zugrundeliegenden Ereignisses und des Gesetzeswandels. Schließlich werden alternative Lösungen wie die präventive Vertragsgestaltung und Klauseln zur Risikominderung diskutiert.
C. Le droit allemand: Dieses Kapitel widmet sich dem deutschen Recht und untersucht die Konzepte der Unmöglichkeit der Leistung und der Störung oder des Wegfalls der Geschäftsgrundlage. Es analysiert die Entwicklung der Rechtsprechung im Kontext von § 313 BGB und stellt einen vergleichenden Überblick zu den französischen und englischen Ansätzen dar. Die Diskussion beinhaltet eine tiefgehende Analyse der Rechtsprechung und der praktischen Implikationen dieser Konzepte für vertragliche Beziehungen. Die Entwicklung und Anwendung dieser Rechtsprinzipien wird im Detail untersucht und im europäischen Kontext eingeordnet.
D. Principes du droit européen du contrat: Dieses Kapitel wird die europäischen Prinzipien des Vertragsrechts untersuchen, die für Force Majeure und Imprévision relevant sind. Es wird auf harmonisierende Bestrebungen im europäischen Vertragsrecht eingehen und deren Einfluss auf die nationalen Rechtsordnungen analysieren. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, inwieweit europäische Rechtsprinzipien die nationalen Regelungen zur Force Majeure und Imprévision beeinflussen oder vereinheitlichen.
E. Le droit du commerce international: Dieses Kapitel behandelt die Regeln des internationalen Handelsrechts bezüglich Force Majeure und Imprévision. Es wird die UN-Kaufrechtskonvention (CISG) sowie die Prinzipien von UNIDROIT und den Entwurf eines europäischen Vertragsrechtskodex ("Gandolfi-Code") analysieren und deren jeweilige Regelungen im Vergleich zu den nationalen Rechtsordnungen betrachten. Der Schwerpunkt liegt auf der internationalen Harmonisierung und dem Umgang mit grenzüberschreitenden Vertragsstreitigkeiten in Bezug auf unvorhergesehene Ereignisse.
Schlüsselwörter
Force Majeure, Imprévision, Vertragsrecht, französisches Recht, englisches Recht, deutsches Recht, Rechtsvergleichung, Unmöglichkeit der Leistung, Störung der Geschäftsgrundlage, UN-Kaufrechtskonvention (CISG), europäisches Vertragsrecht, Vertragsklauseln, Rechtsprechung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleichende Analyse von Force Majeure und Imprévision
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert vergleichend die Konzepte von Force Majeure und Imprévision im französischen, englischen und deutschen Recht. Der Fokus liegt auf den Rechtsgrundlagen, der Rechtsprechung und der praktischen Anwendung dieser Konzepte im Vertragsrecht, insbesondere im Umgang mit unvorhergesehenen Ereignissen und deren Auswirkungen auf vertragliche Verpflichtungen.
Welche Rechtsordnungen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht das französische, englische und deutsche Recht im Hinblick auf Force Majeure und Imprévision. Zusätzlich werden Prinzipien des europäischen Vertragsrechts und des internationalen Handelsrechts (inkl. UN-Kaufrechtskonvention) betrachtet.
Was sind die zentralen Themen der Analyse?
Die zentralen Themen sind der Vergleich von Force Majeure und Imprévision, die Untersuchung der jeweiligen Rechtsgrundlagen, die Analyse der Rechtsprechung und deren praktische Anwendung, die Auswirkungen unvorhergesehener Ereignisse auf Verträge und die Suche nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Rechtssystemen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert, die sich jeweils mit einem Rechtssystem oder einem Aspekt des Themas befassen: Französisches Recht (inkl. Canal de Craponne und Avant-projet Catala), Englisches Recht (inkl. Doctrine of Frustration und Taylor v. Caldwell), Deutsches Recht (inkl. § 313 BGB), Europäisches Vertragsrecht und Internationales Handelsrecht (inkl. UNIDROIT-Prinzipien, CISG und Gandolfi-Code). Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung und Analyse der relevanten Rechtsgrundlagen und Rechtsprechung.
Welche konkreten Rechtsfälle werden behandelt?
Wichtige Rechtsfälle, die in der Arbeit analysiert werden, sind der französische "Canal de Craponne"-Rechtsfall, der englische Fall "Paradine v. Jane" und "Taylor v. Caldwell", sowie die Entwicklung der Rechtsprechung im Kontext von § 313 BGB im deutschen Recht.
Welche Rolle spielen vertragliche Klauseln?
Die Bedeutung und Ausgestaltung vertraglicher Klauseln im Kontext von Force Majeure und Imprévision werden im französischen Kapitel ausführlich behandelt. Auch in den anderen Kapiteln wird die Bedeutung präventiver Vertragsgestaltung und Klauseln zur Risikominderung diskutiert.
Wie werden die Ergebnisse präsentiert?
Die Arbeit präsentiert eine vergleichende Analyse der drei nationalen Rechtssysteme (Frankreich, England, Deutschland), die im europäischen und internationalen Kontext eingeordnet wird. Sie identifiziert Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Ansätzen und Regelungen und zeigt die Auswirkungen unvorhergesehener Ereignisse auf vertragliche Verpflichtungen auf.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Force Majeure, Imprévision, Vertragsrecht, französisches Recht, englisches Recht, deutsches Recht, Rechtsvergleichung, Unmöglichkeit der Leistung, Störung der Geschäftsgrundlage, UN-Kaufrechtskonvention (CISG), europäisches Vertragsrecht, Vertragsklauseln, Rechtsprechung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist für Juristen, Wissenschaftler und Studierende des Rechts relevant, die sich mit Vertragsrecht, insbesondere mit den Konzepten von Force Majeure und Imprévision, befassen. Sie eignet sich auch für alle, die ein tiefergehendes Verständnis des Rechtsvergleichs in diesem Bereich benötigen.
- Quote paper
- Philipp Hujo (Author), 2007, Force majeure et Imprévision , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85222