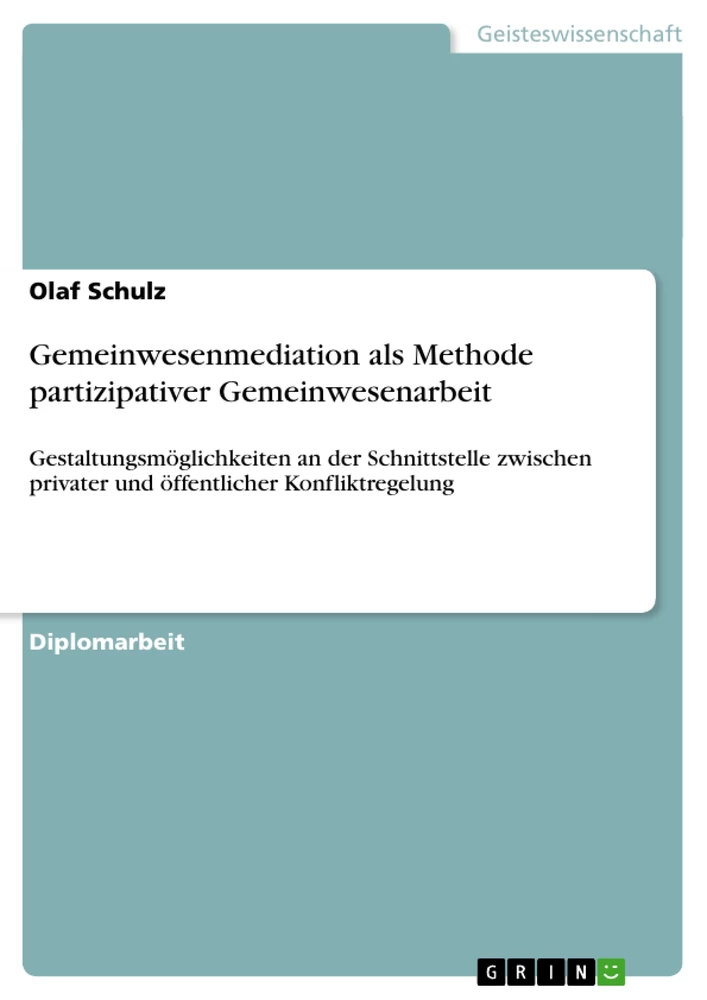Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit richtet sich auf die Frage, wie bei Mediationsfällen im Gemeinwesen die Wahrscheinlichkeit erhöht werden kann, dass die von BürgerInnen erarbeiteten Veränderungswünsche, wenn sie im Bereich öffentlichen Regelungsanspruchs liegen, auch von Politik und Verwaltung berücksichtigt und umgesetzt werden. Als praxisrelevante und handlungsorientierte Ergebnisse werden Ideen und Vorschläge zu dieser Frage auf Grundlage von Expertenbefragungen geprüft und ggf. erweitert werden.
Die Fragestellung geht von der Erfahrung aus, dass sich in der Konfliktbearbeitung durch Gemeinwesenmediation (GWM) immer wieder der private Konfliktkontext mit öffentlichen Belangen überschneidet. Im Sinne von Partizipation bei Veränderungsprozessen z.B. in Stadtteilen kann das durchaus erfreulich sein, in der Praxis von Gemeinwesenmediation werden jedoch die Grenzen von Mediationsverfahren im Gemeinwesen immer wieder deutlich. Genaueres Hinsehen führt den Betrachter direkt zum Spannungsverhältnis zwischen den unterschiedlichen Handlungslogiken, Verfahrensweisen und Rahmenbedingungen bei politisch-administrativen, rechtlichen und mediativen Verfahren in Deutschland.
Der einschränkende Fokus der Betrachtungen liegt somit auf der Kopplung von GWM zum öffentlichen Bereich, da es dort wiederholt um Konfliktthemen geht, die zu ihrer Bearbeitung und Lösungsfindung letztlich einer im behördlichen Verfahren erzielten positiven politisch-administrativen Entscheidung bedürfen. In der Praxis zeigt sich dabei, dass Mediationsverfahren von den dann formal zuständigen Entscheidungsinstanzen sogar als Konkurrenz wahrgenommen werden können . Das betrifft auch die Frage nach der Legitimität einer solchen Beteiligungsform in einer repräsentativen Demokratie, in der das Mehrheitsprinzip sowohl die Verantwortlichkeit als auch die „Vernünftigkeit“ (staatlicher) Machtausübung gewährleisten soll.
Diesem Anspruch an Regelungshoheit steht die Feststellung gegenüber, dass demokratisch legitimierte Institutionen nicht mehr die eigentlich erwünschte und praktizierte Legitimation vor den BürgerInnen bieten aufgrund eines hohen Maßes an Vereinnahmung der Vertretungsrechte und –funktionen durch das politisch-administrative System.
Die Arbeit fragt nach den Bedingungen, die GWM braucht, um trotz dieser Schwierigkeiten im dargelegten Spannungsfeld erfolgreich praktiziert zu werden und gibt Antworten aufgrund vorliegender Literatur und den Erfahrungen ausgewiesener ExpertInnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Aufbau der Arbeit
- Untersuchungsrahmen und Interviewmethode
- Auswahl der ExpertInnen
- Auswertung der Interviews
- Gemeinwesenmediation
- Mediation
- Methoden und Techniken
- Begriffsklärung: Gemeinwesenmediation in Abgrenzung zu Stadtteilmediation, Nachbarschaftsmediation und Mediation im öffentlichen Bereich
- Welche Konflikte sind Gegenstand von Gemeinwesenmediation?
- Der räumliche Bezug
- MediatorInnen
- Die weiteren Ziele von Gemeinwesenmediation
- Gesellschaftspolitischer Rahmen für Gemeinwesenmediation
- Mediation und Demokratie
- Legitimität von Mediation
- Interne Legitimation
- Externe Legitimation
- Legitimität von Mediation
- Mediation und Verwaltungsverfahren
- Mediation und Recht
- Mediation als Partizipation
- Partizipation als zivilgesellschaftlicher Prozess
- Partizipation an repräsentativ legitimierter Entscheidungsgewalt
- Mediation und Demokratie
- GWM im Kontext sozialer Arbeit
- Gesellschaftliche Funktion Sozialer Arbeit
- Gemeinwesenarbeit - Überlegungen zur Bedeutung der Methodendiskussion
- Konzepte der Gemeinwesenarbeit
- Konzeptionelle Grundpositionen in der Entwicklung der Gemeinwesenarbeit
- Leitstandards der Gemeinwesenarbeits-Ansätze
- Möglichkeiten von GWM innerhalb sozialer Arbeit
- Mediation als Beteiligungsform – Konfliktbearbeitung als Aktivierungs- und Vitalisierungschance
- Mediation als Deeskalation
- Mediation als Netzwerkarbeit und konkrete Kooperation
- Mediation als „Empowerment“
- Vorschläge zu Gestaltungsmöglichkeiten an der Schnittstelle zwischen privater und öffentlicher Konfliktregelung
- Freiwillige Selbstbindung der Beteiligten
- Beteiligte und Stakeholder
- Mitsprache- und Entscheidungskompetenzen in der Mediation
- Mandatsklärung und Rückkopplung
- Rollenkonflikte
- Akteure vor Ort – Teilnehmer oder potentielle MediatorInnen?
- Ziel- und Ergebnisvorstellungen
- Ergebnisoffenheit
- Art der Vereinbarung
- Transparentes Verfahrensdesign – „Geschäftsordnung“
- Unterstützende Rahmenbedingungen
- Unabhängigkeit
- Konfliktanalyse im Vorfeld
- Ergebnisse der ausgewerteten Interviews
- Beteiligung am Mediationsverfahren
- Freiwillige Selbstbindung
- Reichweite der Bemühungen, Verhandlungsrahmen und Ziele von GWMV
- Erhöhung der Wahrscheinlichkeit des Eingangs von Mediationsergebnissen in Verwaltungsentscheidungen
- Wenn Entscheidungsträger die Ergebnisse mitnehmen ...
- Auswirkungen der Letztentscheidungskompetenz in der Mediation auf die Beteiligten
- Rollenkonflikte und Funktionsüberschneidungen
- SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen als MediatorInnen
- Konfliktanalyse
- Verfahrensdesign
- Öffentlichkeitsarbeit
- Setting
- Unabhängigkeit, Allparteilichkeit
- Unterstützende Rahmenbedingungen und Ressourcen im Mediationsfall
- Unterstützende Rahmenbedingungen und Ressourcen für ein GWM-Projekt
- Rolle der SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Gemeinwesenmediation als Methode partizipativer Gemeinwesenarbeit und untersucht die Gestaltungsmöglichkeiten an der Schnittstelle zwischen privater und öffentlicher Konfliktregelung.
- Die Bedeutung von Gemeinwesenmediation als Instrument zur Konfliktlösung im Kontext von sozialer Arbeit
- Die Integration von Gemeinwesenmediation in den gesellschaftlichen Rahmen von Demokratie, Verwaltungsverfahren und Recht
- Die Rolle von Gemeinwesenmediation als Beteiligungsform und die Förderung von Partizipation in der Entscheidungsfindung
- Die Möglichkeiten und Herausforderungen der Einbindung von Gemeinwesenmediation in die Praxis der Sozialen Arbeit
- Die Gestaltung von Schnittstellen zwischen privater und öffentlicher Konfliktregelung im Hinblick auf Gemeinwesenmediation
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit vor.
- Kapitel 2 erläutert den Begriff der Gemeinwesenmediation und grenzt sie von anderen Formen der Mediation ab. Es werden die Methoden und Techniken sowie die Ziele der Gemeinwesenmediation vorgestellt.
- Kapitel 3 analysiert den gesellschaftlichen Rahmen von Gemeinwesenmediation, indem es die Verknüpfung mit Demokratie, Verwaltungsverfahren, Recht und Partizipation beleuchtet.
- Kapitel 4 untersucht die Einbindung von Gemeinwesenmediation in den Kontext der Sozialen Arbeit. Dabei werden die gesellschaftliche Funktion der Sozialen Arbeit, die Konzepte der Gemeinwesenarbeit sowie die Möglichkeiten der GWM innerhalb der Sozialen Arbeit diskutiert.
- Kapitel 5 entwickelt Vorschläge zur Gestaltung von Schnittstellen zwischen privater und öffentlicher Konfliktregelung im Bereich der Gemeinwesenmediation. Es werden verschiedene Aspekte wie die freiwillige Selbstbindung der Beteiligten, die Mitsprache- und Entscheidungskompetenzen in der Mediation, die Ziel- und Ergebnisvorstellungen sowie unterstützende Rahmenbedingungen behandelt.
- Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse der ausgewerteten Interviews, welche die praktischen Erfahrungen und Perspektiven von ExpertInnen aus dem Bereich der Gemeinwesenmediation aufzeigen.
Schlüsselwörter
Gemeinwesenmediation, Partizipation, Konfliktregelung, Soziale Arbeit, Gemeinwesenarbeit, Mediation, Demokratie, Verwaltungsverfahren, Recht, Empowerment, Netzwerkarbeit, Gestaltungsmöglichkeiten, Schnittstellen, private und öffentliche Konfliktregelung, ExpertInneninterviews
Häufig gestellte Fragen
Was ist Gemeinwesenmediation (GWM)?
Gemeinwesenmediation ist eine Methode zur Konfliktlösung im öffentlichen Raum, bei der Bürger Veränderungswünsche erarbeiten. Sie grenzt sich von der Nachbarschafts- oder Stadtteilmediation durch ihren Bezug zu öffentlichen Belangen ab.
Welches Spannungsfeld untersucht diese Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Spannungsverhältnis zwischen mediativen Verfahren und politisch-administrativen Handlungslogiken, insbesondere wenn Lösungen behördliche Entscheidungen erfordern.
Wie kann die Akzeptanz von Mediationsergebnissen in der Politik erhöht werden?
Durch eine frühzeitige Kopplung an den öffentlichen Bereich, die Klärung von Mandaten und die Einbindung von Entscheidungsträgern als Stakeholder kann die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung erhöht werden.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit in der Gemeinwesenmediation?
GWM dient in der Sozialen Arbeit als Instrument zur Partizipation, Deeskalation, Netzwerkarbeit und zum Empowerment der Bürger im Stadtteil.
Was sind die wichtigsten Gestaltungselemente für ein erfolgreiches Verfahrensdesign?
Dazu gehören eine transparente Geschäftsordnung, die Klärung der Freiwilligkeit, Unabhängigkeit der Mediatoren sowie eine gründliche Konfliktanalyse im Vorfeld.
Gilt Mediation als demokratisch legitimiert?
Die Arbeit diskutiert die interne und externe Legitimation von Mediation im Rahmen einer repräsentativen Demokratie und betrachtet sie als Form zivilgesellschaftlicher Partizipation.
- Quote paper
- Dipl. Sozialarbeiter/Sozialpädagoge Olaf Schulz (Author), 2004, Gemeinwesenmediation als Methode partizipativer Gemeinwesenarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85240