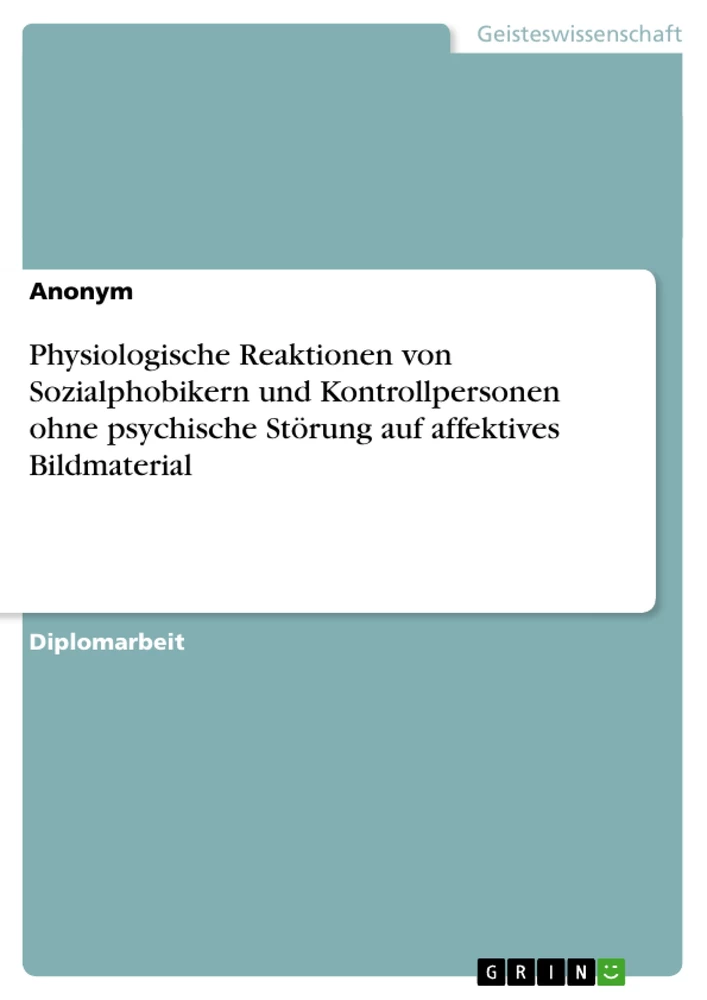Die vorliegende Studie entstand vor dem Hintergrund einer heterogenen Befundlage zum Angstausdruck von Sozialphobikern auf unterschiedlichen emotionalen Ebenen. Die Mehrzahl bisheriger Untersuchungen konnte Unterschiede im subjektiven Angsterleben zwischen Sozialphobikern und Personen ohne psychische Störung relativ leicht und einheitlich nachweisen; für physiologische Reaktionen, als objektive Angstindikatoren, gelang dies jedoch selten. In dieser Untersuchung sollte durch das Betrachten von Bildern, welche typische von Sozialphobikern gefürchtete Inhalte (ärgerliche Gesichter, Rede- und Interaktionssituationen) abbilden, soziale Angst bei diesen Personen induziert werden. Ziel der Untersuchung ist zu bestimmen, ob soziale Angst bei Sozialphobikern mittels Vorlage von sozial bedrohlichem Bildmaterial induziert werden kann und von welchen Veränderungen sie im Vergleich zu Kontrollpersonen begleitet ist. Der Effekt dieses furchtinduzierenden Stimulusmaterials wird durch einen Vergleich mit neutralen Bildreizen (neutrale Gesichtsausdrücke, neutrale Abbildungen) untersucht. Dazu wurden an 23 Sozialphobikern und 23 Personen ohne psychische Störung als physiologische Variabeln die Herzrate und das Hautleitfähigkeitsniveau erhoben sowie die subjektive Erlebniskomponente der Angst, operationalisiert mittels ikonographischer Ratingskalen mit den Dimensionen „Erregung“, „Valenz“ und „Dominanz“. Die Ergebnisse werden dahingehend interpretiert, dass physiologische Prozesse für die Auslösung sozialphobischer Furcht eine untergeordnete Rolle spielen. Anhand der Ergebnisse ist zu vermuten, dass Sozialphobiker ihre physiologischen Reaktionen stärker wahrnehmen bzw. in einer anderen Weise bewerten als Personen ohne soziale Angst. Im Sinne kognitiver Modelle ist anzunehmen, dass die Problematik körperlicher Symptome im Rahmen der Sozialen Phobie nicht notwendigerweise im Ausmaß der physiologischen Aktivierung liegt, sondern die Wahrnehmung und Interpreta¬tion der Symptome das Problem ausmachen und weniger die Reaktionen selbst.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1 Theoretischer Hintergrund
- 1.1 Die Soziale Phobie
- 1.1.1 Erscheinungsbild
- 1.1.2 Definition
- 1.1.3 Epidemiologie
- 1.1.4 Störungsbeginn
- 1.1.5 Verlauf und Folgen
- 1.1.6 Komorbidität und differentialdiagnostische Abgrenzung
- 1.1.7 Zusammenfassung
- 1.2 Modelle zur Ätiologie der Sozialen Phobie
- 1.2.1 Entwicklungspsychologische Theorien
- 1.2.1.1 Biologische Dispositionen
- 1.2.1.2 Verhaltenshemmung und Schüchternheit
- 1.2.1.3 Einflüsse durch Sozialisation
- 1.2.2 Lerntheoretische Erklärungen
- 1.2.2.1 Klassische Konditionierung
- 1.2.2.2 Modelllernen
- 1.2.2.3 Preparedness
- 1.2.3 Ein Informationsverarbeitungsmodell der sozialen Angst von Öhman
- 1.2.4 Das neuropsychologische Modell der Angst von Gray
- 1.2.5 Kognitive Modelle der Sozialen Phobie
- 1.2.5.1 Das Modell der kognitiven Vulnerabilität von Beck und Emery
- 1.2.5.2 Das Selbstdarstellungsmodell von Schlenker und Leary
- 1.2.5.3 Ein integriertes kognitiv-behaviorales Modell von Heimberg
- 1.2.5.4 Das kognitive Modell der Sozialen Phobie von Clark und Wells
- 1.2.6 Abschließende Bemerkungen zu den Modellen der sozialen Angst
- 1.3 Psychophysiologische Aktivierung und subjektiv empfundene Angst bei der Sozialen Phobie
- 1.3.1 Der Begriff der Emotion
- 1.3.2 Forschungsbefunde zu Herzraten, Hautleitwerten und subjektiven Empfindungen bei sozialer Angst
- 1.3.2.1 Untersuchungen an sozialphobischen Stichproben
- 1.3.2.2 Untersuchungen an sozial ängstlichen Stichproben
- 1.3.2.3 Zusammenfassung und Bedeutung für die vorliegende Arbeit
- 1.3.3 Kovariationsproblem der emotionalen Ebenen
- 1.3.3.1 Ursachen des Kovariationsproblems
- 2 Fragestellung und Hypothesen
- 2.1 Ableitung der Fragestellung
- 3 Methoden
- 3.1 Versuchsplan
- 3.2 Probanden
- 3.2.1 Rekrutierung der Stichproben
- 3.2.2 Beschreibung und Vergleich der Stichproben hinsichtlich soziodemographischer Daten
- 3.3 Messinstrumente
- 3.3.1 Strukturiertes klinisches Interview für DSM-IV
- 3.3.2 Social Phobia Inventory
- 3.3.3 Liebowitz Social Anxiety Scale
- 3.3.4 Beck-Depressions-Inventar
- 3.3.5 Beschreibung und Vergleich beider Stichprobengruppen hinsichtlich der Fragebogendaten
- 3.4 Stimulusmaterial
- 3.4.1 Überlegungen zur Auswahl des Stimulusmaterials
- 3.4.2 Verwendetes Stimulusmaterial
- 3.4.3 Quellen des verwendeten Stimulusmaterials
- 3.4.3.1 Das International Affective Picture System
- 3.4.3.2 Die Bildsammlung von Mazurski und Bond
- 3.4.3.3 Bilder aus anderen Quellen
- 3.5 Abhängige Variablen
- 3.5.1 Psychophysiologische Variablen
- 3.5.1.1 Messung der Herzfrequenz
- 3.5.1.1.1 Das EKG
- 3.5.1.2 Messung der Hautleitfähigkeit
- 3.5.1.2.1 Messmethode
- 3.5.1.3 Mini-Vitaport-System
- 3.5.1.3.1 Ableitung der Herzfrequenz
- 3.5.1.3.2 Ableitung der Hautleitfähigkeit
- 3.5.1.3.3 Aufbereitung der psychophysiologischen Daten
- 3.5.2 Erfassung der subjektiven Angst
- 3.5.2.1 Dimensionen der Einschätzung von Emotionen
- 3.5.2.2 Das Self-Assessment-Manikin in dieser Untersuchung
- 3.6 Versuchsdurchführung
- 3.7 Statistische Hypothesen
- 3.8 Statistische Auswertung
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Vergleich der physiologischen Reaktionen zwischen Sozialphobikern und Kontrollpersonen hinsichtlich der Bildkategorien
- 4.1.1 Herzfrequenz
- 4.1.2 Hautleitfähigkeit
- 4.2 Differentielle Wirkung verschiedener Bildinhalte bei Sozialphobikern
- 4.2.1 Herzfrequenz
- 4.2.2 Hautleitfähigkeit
- 4.3 Weitere, nicht hypothesengeleitete Analysen
- 4.3.1 Differentielle Wirkung verschiedener Bildinhalte bei Kontrollpersonen
- 4.3.1.1 Herzfrequenz
- 4.3.1.2 Hautleitfähigkeit
- 4.3.2 Linearer Zusammenhang zwischen Angstratings und physiologischen Maßen
- 4.3.2.1 Ergebnisse der Analyse des subjektiven Angsterlebens
- 4.3.2.2 Zusammenhang zwischen Angstratings und physiologischen Maßen sozialer Angst bei Sozialphobikern
- 4.3.2.3 Zusammenhang zwischen Angstratings und physiologischen Maßen sozialer Angst bei Kontrollpersonen
- 4.3.3 Linearer Zusammenhang zwischen den beiden physiologischen Parametern
- 4.3.4 Geschlechtsunterschiede in der Reaktion auf die Bildreize
- 4.3.4.1 Herzfrequenz
- 4.3.4.2 Hautleitfähigkeit
- 4.3.5 Einfluss des Geschlechts der abgebildeten Personen
- 4.3.5.1 Herzfrequenz
- 4.3.5.2 Hautleitfähigkeit
- 4.3.5.3 Vergleiche zwischen den Probandengruppen
- 4.3.6 Einfluss des Blickkontaktes der abgebildeten Personen auf Sozialphobiker
- 4.3.6.1 Redebilder
- 4.3.6.2 Interaktionsbilder
- 5 Diskussion
- 5.1 Interpretation der zentralen Befunde
- 5.2 Alternativerklärungen zu den zentralen Befunden
- 5.3 Differentielle Wirkung verschiedener Bildinhalte
- 5.4 Linearer Zusammenhang zwischen Angstratings und physiologischen Maßen
- 5.5 Geschlechtseinflüsse
- 5.6 Blickkontakt
- 5.7 Begrenzungen dieser Untersuchung
- 5.8 Zusammenfassung und Ausblick
- Physiologische Reaktionen von Sozialphobikern und Kontrollpersonen auf affektives Bildmaterial
- Unterschiede in der Herzfrequenz und Hautleitfähigkeit zwischen den Gruppen
- Einfluss von Bildinhalten auf die physiologische Aktivierung und das subjektive Angsterleben
- Zusammenhang zwischen physiologischen Parametern und subjektivem Angsterleben
- Rolle von visuellen Reizen in der Entstehung und Aufrechterhaltung der Sozialen Phobie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Untersuchung der physiologischen Reaktionen von Sozialphobikern im Vergleich zu Kontrollpersonen ohne psychische Störung auf affektives Bildmaterial. Ziel ist es, die Unterschiede in der physiologischen Aktivierung und dem subjektiven Angsterleben zwischen den beiden Gruppen zu analysieren. Die Studie zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die physiologischen Mechanismen der Sozialen Phobie zu entwickeln und die Rolle von visuellen Reizen in der Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit bietet einen umfassenden theoretischen Hintergrund zur Sozialen Phobie. Es beleuchtet das Erscheinungsbild, die Definition, die Epidemiologie, den Störungsbeginn, den Verlauf und die Folgen sowie die Komorbidität und differentialdiagnostische Abgrenzung der Störung. Es werden verschiedene Modelle zur Ätiologie der Sozialen Phobie vorgestellt, darunter Entwicklungspsychologische, Lerntheoretische, Informationsverarbeitungs- und Kognitive Modelle. Der Schwerpunkt liegt auf der psychophysiologischen Aktivierung und dem subjektiven Angsterleben bei der Sozialen Phobie, wobei die Forschungsbefunde zu Herzraten, Hautleitwerten und subjektiven Empfindungen im Kontext sozialer Angst zusammengefasst werden.
Das zweite Kapitel behandelt die Fragestellung und die Hypothesen der Studie. Ausgehend vom bestehenden Forschungsstand werden spezifische Fragen hinsichtlich der physiologischen Reaktionen von Sozialphobikern und Kontrollpersonen auf affektives Bildmaterial formuliert. Die Hypothesen beziehen sich auf Unterschiede in der Herzfrequenz und Hautleitfähigkeit zwischen den Gruppen sowie auf den Einfluss von Bildinhalten auf die physiologische Aktivierung und das subjektive Angsterleben.
Kapitel drei beschreibt die Methoden der Untersuchung. Es werden der Versuchsplan, die Stichprobenrekrutierung und -beschreibung, die verwendeten Messinstrumente, das Stimulusmaterial, die abhängigen Variablen, die Versuchsdurchführung und die statistische Auswertung erläutert.
Kapitel vier präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Es werden die Unterschiede in der physiologischen Aktivierung zwischen Sozialphobikern und Kontrollpersonen hinsichtlich der Bildkategorien und den einzelnen Bildinhalten analysiert. Der Zusammenhang zwischen physiologischen Maßen und dem subjektiven Angsterleben sowie der Einfluss von Geschlecht und Blickkontakt auf die Reaktionen der Probanden wird ebenfalls untersucht.
Schlüsselwörter
Soziale Phobie, Angststörung, psychophysiologische Reaktionen, affektives Bildmaterial, Herzfrequenz, Hautleitfähigkeit, subjektives Angsterleben, visuelle Reize, Bildinhalte, Geschlechterunterschiede, Blickkontakt, Kovariationsproblem.
Häufig gestellte Fragen
Wie reagieren Sozialphobiker physiologisch auf soziale Bedrohung?
Die Studie zeigt, dass Sozialphobiker soziale Angst subjektiv stark erleben, die objektiven physiologischen Parameter (Herzrate, Hautleitfähigkeit) jedoch oft weniger deutlich von Kontrollpersonen abweichen als erwartet.
Was war das Ziel der Untersuchung mit affektivem Bildmaterial?
Es sollte bestimmt werden, ob soziale Angst durch Bilder (z. B. ärgerliche Gesichter, Redesituationen) induziert werden kann und welche Veränderungen dies bei Sozialphobikern auslöst.
Welche Rolle spielt die Wahrnehmung körperlicher Symptome?
Sozialphobiker nehmen ihre physiologischen Reaktionen vermutlich stärker wahr oder bewerten sie negativer, was die Angst verstärkt, selbst wenn die tatsächliche Aktivierung moderat ist.
Was ist das "Kovariationsproblem" der emotionalen Ebenen?
Es beschreibt das Phänomen, dass subjektives Erleben, physiologische Reaktion und motorischer Ausdruck (Verhalten) bei Emotionen oft nicht im gleichen Maße korrelieren.
Welche kognitiven Modelle werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit diskutiert Modelle von Beck, Emery, Clark und Wells sowie das Selbstdarstellungsmodell von Schlenker und Leary.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2005, Physiologische Reaktionen von Sozialphobikern und Kontrollpersonen ohne psychische Störung auf affektives Bildmaterial, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85351