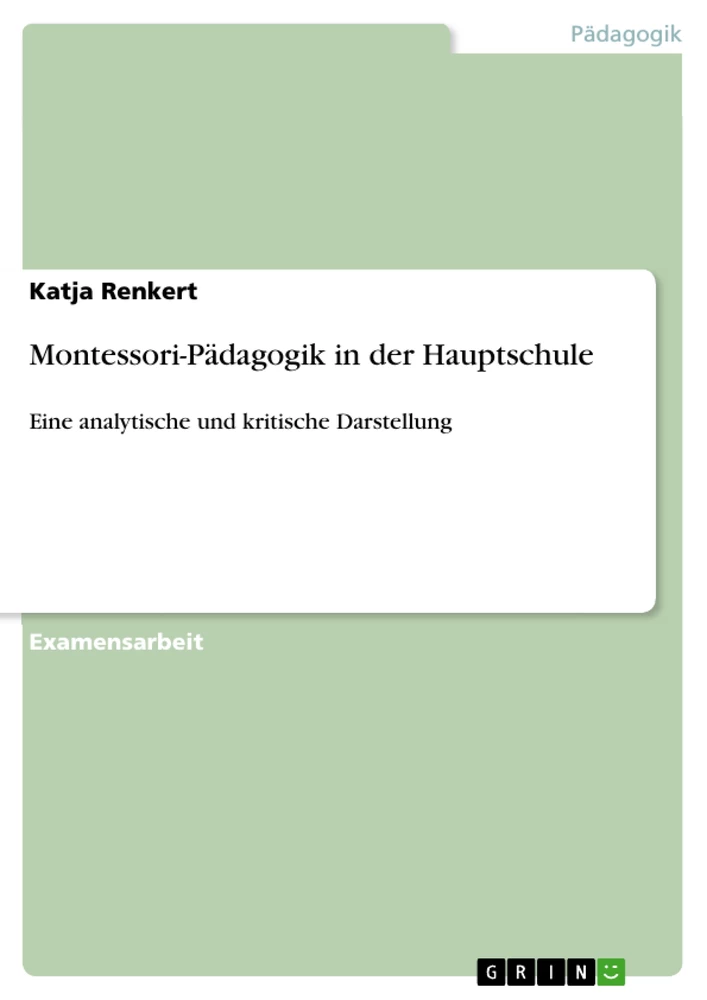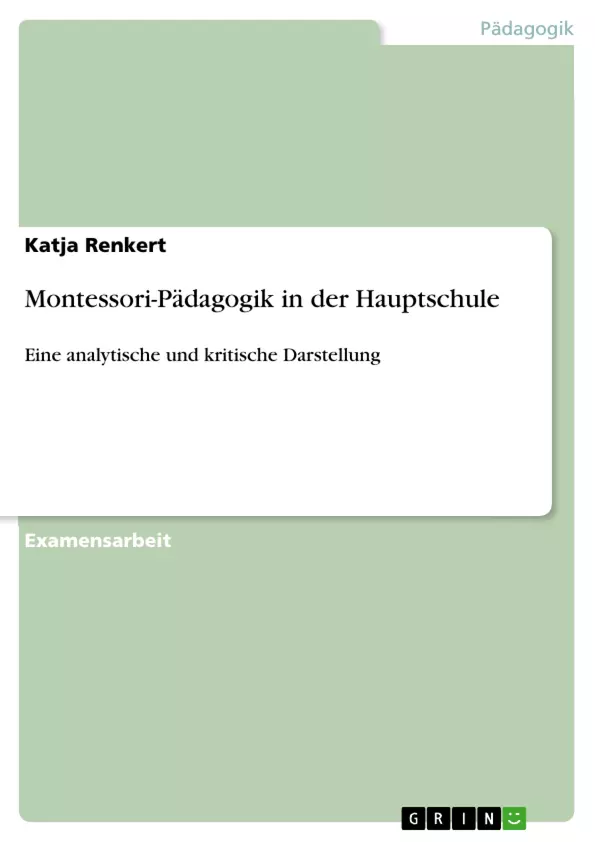Leistungsstanderhebungen wie PISA, bei denen der Leistungsstand 15-Jähriger geprüft wurde, bescheinigten Deutschland eine miserable Bildungssituation. Die Regelschulen stehen seither in einem schlechten Licht und das Nachdenken über alternative Schulkonzepte mehrt sich. Zu einem dieser alternativen Konzepte der Schulpraxis gehört der pädagogische Ansatz von Maria Montessori, um welches diese Arbeit sich dreht.
Die Fragestellung der Arbeit ist nun, inwieweit man die Montessori-Pädagogik als alternatives Schulkonzept in der Hauptschule umsetzen kann. Ich beabsichtige daher, einen Überblick über die Theorie und Praxis der Montessori-Pädagogik als Beispiel der Umsetzung eines reformpädagogischen Konzeptes in der Sekundarstufe zu geben. Es soll erläutert werden, warum die Montessori-Methode als geeignet angesehen wird und welche Lücken und Schwachpunkte sie dennoch aufweist.
Die Methodik des Vorgehens ist dabei, zunächst einen Überblick über die Prinzipien der Montessori-Methode zu geben, um diese dann an einem Praxisbeispiel zu beleuchten.
Im ersten Teil meiner Arbeit umreiße ich in kurzen Zügen die Reformpädagogik im Allgemeinen, um die Montessori-Pädagogik in den Reformpädagogischen Kontext einordnen zu können.
Daraufhin wird ein Überblick über Montessoris Leben und Werk gegeben und über die Arbeit Clara Grunwalds, die Wesentliches zur Verbreitung der Montessori-Pädagogik in Deutschland beigetragen hat. Ein Überblick über Montessoris Kritik am Regelschulsystem lässt im Folgenden Rückschlüsse auf ihre pädagogischen Motive zu.
Anschließend werden Maria Montessoris pädagogische Prinzipien dargestellt. Hier geht es trotz aller Ausführlichkeit nicht um eine vollständige Darstellung ihres Gesamtwerks, sondern nur um diejenigen Aspekte, die für diese Arbeit von Bedeutung sind.
Der praktische Teil dieser Arbeit analysiert und beschreibt die Umsetzung der Montessori-Pädagogik an der Integrativen Montessori Schule Sasbach e.V.
Der Punkt „Kritik“ wird für die Bildung eines umfassenden Verständnisses der Thematik als wichtig erachtet. Dabei wird sowohl die Theorie, als auch die Praxis im Fallbeispiel beachtet.
...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Reformpädagogik: Das Jahrhundert des Kindes
- Ursprünge
- Jean-Jacques Rousseau (1712 bis 1778)
- Reformpädagogik (Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert)
- Peter Petersen (1884 bis 1952)
- Célestin Freinet (1896 bis 1966)
- Der offene Unterricht
- Die Öffnung des Unterrichts durch Freiarbeit
- Maria Montessori- Leben und Werk
- Maria Montessoris Weg zur Pädagogik
- Clara Grunwald als Wegbereiterin der Montessori-Pädagogik
- Montessoris Kritik am Schulwesen
- Kritik an der Schule als Institution
- Kritik an der mangelnden Lebensorientierung der Schule
- Kritik an der Rolle des Lehrers
- Kritik an der herkömmlichen Erziehung Jugendlicher
- Maria Montessoris Pädagogisches Konzept
- Die sensiblen Phasen
- Phase 1: Geburt bis 6 Jahre
- Phase 2: 6 bis 12 Jahre
- Phase 3: 12 bis 18 Jahre
- Die Polarisation der Aufmerksamkeit
- Der Verlauf der Polarisation der Aufmerksamkeit
- Bedingungen für das Zustandekommen der Polarisation der Aufmerksamkeit
- Der absorbierende Geist
- Die vorbereitete Umgebung
- Das Material
- Die freie Wahl der Arbeit
- Die Rolle der Lehrkraft
- Jahrgangsmischung
- Integration behinderter Kinder
- Der Freiheitsbegriff nach Montessori
- Der Fehler und seine Kontrolle
- Kosmische Erziehung
- Die kosmische Theorie
- Das Konzept der kosmischen Erziehung
- Die Stille
- Bewegung
- Montessori und Religion
- Der Erdkinderplan
- Die Erfahrungsschule des sozialen Lebens
- Der Studien- und Arbeitsplan
- Die Methoden
- Exkurs: Marchtaler Plan
- Ergebnisse der Montessori-Pädagogik
- Montessoripädagogik in der Hauptschule
- Hauptschüler und die Pubertät
- Zur Problemlage der gegenwärtigen Hauptschule
- Notwendigkeit eines alternativen Schulkonzepts
- Die Integrative Montessori-Schule Sasbach e.V.
- Lehrer
- Die Schüler
- Das Material
- Räumliche Bedingungen
- Der Tagesablauf an der IMS
- Die Freiarbeit
- Die Dokumentation der Arbeit
- Noten
- Kritik an der Integrativen Montessori-Schule Sasbach e.V.
- Kritik
- Kritik an der Reformpädagogik allgemein
- Idealisiertes Menschenbild
- Reform selbst muss reformiert werden
- Ineffektives Lernen
- Realisierbarkeit
- Kritik speziell an der Montessori-Pädagogik
- Zum Material
- Überforderung
- Verhältnis zwischen Erwachsenen und dem Kind
- Generelle Vorwürfe
- Mangel an Systematik
- Utopie des Konzepts für die Sekundarstufe
- Stellungnahme zur Kritik
- Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Montessori-Pädagogik und ihrer möglichen Umsetzung in der Hauptschule. Sie analysiert das pädagogische Konzept Maria Montessoris, beleuchtet seine historischen Wurzeln und stellt die zentrale Frage, ob und wie die Montessori-Methode in der Sekundarstufe, insbesondere an der Hauptschule, erfolgreich eingesetzt werden kann.
- Die historischen Wurzeln der Montessori-Pädagogik
- Die zentralen Elemente des pädagogischen Konzepts von Maria Montessori
- Die Relevanz und Eignung der Montessori-Pädagogik für die Hauptschule
- Die praktische Umsetzung der Montessori-Pädagogik in der Hauptschule
- Kritik an der Montessori-Pädagogik und ihre Beantwortung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Relevanz der Montessori-Pädagogik im Kontext der heutigen Hauptschule.
- Kapitel 2: Die Reformpädagogik: Das Jahrhundert des Kindes: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Wurzeln der Montessori-Pädagogik im Kontext der Reformpädagogik.
- Kapitel 3: Maria Montessori- Leben und Werk: Hier wird Maria Montessoris Leben und ihre Entwicklung zum pädagogischen Konzept näher betrachtet.
- Kapitel 4: Maria Montessoris Pädagogisches Konzept: Dieses Kapitel erklärt die zentralen Elemente des Montessori-Konzepts, darunter die sensiblen Phasen, die Polarisation der Aufmerksamkeit und die vorbereitete Umgebung.
- Kapitel 5: Montessoripädagogik in der Hauptschule: Hier wird untersucht, ob und wie sich die Montessori-Pädagogik an die spezifischen Bedürfnisse der Hauptschule anpassen lässt.
- Kapitel 6: Die Integrative Montessori-Schule Sasbach e.V.: Dieses Kapitel analysiert ein konkretes Beispiel einer Montessori-Schule in der Sekundarstufe.
- Kapitel 7: Kritik: Hier werden die Kritikpunkte an der Montessori-Pädagogik allgemein und speziell in Bezug auf die Hauptschule betrachtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Montessori-Pädagogik, Hauptschule, Reformpädagogik, Lernen, Individualisierung, Freiarbeit, vorbereitete Umgebung, sensitive Phasen, Polarisation der Aufmerksamkeit, Kritik, Praxis, Integration, Inklusion.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Kernprinzipien der Montessori-Pädagogik?
Zu den Grundpfeilern gehören die Freiarbeit, die vorbereitete Umgebung, die sensiblen Phasen der Entwicklung und die Polarisation der Aufmerksamkeit.
Kann Montessori-Pädagogik in der Sekundarstufe (Hauptschule) funktionieren?
Die Arbeit untersucht dies am Praxisbeispiel und kommt zu dem Schluss, dass das Konzept als Alternative zur Regelschule geeignet ist, aber spezifische Anpassungen an die Pubertät erfordert.
Was versteht Maria Montessori unter der „vorbereiteten Umgebung“?
Es ist ein Raum, der so gestaltet und mit Materialien ausgestattet ist, dass das Kind selbstständig lernen und seinen aktuellen Bedürfnissen folgen kann.
Was ist die „Polarisation der Aufmerksamkeit“?
Ein Zustand tiefer Konzentration, in dem ein Kind völlig in einer Arbeit versinkt und sich von äußeren Reizen nicht ablenken lässt.
Welche Rolle nimmt der Lehrer in der Montessori-Pädagogik ein?
Der Lehrer versteht sich als Begleiter und Beobachter, der dem Kind hilft, es selbst zu tun, statt frontal Wissen zu vermitteln.
- Quote paper
- Katja Renkert (Author), 2007, Montessori-Pädagogik in der Hauptschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85621