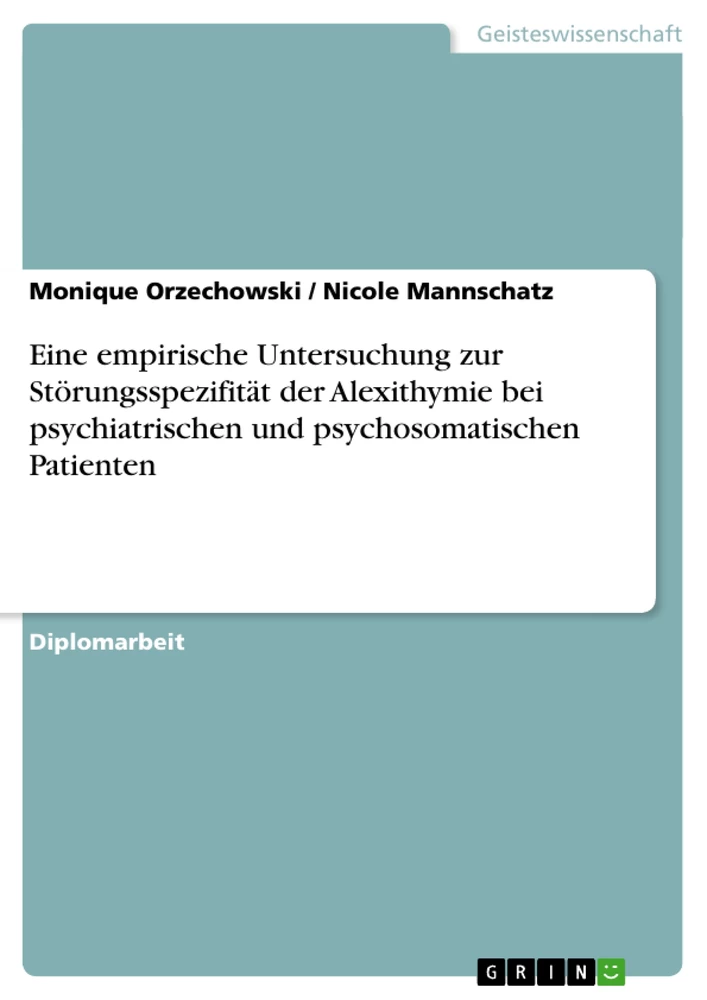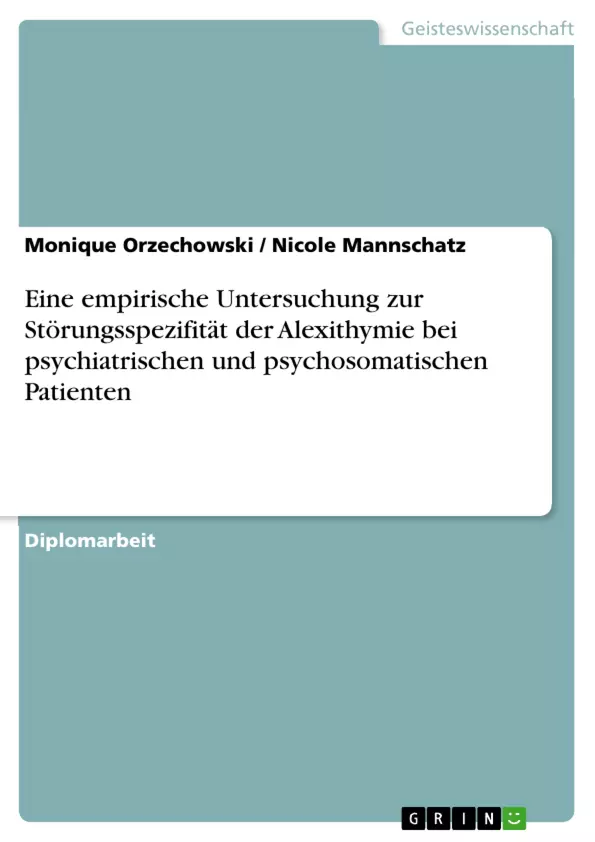Der Begriff „Alexithymie“ wurde erstmals von Sifneos im Jahr 1972 verwendet, nachdem ihm in seiner praktischen Arbeit vermehrt psychosomatische Patienten auffielen, die Schwierigkeiten in der Wahrnehmung, Identifikation und Verbalisierung ihrer eigenen Gefühle, aber auch bei Gefühlen anderer Personen, zeigten. Seit dieser Zeit der Begriffsprägung wurden zunehmend auch Korrelationen von Alexithymie mit anderen psychologischen Konstrukten untersucht, und gefunden.
In der vorliegenden Arbeit soll die Prävalenzrate von Alexithymie bei psychiatrischen und psychosomatischen Patienten überprüft werden. Das Ziel dieser Studie ist, die Alexithymie als ein dimensionales Konstrukt zu verstehen, dass schon längst nicht mehr ausschließlich den psychosomatischen Störungen zugeordnet werden sollte.
Methodik:
Die folgende Untersuchung setzt sich aus 58 Probanden zusammen, welche aus drei Kliniken rekrutiert wurden.Dabei konnten 7 Probanden den psychosomatischen Krankheiten zugeordnet werden, während 48 der Patienten psychiatrische Diagnosen erhielten. Drei Patienten konnten keiner Diagnose zugeordnet werden. Die Patienten wurden gebeten folgende psychometrische Testverfahren auszufüllen: TAS-20 (Kupfer, J. et al., 2001, dt. Fassung), SCL-90-R (Franke, G. H., 2002) und FPI-R (Fahrenberg J., Hampel, R. & Selg, H. 2001).
Ergebnisse:
Alexithymie ist nicht ausschließlich als ein rein psychosomatisches Phänomen zu verstehen. Unsere Untersuchung ergab, dass alexithyme Merkmale in der Gruppe psychiatrischer und psychosomatischer Patienten vermutlich gleich verteilt sind, was jedoch durch weitere Untersuchungen bestätigt werden sollte. Ebenfalls besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen gewissen Persönlichkeitseigenschaften und alexithymen Merkmalen. Somit konnten auch korrelative Zusammenhänge zwischen Alexithymie und Gehemmtheit, Extraversion, körperlichen Beschwerden sowie einer geringen Aggressivität nachgewiesen werden. Ebenfalls wiesen alexithyme Patienten eine hohe psychische Belastung auf. Es besteht ein sehr hoher Zusammenhang zwischen den Skalen der SCL-90-R und Alexithymie. Hinsichtlich persönlicher Rückschläge kann vermutet werden, dass vor allem Patienten, welche eine nahe stehende Person verloren haben (z.B. Tod des Partners) oder sexuellen Missbrauch erfuhren, häufiger alexithyme Merkmale ausbilden. Diese Ergebnisse sollten jedoch durch weitere Untersuchungen überprüft werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Alexithymie – Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Konstrukt und Herkunft der Alexithymie
- 2.1.1 Historische Entwicklung
- 2.1.2 Primäre und Sekundäre Alexithymie
- 2.1.3 Zum aktuellen Stand der Alexithymieforschung
- 2.1.4 Kritik am Alexithymie-Konzept
- 2.2 Entstehungsmodelle der Alexithymie
- 2.2.1 Neurobiologische Ursachen der Alexithymie
- 2.2.2 Psychologische Ursachen der Alexithymie
- 2.2.2.1 Psychoanalytischer Ansatz
- 2.2.2.2 Kognitionspsychologischer Ansatz
- 2.3 Klinische Bedeutsamkeit von Alexithymie
- 2.3.1 Alexithymie bei psychosomatischen Patienten
- 2.3.1.1 Alexithymie und somatoforme Störungen
- 2.3.1.2 Alexithymie und Essstörungen
- 2.3.2 Alexithymie bei psychiatrischen Patienten
- 2.3.2.1 Alexithymie und Zwangsstörungen
- 2.3.2.2 Die „alexithyme Persönlichkeitsstörung“
- 2.3.1 Alexithymie bei psychosomatischen Patienten
- 2.4 Psychotherapie und Behandlungsansätze der Alexithymie
- 2.4.1 Behandlungsansätze primärer und sekundärer Alexithymie
- 2.4.2 Alexithymie, eine Störung des psychotherapeutischen Prozesses
- 2.4.3 Aktuelle Überlegungen zur Behandlung der Alexithymie am Beispiel des Zürcher Ressourcenmodells
- 2.5 Untersuchungsmethoden der Alexithymie
- 2.5.1 Toronto Alexithymie-Skala-20 (TAS)
- 2.5.2 Levels of Emotional Awareness
- 2.5.3 Beth Israel Questionnaire
- 2.5.4 Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire (BVAQ)
- 2.1 Konstrukt und Herkunft der Alexithymie
- 3. Fragestellung und Hypothesen
- 4. Methodenteil
- 4.1 Stichprobenbeschreibung
- 4.2 Durchführung der Untersuchung
- 4.3 Methoden der Datenerhebung
- 4.3.1 SCL-90-R
- 4.3.2 FPI-R
- 4.4 Methoden der Datenauswertung
- 5. Ergebnisse
- 5.1 Ergebnisse hinsichtlich Alexithymie allgemein
- 5.2 Ergebnisse hinsichtlich der Ausprägung alexithymer Merkmale bei psychiatrischen und psychosomatischen Patienten
- 5.3 Ergebnisse hinsichtlich Alexithymie und psychosozialen Belastungen
- 5.4 Alexithymie und persönliche Rückschläge
- 6. Diskussion der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Störungsspezifität von Alexithymie bei psychiatrischen und psychosomatischen Patienten. Ziel ist es, die Ausprägung alexithymer Merkmale in beiden Patientengruppen zu vergleichen und Zusammenhänge mit psychosozialen Belastungen und persönlichen Rückschlägen zu analysieren.
- Ausprägung von Alexithymie bei psychiatrischen und psychosomatischen Patienten
- Vergleich der alexithymen Merkmale in beiden Patientengruppen
- Zusammenhang zwischen Alexithymie und psychosozialen Belastungen
- Einfluss von persönlichen Rückschlägen auf die Alexithymie
- Anwendung verschiedener Untersuchungsmethoden zur Erfassung von Alexithymie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und beschreibt den Kontext der Untersuchung zur Störungsspezifität von Alexithymie bei psychiatrischen und psychosomatischen Patienten. Es skizziert die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage, die im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden soll. Die Einleitung begründet die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung der Alexithymie in Abhängigkeit von der jeweiligen Patientengruppe und legt die methodische Vorgehensweise der Studie kurz dar.
2. Alexithymie – Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das Konstrukt der Alexithymie. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs, differenziert zwischen primärer und sekundärer Alexithymie und diskutiert den aktuellen Stand der Forschung, inklusive kritischer Auseinandersetzung mit dem Konzept. Es werden verschiedene Entstehungsmodelle vorgestellt, sowohl neurobiologische als auch psychologische Ansätze (psychoanalytisch und kognitionspsychologisch), um die komplexen Ursachen der Alexithymie zu erklären. Die klinische Relevanz wird anhand von psychosomatischen (somatoforme Störungen, Essstörungen) und psychiatrischen Erkrankungen (Zwangsstörungen, „alexithyme Persönlichkeitsstörung“) erläutert. Schließlich werden verschiedene psychotherapeutische Behandlungsansätze und Untersuchungsmethoden (TAS-20, Levels of Emotional Awareness, Beth Israel Questionnaire, BVAQ) detailliert beschrieben und kritisch bewertet. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Alexithymie als multifaktorielles Phänomen mit weitreichenden klinischen Implikationen.
3. Fragestellung und Hypothesen: Dieses Kapitel formuliert die zentrale Forschungsfrage der Arbeit präzise und leitet daraus konkrete, überprüfbare Hypothesen ab, die im methodischen Teil der Untersuchung getestet werden sollen. Die Formulierung der Hypothesen basiert auf dem im vorherigen Kapitel dargestellten theoretischen Hintergrund und gibt einen klaren Rahmen für die empirische Untersuchung vor. Die Hypothesen fokussieren auf die vermuteten Unterschiede in der Ausprägung alexithymer Merkmale zwischen den psychiatrischen und psychosomatischen Patientengruppen sowie auf den Zusammenhang von Alexithymie mit psychosozialen Belastungen und persönlichen Rückschlägen.
4. Methodenteil: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der empirischen Untersuchung. Es beinhaltet die Beschreibung der Stichprobe (psychiatrische und psychosomatische Patienten), die Durchführung der Studie, die eingesetzten Methoden der Datenerhebung (SCL-90-R, FPI-R) und die statistischen Verfahren der Datenauswertung. Es wird klar dargelegt, wie die Daten erhoben und analysiert wurden, um die im Kapitel 3 formulierten Hypothesen zu überprüfen. Der Fokus liegt auf der Transparenz und Nachvollziehbarkeit des methodischen Vorgehens, um die Validität und Reliabilität der Ergebnisse sicherzustellen.
5. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung übersichtlich und prägnant. Es berichtet über die Ergebnisse bezüglich der allgemeinen Ausprägung von Alexithymie und die Unterschiede zwischen den psychiatrischen und psychosomatischen Patientengruppen. Die Ergebnisse zu den Zusammenhängen zwischen Alexithymie und psychosozialen Belastungen sowie persönlichen Rückschlägen werden ebenfalls detailliert dargestellt. Die Präsentation der Ergebnisse erfolgt strukturiert und nachvollziehbar, mit Bezug auf die im Kapitel 3 formulierten Hypothesen.
Schlüsselwörter
Alexithymie, Störungsspezifität, psychiatrische Patienten, psychosomatische Patienten, psychosoziale Belastungen, persönliche Rückschläge, Toronto Alexithymie-Skala (TAS-20), SCL-90-R, FPI-R, empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Störungsspezifität von Alexithymie bei psychiatrischen und psychosomatischen Patienten
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Störungsspezifität von Alexithymie bei psychiatrischen und psychosomatischen Patienten. Es wird der Vergleich der Ausprägung alexithymer Merkmale in beiden Patientengruppen und der Zusammenhang mit psychosozialen Belastungen und persönlichen Rückschlägen analysiert.
Was ist Alexithymie?
Die Arbeit liefert einen umfassenden Überblick über das Konstrukt der Alexithymie, inklusive historischer Entwicklung, Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Alexithymie, aktueller Forschungsstand, Kritik am Konzept und verschiedenen Entstehungsmodellen (neurobiologisch und psychologisch – psychoanalytisch und kognitionspsychologisch). Die klinische Relevanz in psychosomatischen (somatoforme Störungen, Essstörungen) und psychiatrischen Erkrankungen (Zwangsstörungen, „alexithyme Persönlichkeitsstörung“) wird ebenfalls erläutert.
Welche Methoden werden zur Untersuchung der Alexithymie verwendet?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Untersuchungsmethoden zur Erfassung von Alexithymie, wie die Toronto Alexithymie-Skala-20 (TAS-20), Levels of Emotional Awareness, Beth Israel Questionnaire und Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire (BVAQ). Im methodischen Teil der Arbeit werden zusätzlich der SCL-90-R und der FPI-R zur Datenerhebung eingesetzt.
Welche Forschungsfragen und Hypothesen werden untersucht?
Die Arbeit formuliert eine zentrale Forschungsfrage zur Störungsspezifität von Alexithymie und leitet daraus überprüfbare Hypothesen ab. Diese Hypothesen konzentrieren sich auf den Vergleich der Ausprägung alexithymer Merkmale zwischen psychiatrischen und psychosomatischen Patienten sowie den Zusammenhang zwischen Alexithymie und psychosozialen Belastungen und persönlichen Rückschlägen.
Wie wird die Studie durchgeführt?
Der Methodenteil beschreibt detailliert die Stichprobenbeschreibung (psychiatrische und psychosomatische Patienten), die Durchführung der Untersuchung, die Methoden der Datenerhebung (SCL-90-R, FPI-R) und die statistischen Verfahren der Datenauswertung. Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit des methodischen Vorgehens wird betont, um die Validität und Reliabilität der Ergebnisse sicherzustellen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Das Kapitel „Ergebnisse“ präsentiert übersichtlich die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es beinhaltet Ergebnisse zur allgemeinen Ausprägung von Alexithymie, Vergleiche zwischen den Patientengruppen, Zusammenhänge zwischen Alexithymie und psychosozialen Belastungen sowie persönlichen Rückschlägen. Die Präsentation bezieht sich auf die zuvor formulierten Hypothesen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter umfassen: Alexithymie, Störungsspezifität, psychiatrische Patienten, psychosomatische Patienten, psychosoziale Belastungen, persönliche Rückschläge, Toronto Alexithymie-Skala (TAS-20), SCL-90-R, FPI-R, empirische Untersuchung.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels: Einleitung, Theoretischer Hintergrund zu Alexithymie, Fragestellung und Hypothesen, Methodenteil, Ergebnisse und Diskussion der Ergebnisse. Diese Zusammenfassungen bieten einen schnellen Überblick über den Inhalt der einzelnen Kapitel.
Welche Behandlungsansätze für Alexithymie werden diskutiert?
Die Arbeit behandelt verschiedene psychotherapeutische Behandlungsansätze für Alexithymie, einschließlich Ansätze für primäre und sekundäre Alexithymie. Es wird die Rolle von Alexithymie im psychotherapeutischen Prozess diskutiert, und aktuelle Überlegungen zur Behandlung am Beispiel des Zürcher Ressourcenmodells werden vorgestellt.
- Citar trabajo
- Dipl. Reha.-Psych.(FH) Monique Orzechowski (Autor), Nicole Mannschatz (Autor), 2007, Eine empirische Untersuchung zur Störungsspezifität der Alexithymie bei psychiatrischen und psychosomatischen Patienten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85669