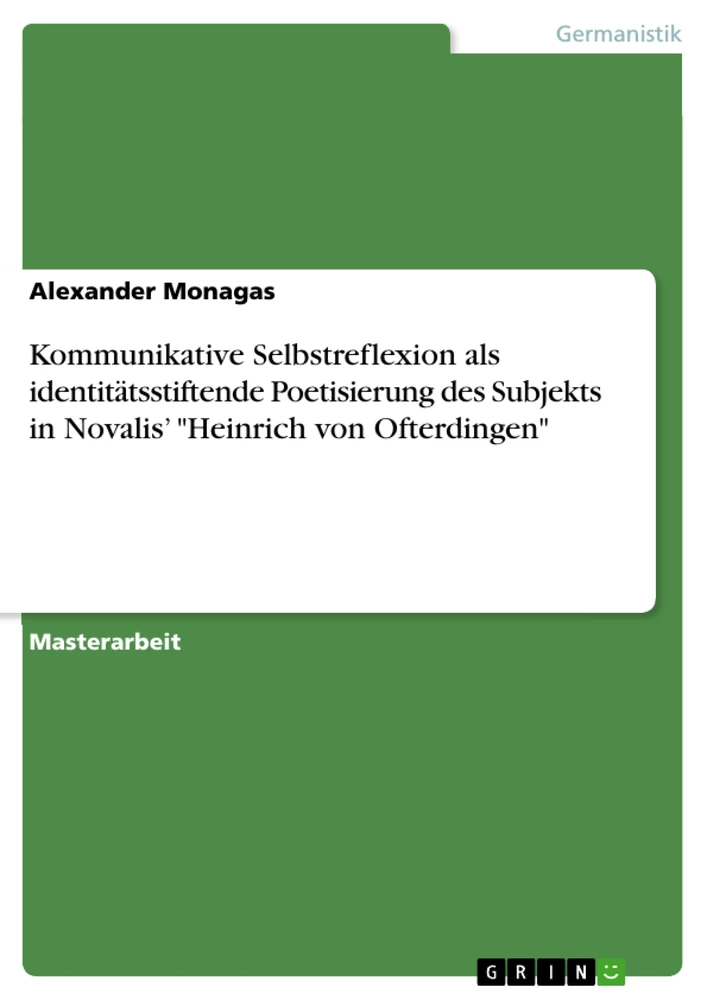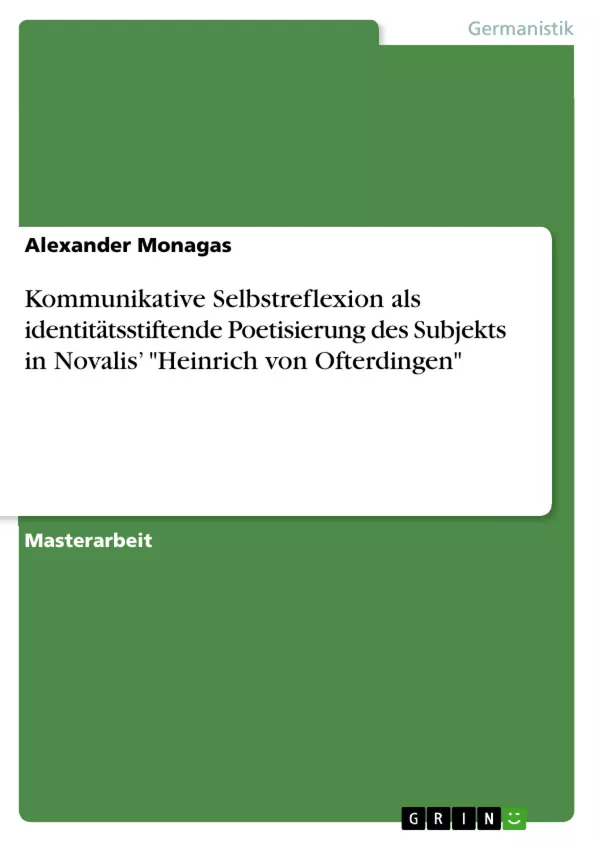Immer wieder finden sich im Ofterdingen Kommunikationssituationen, die dem Protagonisten auf seiner Bildungsreise des inneren Ichs den Weg zur poetischen Subjektwerdung ermöglichen. Begleitet von geistigen Mentoren durchläuft Heinrich eine innere Reflexion, die sich mit einer zunehmend gefestigten poetisierten Identität nach außen kehrt. Die so gewonnene innere Reife dient ihm dazu, den für ihn vorherbestimmten Weg zum vollendeten Dichter zu beschreiten.
Die folgende Arbeit wird mit Fokus auf dem Primärtext die kommunikative Selbstreflexion zur identitätsstiftenden Poetisierung des Subjekts im Heinrich von Ofterdingen von Novalis untersuchen. Es soll dabei gezeigt werden, wie die kommunikative Selbstreflexion des Protagonisten – mit Initiation von innen und außen – die mentale Reife auslöst, welche eine poetisierte Interaktion innerhalb des Geschehens als identitätsstiftende Selbstfindungsgrundlage
etabliert, um die Entwicklung Heinrichs zum Dichter zu ermöglichen. Dabei werden gezielt Textstellen herangezogen, die den kommunikativen Charakter verdeutlichen.
Unterstützende Aspekte wie die Betrachtung ökonomischer Zusammenhänge, die textimmanente Auseinandersetzung mit Natur und Technik, sowie die Betrachtung der Traumerfahrung des Protagonisten stellen zielorientierte Teilbereiche dar, die die Ausgestaltung einer kommunikativen Identität zur poetischen Subjektwerdung Heinrichs deutlich beeinflussen. Natur und Mensch nehmen mit der Dichtkunst auch immer wieder mythische Züge an. Novalis selbst trug zum „Mythos des Dichters“ bei, da er zur Stilisierung des Todes seiner Frau Sophie in Notizen und Schriften beigesteuert hat. Mit der blauen Blume aus Heinrichs Traum schuf er ein bis heute berühmtes Symbol, das zum Kennzeichen einer ganzen Epoche avancierte. Das Symbol verweist auf die „… Erscheinung der Transzendenz in der Immanenz und speziell auf die Dich-tung als ihre der Gegenwart angemessene Form.“
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Der Dichter als Prophet einer kollektiven Subjektwerdung
- 1.1 Philosophischer Einfluss und literaturwissenschaftliche Rezeption
- 1.1.1 Novalis und Magischer Idealismus
- 1.1.2 Novalis und Religiöser Irrationalismus
- 1.1.3 Novalis als dialektische Aufhebung Fichtes
- 1.1.4 Fichte und Novalis
- 1.1.5 Novalis und die Postmoderne
- 1.2 Gefühl und Reflexion bei Novalis
- 1.3 Ordo inversus - Novalis' Reflexionsfigur
- 2. Natur und Bergbau als Spiegel der menschlichen Seele
- 2.1 Natur und Technik „bearbeiten“ die Seele
- 2.1.1 Die Darstellung des Bergbaus und der Natur
- 2.1.2 Das Motiv der weiblichen Natur
- 2.2 Bekannter Fremder: Der geheimnisvolle Bergmann
- 3. Poetische Subjekte im Zeichen der Ökonomie
- 3.1 Konfrontation von Poesie und Ökonomie
- 3.2. Natur als Tauschwert der Ökonomie
- 3.3. Kapitalistische Bereicherung und Schätze der Innerlichkeit
- 3.4 Bergbau und Dichtung im Spannungsfeld poetischer Subjektwerdung
- 4. Träume als poetische Initiation
- 4.1 Der Traum von der blauen Blume
- 4.2 Das Kennenlernen der Geliebten im zweiten Traum
- 5. Interaktive Kommunikation und Selbstreflexion
- 5.1 Kommunikatives Handeln als Reifeprozess der Seele
- 5.2 Die Konstruktion des poetischen Subjekts
- 5.3 Die Verortung des Subjekts in der Poesie
- II. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Novalis' Roman „Heinrich von Ofterdingen“ mit dem Fokus auf die kommunikative Selbstreflexion des Protagonisten, welche zu einer identitätsstiftenden Poetisierung des Subjekts führt. Durch die Interaktion mit anderen und die innere Reflexion entwickelt Heinrich eine reife, poetische Identität und schreitet so seinen Weg zum Dichter voran.
- Kommunikative Selbstreflexion als Motor der Selbstfindung
- Die Rolle von Natur und Technik in der Konstruktion der Identität
- Das Spannungsfeld zwischen Poesie und Ökonomie
- Traumerfahrungen als Katalysator für die poetische Initiation
- Der Dichter als Prophet einer kollektiven Subjektwerdung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die literarische und philosophische Bedeutung Novalis' und stellt die zentrale Frage der Arbeit vor: Wie gestaltet Novalis die kommunikative Selbstreflexion als identitätsstiftende Poetisierung des Subjekts in „Heinrich von Ofterdingen“? Die Arbeit fokussiert auf den überlieferten Text, um zu zeigen, wie die Kommunikation mit anderen und die innere Reflexion Heinrichs zur Entwicklung seiner poetischen Identität beitragen.
Kapitel 1 erörtert die Rolle des Dichters als Prophet einer kollektiven Subjektwerdung im Kontext der französischen Revolution und des sich verändernden Gesellschaftsbildes. Kapitel 2 analysiert das Motiv von Natur und Bergbau als Spiegel der menschlichen Seele, wobei die Darstellung von Technik und Natur als Einflussfaktoren für die innere Entwicklung Heinrichs hervorgehoben wird. Kapitel 3 widmet sich dem Spannungsfeld zwischen Poesie und Ökonomie, in dem die kapitalistische Bereicherung und die Schätze der Innerlichkeit im Zentrum der Betrachtung stehen.
Kapitel 4 beleuchtet die Bedeutung von Träumen als poetische Initiation und fokussiert dabei auf den Traum von der blauen Blume. Kapitel 5 untersucht die interaktive Kommunikation und Selbstreflexion als Reifeprozess der Seele, wobei die Konstruktion des poetischen Subjekts und die Verortung des Subjekts in der Poesie im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beleuchtet die Themenfelder kommunikative Selbstreflexion, identitätsstiftende Poetisierung des Subjekts, Romantische Literatur, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Natur, Technik, Ökonomie, Traumerfahrungen, Dichter als Prophet, kollektive Subjektwerdung, magischer Idealismus und Postmoderne.
Häufig gestellte Fragen
Wofür steht das Symbol der „blauen Blume“ bei Novalis?
Die blaue Blume ist das zentrale Symbol der Romantik. Sie steht für Sehnsucht, die Verbindung von Transzendenz und Immanenz und den Weg zur poetischen Selbstfindung.
Was bedeutet „kommunikative Selbstreflexion“ im Roman „Heinrich von Ofterdingen“?
Es beschreibt den Prozess, bei dem der Protagonist durch den Austausch mit Mentoren und die innere Einkehr eine poetisierte Identität entwickelt, um schließlich zum Dichter zu reifen.
Welche Rolle spielt der Bergbau in Novalis’ Werk?
Der Bergbau dient als Spiegel der menschlichen Seele. Das Eindringen in die Tiefe der Erde symbolisiert die Erforschung der eigenen Innerlichkeit und das Entdecken verborgener Schätze des Geistes.
Was versteht Novalis unter „Magischem Idealismus“?
Es ist eine Weiterentwicklung der Philosophie Kants und Fichtes. Dabei wird die Welt durch die Kraft des Geistes und der Poesie „romantisiert“ und in eine höhere Wirklichkeit überführt.
Wie hängen Poesie und Ökonomie im Roman zusammen?
Novalis stellt die „Schätze der Innerlichkeit“ (Poesie) der rein materiellen, kapitalistischen Bereicherung (Ökonomie) gegenüber und sucht nach einer harmonischen Verbindung beider Welten.
Welche Bedeutung haben Träume für Heinrich von Ofterdingen?
Träume fungieren als poetische Initiation. Sie geben Heinrich Vorahnungen seines Schicksals und leiten seine spirituelle und künstlerische Entwicklung ein.
- Citar trabajo
- Master of Arts Alexander Monagas (Autor), 2007, Kommunikative Selbstreflexion als identitätsstiftende Poetisierung des Subjekts in Novalis’ "Heinrich von Ofterdingen", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85763