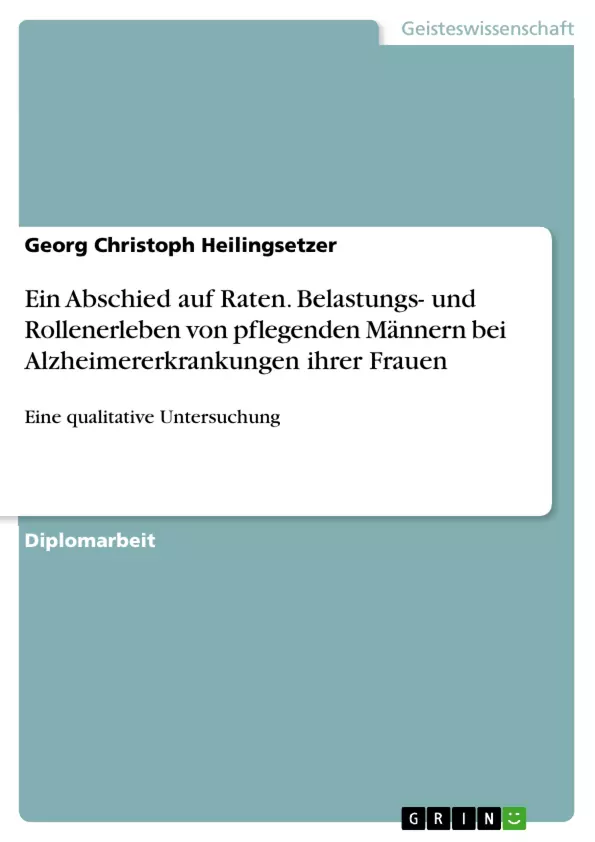Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich nach der themenmäßigen Hinführung im ersten Abschnitt im empirischen Teil im Wesentlichen mit der Alzheimererkrankung von Frauen und ihren Folgen für die langjährige Paarbeziehung und die männlichen Angehörigen respektive Ehemänner, die die Pflege ihrer Frauen übernommen haben. Es wird sich zeigen, dass Forschung zum Mann als Pfleger seiner Frau einerseits angesichts der geringen Anzahl bisher erbrachter Erkenntnisse (vgl. Ducharme et al., 2006, S. 569), andererseits im Hinblick auf zukünftige Szenarien, die von einer deutlichen Erhöhung der Anzahl pflegender männlicher Angehöriger ausgehen, durchaus eine manifeste Berechtigung hat, ja sogar unabdingbar ist. Forschung, die in die Tiefe zu gehen versucht und ein differenziertes Bild der Welt dieser Männer zeichnen und auch Verständnis für ihr komplexes Belastungserleben schaffen will.
Inhaltsverzeichnis
- I. THEORETISCHER TEIL
- VORWORT
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 Themenstellung und Forschungsfragen
- 1.2 Stand der Wissenschaft
- 1.3 Arbeitsweise
- 1.4 Textkritische Hinweise
- 1.5 Einführung
- 2. DEMOGRAPHISCHE ENTWICKLUNGEN
- 2.1 Zukünftige demographische Entwicklungen in Österreich
- 2.2 Der Maulwurf der Demographie - Allgemeine Entwicklungen
- 3. RECHTLICHE UND FINANZIELLE RAHMENBEDINGUNGEN DER PFLEGE
- 3.1 Die Pflege in Österreich
- 3.2 Das System des Pflegegeldes in Österreich
- 3.3 Die Pflegeversicherung: ein besseres System?
- 3.4 Das Case Management
- 3.5 Die österreichische Sachwalterschaft
- 4. EPIDEMIOLOGIE DER DEMENZEN
- 4.1 Die Prävalenz
- 4.2 Die Inzidenz
- 4.3 Die Lebenserwartung
- 4.4 Epidemiologische Daten für Österreich und Europa
- 5. DIE DEMENZ
- 5.1 Das Gedächtnis
- 5.2 Zum Begriff der Demenz
- 5.3 Definitionen der Demenz
- 5.4 Demenzformen
- 5.4.1 Primäre Demenzen
- 5.4.2 Sekundäre Demenzen
- 6. ALZHEIMER: ÄTIOLOGIE, RISIKOFAKTOREN UND DIAGNOSTIK
- 6.1 Ätiologie von Alzheimer
- 6.2 Risikofaktoren und Prävention bei Alzheimer
- 6.3 Diagnostik bei Alzheimer
- 6.3.1 Obligatorische und optionale Diagnoseschritte
- 6.3.2 Einfache diagnostische Verfahren: MMSE, Uhrentest und GDS¹
- 6.4 Einige Bemerkungen zur Differenzialdiagnostik
- 6.4.1 Die Leichte Kognitive Beeinträchtigung
- 6.4.2 Die Depression und andere psychotische Symptome
- 7. THERAPIEFORMEN BEI DEMENZIELLEN ERKRANKUNGEN
- 7.1 Medikamentöse Therapie
- 7.2 Nicht-medizinische Therapie
- 7.2.1 Neuropsychologische Interventionen
- 7.2.2 Kognitive Aktivierung
- 7.2.2.1 Das Realitäts-Orientierungs-Training (ROT)
- 7.2.2.2 Das multimodale Gedächtnistraining
- 7.2.2.3 Die Validation
- 7.2.2.4 Die Selbst-Erhaltungs-Therapie (SET)
- 7.2.3 Andere Therapiebausteine
- 7.3 Psychotherapie
- 7.3.1 Verhaltenstherapie
- 7.3.2 Psychoanalytische Verfahren
- 7.3.3 Musiktherapie und andere kreative Therapieformen
- 7.4 Einige ethische Aspekte
- 8. DAS PSYCHOSOZIALE ANGEBOT FÜR ANGEHÖRIGE
- 8.1 Die Angehörigenberatung
- 8.2 Die Angehörigengruppe als Katalysator
- 8.3 Die psychotherapeutische Intervention
- 8.4 Die Tageszentren
- 8.5 Das Engagement Freiwilliger
- 9. DIE PERSÖNLICHKEIT IM ALTER
- 9.1 Die Konstrukte Persönlichkeit, Rolle und Identität
- 9.2 Die Big Five der Persönlichkeit
- 9.3 Das erfolgreiche Altern als subjektive Realität
- 9.4 Andere Modelle zum Altern
- 9.5 Ein kleiner Exkurs: das Alter im Spiegel der ethnologischen Forschung
- 9.6 Altersgemäße Veränderungen der Persönlichkeit
- 9.7 Von der prämorbiden zur postmorbiden Persönlichkeit und ihrem Verhalten
- 10. DIE LANGJÄHRIGE PAARBEZIEHUNG
- 10.1 Die Bedeutung von Reziprozität
- 10.2 Mit dem Rucksack in die Ehe
- 10.3 Die späte Paarbeziehung und Demenz
- 11. DAS GESCHLECHT
- 11.1 Sex
- 11.2 Gender
- 11.3 Sex und Gender
- 12. DIMENSIONEN DER PFLEGE
- 12.1 Die veränderte Rollenverteilung
- 12.2 Motive für die Übernahme der Pflege
- 12.3 Der Mann als Pfleger
- 12.4 Der Habitus als mögliche Dimension der Pflege
- 12.5 Die Persönlichkeit des Pflegers
- 13. DIE LAST DER SITUATION
- 13.1 Stadien familiärer Anpassung
- 13.1.1 Die Verleugnung
- 13.1.2 Das Überengagement
- 13.1.3 Die Wut
- 13.1.4 Die Schuld
- 13.1.5 Das Annehemen
- 13.2 Zum Begriff Belastung
- 13.3 Die Belastungsproben des Alters und der Demenz
- 13.3.1 Das Alter: ein Lebensabschnitt neuer Belastungen
- 13.3.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede
- 13.3.3 Die Lebensqualität sinkt
- 13.3.4 Eine permanente Verlusterfahrung
- 13.4 Stress und Coping
- 13.4.1 Zum Begriff Stress
- 13.4.2 Stress und Coping im Modell
- 13.4.3 Das Stress-Prozess-Modell für pflegende Angehörige
- 13.5 Einige Ergebnisse zu Belastungen und Stress
- II. EMPIRISCHER TEIL
- 1. DIE ERHEBUNG
- 1.1 Einige Bemerkungen zum qualitativen Interview
- 1.1.1 Die Gütekriterien qualitativer Untersuchungen
- 1.1.2 Das psychotherapeutische Erstinterview
- 1.1.3 Das themenzentrierte Interview
- 1.2 Die Interviews mit den pflegenden Männern
- 1.2.1 Die Leitfadenkonstruktion
- 1.2.2 Die Wahl der Interviewpartner
- 1.2.3 Die Durchführung der Interviews
- 1.2.4 Die Interviewpartner: eine kleine Statistik
- 1.2.5 Einige Charakteristika der einzelnen pflegenden Männer – Kurzbiographien
- 1.2.6 Die Postskripterstellung
- 1.3 Das Experteninterview
- 2. DIE AUSWERTUNG
- 2.1 Die Transkription
- 2.1.1 Das angewandte Transkriptionsregelsystem
- 2.2 Auswertungsmethode
- 2.2.1 Die Methode der tiefenhermeneutischen Textinterpretation
- 2.2.2 Das forschungspraktische Vorgehen bei der Auswertung
- 2.3 Einige psychoanalytische Begriffe
- 3. DARSTELLUNG UND INTERPRETATION DES MATERIALS
- 3.1 Die subjektive Bedeutung der Pflege der demenzkranken Frau
- 3.2 Die Erkrankung
- 3.2.1 Die schwierige Suche nach dem Beginn oder: „Es fällt einem nicht so sehr auf am Anfang...“
- 3.2.2 Die Verleugnung und das Nichtwahrhabenwollen
- 3.2.3 Die eigenen Gefühle verdrängt man(n) lieber
- 3.2.4 Die Suche nach der Ursache - Wissen und subjektive Theorien
- 3.2.5 Zeitpunkt der Diagnose und Reaktionen
- 3.2.6 Die Hoffnung
- 3.2.7 Die Medikamente
- 3.2.8 Die luziden Momente
- 3.2.9 Die Retrogenese
- 3.3 Die Rolle als Pfleger
- 3.3.1 „Sie werden durch die Hölle gehen...“
- 3.3.2 Die Lerneffekte
- 3.3.3 Der Haushalt
- 3.3.4 Die Körperpflege
- 3.3.5 „Sie sind ein Engel...“ – Verschiedene Aspekte von Anerkennung
- 3.3.6 Das Schicksal annehmen - Oder doch nicht: „Aber ich würde anders leben, wenn ich könnte...“
- 3.3.7 Mann oder Frau: Wem liegt die Pflegerolle mehr?
- 3.3.8 Bandbreite der Emotionen und Maß der Emotionalität bei den Pflegern
- 3.3.9 Die Wahrnehmung der Ehefrau: ihr Denken und Fühlen
- 3.4 Die Belastungen
- 3.4.1 Das Finanzielle
- Die Rolle des Mannes als Pfleger in der Paarbeziehung
- Belastungen und Herausforderungen, die mit der Pflege demenzkranker Frauen verbunden sind
- Die subjektiven Erfahrungen und Bewältigungsstrategien pflegender Männer
- Die Bedeutung von Geschlecht und Gender in der Pflege von Demenzkranken
- Die psychologischen und sozialen Auswirkungen der Demenzerkrankung auf die Familien
- Kapitel 1: Einleitung: Die Diplomarbeit stellt die Forschungsfrage und den wissenschaftlichen Hintergrund dar.
- Kapitel 2: Demographische Entwicklungen: Die Arbeit betrachtet die demographische Entwicklung in Österreich und die steigende Anzahl von Demenzerkrankungen.
- Kapitel 3: Rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen der Pflege: Die Arbeit beleuchtet das österreichische Pflegesystem und die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen.
- Kapitel 4: Epidemiologie der Demenzen: Die Arbeit beschäftigt sich mit der Prävalenz, Inzidenz und Lebenserwartung von Demenzpatienten in Österreich und Europa.
- Kapitel 5: Die Demenz: Die Arbeit definiert den Begriff Demenz und beleuchtet verschiedene Demenzformen.
- Kapitel 6: Alzheimer: Ätiologie, Risikofaktoren und Diagnostik: Die Arbeit erläutert die Ätiologie der Alzheimer-Erkrankung, Risikofaktoren und gängige diagnostische Verfahren.
- Kapitel 7: Therapieformen bei Demenz: Die Arbeit präsentiert verschiedene Therapieformen, sowohl medikamentös als auch nicht-medizinisch, die bei Demenzerkrankungen eingesetzt werden.
- Kapitel 8: Das psychosoziale Angebot für Angehörige: Die Arbeit beleuchtet das psychosoziale Angebot für Angehörige von Demenzkranken, einschließlich Beratung, Selbsthilfegruppen und Tageszentren.
- Kapitel 9: Die Persönlichkeit im Alter: Die Arbeit betrachtet die Konstrukte Persönlichkeit, Rolle und Identität im Alter und analysiert die Big Five der Persönlichkeit.
- Kapitel 10: Die langjährige Paarbeziehung: Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Reziprozität und die Herausforderungen, die mit der späten Paarbeziehung und Demenz verbunden sind.
- Kapitel 11: Das Geschlecht: Die Arbeit analysiert den Einfluss von Geschlecht und Gender auf die Pflege von Demenzkranken.
- Kapitel 12: Dimensionen der Pflege: Die Arbeit betrachtet verschiedene Aspekte der Pflege, wie die veränderte Rollenverteilung und die Motive für die Übernahme der Pflege.
- Kapitel 13: Die Last der Situation: Die Arbeit beschäftigt sich mit den Belastungen, die pflegenden Angehörigen durch die Demenzerkrankung ihrer Partnerinnen entstehen, und mit den entsprechenden Bewältigungsmechanismen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem Belastungs- und Rollenerleben von pflegenden Männern bei Demenzerkrankungen ihrer Frauen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Männer mit den Herausforderungen der Pflege ihrer Partnerinnen im Kontext der Alzheimer-Erkrankung umgehen. Die Arbeit analysiert die subjektiven Erfahrungen und Perspektiven dieser Männer, um ein tieferes Verständnis für ihre psychosoziale Situation zu gewinnen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themenbereiche Demenz, Alzheimer, Pflege, Angehörige, Belastung, Rollenverständnis, Geschlecht, Paarbeziehung und subjektives Erleben. Im Fokus stehen die Erfahrungen von Männern, die ihre demenzkranken Partnerinnen pflegen. Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss der Erkrankung auf die Familien und die psychosozialen Herausforderungen, denen pflegende Angehörige gegenüberstehen.
Häufig gestellte Fragen
Wie erleben Männer die Rolle als Pfleger ihrer demenzkranken Frauen?
Männer erleben oft einen „Abschied auf Raten“ und einen massiven Rollenwechsel, bei dem sie Aufgaben in Haushalt und Körperpflege übernehmen, die sie zuvor oft nicht hatten.
Was sind die größten Belastungen für pflegende Ehemänner?
Neben der körperlichen Anstrengung sind es vor allem die emotionale Isolation, die Verdrängung eigener Gefühle und der Verlust der gewohnten Paardynamik.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in der Pflege?
Männer neigen oft dazu, die Pflege eher als „Managementaufgabe“ zu betrachten oder ihre Emotionen stärker zu kontrollieren, leiden aber ebenso unter hoher psychischer Last.
Welche psychosozialen Hilfen gibt es für pflegende Angehörige?
Dazu gehören Angehörigenberatung, Selbsthilfegruppen, psychotherapeutische Interventionen und Entlastungsangebote wie Tageszentren.
Was bedeutet „Validation“ in der Demenzpflege?
Eine Kommunikationsmethode, bei der man die Gefühle und die subjektive Realität des Demenzkranken akzeptiert und wertschätzt, statt ihn zu korrigieren.
- Citar trabajo
- MMag. Georg Christoph Heilingsetzer (Autor), 2007, Ein Abschied auf Raten. Belastungs- und Rollenerleben von pflegenden Männern bei Alzheimererkrankungen ihrer Frauen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85826