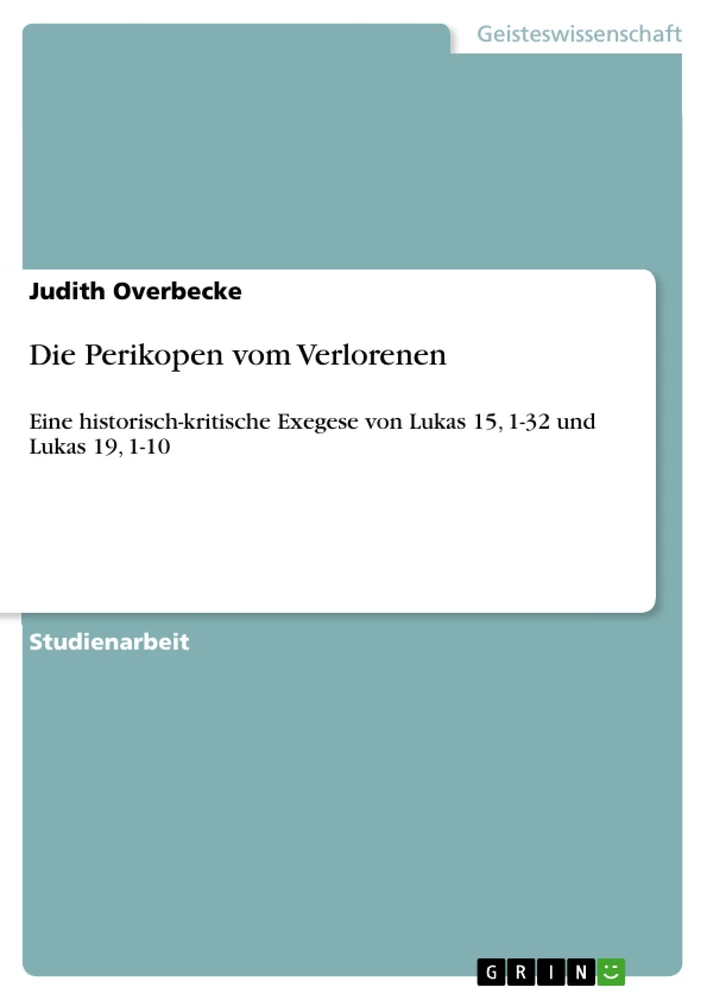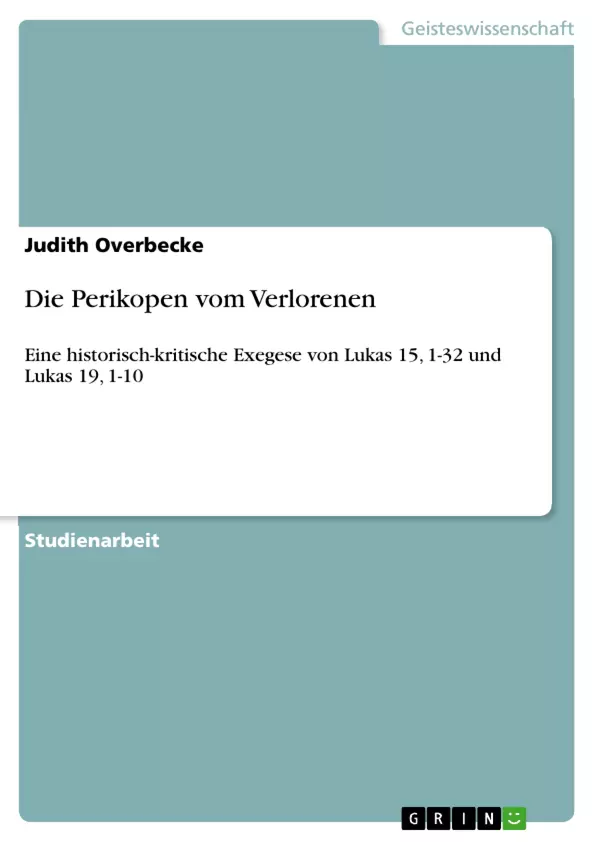Im Folgenden mache ich mir zur Aufgabe, die so bekannten Perikopen vom Verlorenen (Lk 15, Vom verlorenen Schaf, Von der Verlorenen Drachme, Vom verlorenen Sohn und Lk 19,1-10, Zachäus) historisch-kritisch zu untersuchen, also einmal anders zu beleuchten, als sie aus Grundschule und Kindergottesdienst bekannt sind.
In dieser Arbeit möchte ich die Zweiquellentheorie, die letztendlich auch nur Hypothese ist, zu Grunde legen. Sie besagt, dass das Markusevangelium sowohl Matthäus als auch Lukas als Quelle vorgelegen hat. Damit ist Markus das älteste Evangelium. Lukas und Matthäus haben zudem unabhängig voneinander die so genannte Logienquelle Q verwendet, die Markus unbekannt war. Außerdem haben Lukas und Matthäus so genanntes Sondergut benutzt, Überlieferungsstoff, der nur jeweils einem von ihnen vorgelegen hat.
Ich werde so vorgehen, dass ich die wesentlichen Methodenschritte der neutestamentlichen historisch-kritischen Exegese, Textkritik, Literarkritik, Formkritik und Redaktionskritik zuerst für Lukas 15, im Anschluss bezogen auf Lk 19,1-10 nacheinander abhandeln werde. Überschneidungen werden sich dabei allerdings nicht vermeiden lassen. Abschließend soll eine zusammen schauende Schlussbetrachtung vorgenommen werden. Am Anfang einer Exegese gilt es, die ursprüngliche Textgestalt oder die älteste erreichbare Textgestalt wiederherzustellen und eine Übersetzung des griechischen Textes vorzunehmen .
Dies soll hier vorerst anhand des 15. Kapitels des Lukasevangeliums geschehen.
Weil die Perikopen Vom verlorenen Schaf (VV 15, 4-7), Von der verlorenen Drachme (VV 15,9-10) und Vom verlorenen Sohn (VV 15, 11-32) mir aufgrund der Einleitung (VV 15,1-3), die die Situation beschreibt, in der alle drei Gleichnisse „gesprochen“ werden, als zusammenhängend erscheinen , werde ich sie hier nicht aufspalten, sondern zusammen mit ihrer Einleitung als Ganzes darstellen.
Bei meiner Überprüfung dieses Kapitels mit Hilfe des Textkritischen Apparates der 27. Auflage des Nestle-Aland schien mir aufgrund der Kriterien der Äußeren Textkritik, die, um die ursprüngliche Form eines Textes wiederzugewinnen, nach Alter, Qualität und Quantität der eine Textgestalt überliefernden Handschriften fragt, zunächst der im Nestle-Aland abgedruckte Text übernommen werden zu können, weil dieser den Text der besten und ältesten Zeugen darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lukas 15, 1-32
- Textkritik
- Äußere Textkritik
- Innere Textkritik
- Ein weiteres Beispiel zur Textkritik
- Die Übersetzung
- Literarkritik
- Einleitungsfragen
- Kontext, Quellen und synoptischer Vergleich
- Abgrenzung
- Literarische Analyse
- Gliederung
- Wortfeldanalyse
- Formkritik
- Traditionsgeschichte
- Rückfrage nach dem ursprünglichen Jesusgut, Funktion und Sitz im Leben
- Redaktionskritik und Traditionskritik
- Redaktion und Tradition von Lukas 15
- Komposition und Intention des Lukas
- Textkritik
- Lukas 19, 1-10
- Der Text
- Literarkritik
- Abgrenzung
- Literarische Analyse
- Einheitlichkeit
- Gliederung
- Wortfeldanalyse
- Tradition und Redaktion
- Formkritik
- Gattungs- und Überlieferungsgeschichte, Sitz im Leben (und Redaktion)
- Zur Besonderheit der Zachäusperikope
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Perikopen vom Verlorenen (Lukas 15, 1-32 und Lukas 19, 1-10) historisch-kritisch zu untersuchen und sie in einem neuen Licht darzustellen, abweichend von der bekannten Interpretation in Grundschule und Kindergottesdienst.
- Anwendung der neutestamentlichen historisch-kritischen Exegese (Textkritik, Literarkritik, Formkritik, Redaktionskritik)
- Analyse der literarischen Struktur und des Kontextes der Perikopen
- Untersuchung der Überlieferungstradition und der redaktionellen Bearbeitung der Texte
- Interpretation der theologischen Aussagen der Perikopen
- Vergleich der Perikopen im Kontext des Lukasevangeliums
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 analysiert Lukas 15, 1-32, beginnend mit der Textkritik, die die ursprüngliche Textgestalt wiederherstellen soll. Anschließend werden die literarische Struktur, der Kontext und die Überlieferungstradition untersucht. Die Formkritik analysiert die Gattung und die Funktion der Gleichnisse im Leben der frühen Christen. Schließlich werden die redaktionellen Bearbeitung und die Intention des Lukas diskutiert.
Kapitel 3 untersucht Lukas 19, 1-10, die Perikope vom Zöllner Zachäus. Die Textkritik, die Literarkritik, die Tradition und Redaktion sowie die Formkritik werden im Detail betrachtet. Besonderheiten der Zachäusperikope im Vergleich zu den anderen Perikopen vom Verlorenen werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die historisch-kritische Exegese, Textkritik, Literarkritik, Formkritik, Redaktionskritik, Lukas 15, 1-32, Lukas 19, 1-10, Perikopen vom Verlorenen, Gleichnisse, Zöllner Zachäus, Überlieferungstradition, redaktionelle Bearbeitung, theologische Aussagen, Kontext des Lukasevangeliums.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die "Perikopen vom Verlorenen"?
Es handelt sich um biblische Erzählungen im Lukasevangelium (Kapitel 15 und 19), darunter das Gleichnis vom verlorenen Schaf, der verlorenen Drachme und dem verlorenen Sohn sowie die Geschichte von Zachäus.
Was ist historisch-kritische Exegese?
Eine wissenschaftliche Methode zur Auslegung biblischer Texte, die deren ursprüngliche Entstehung, Quellen und die Absicht des Autors (Redaktionskritik) untersucht.
Was besagt die Zweiquellentheorie?
Diese Hypothese nimmt an, dass Lukas und Matthäus das Markusevangelium und eine gemeinsame Logienquelle (Q) als Vorlagen für ihre Evangelien nutzten.
Welche theologische Aussage hat Lukas 15?
Die Kapitel betonen Gottes Freude über die Umkehr eines Sünders und kritisieren die ablehnende Haltung derer, die sich selbst für gerecht halten.
Wer war Zachäus im Lukasevangelium?
Zachäus war ein Oberzöllner in Jericho, dessen Begegnung mit Jesus in Lukas 19 als Beispiel für die Rettung des "Verlorenen" dargestellt wird.
- Quote paper
- Judith Overbecke (Author), 2006, Die Perikopen vom Verlorenen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85849