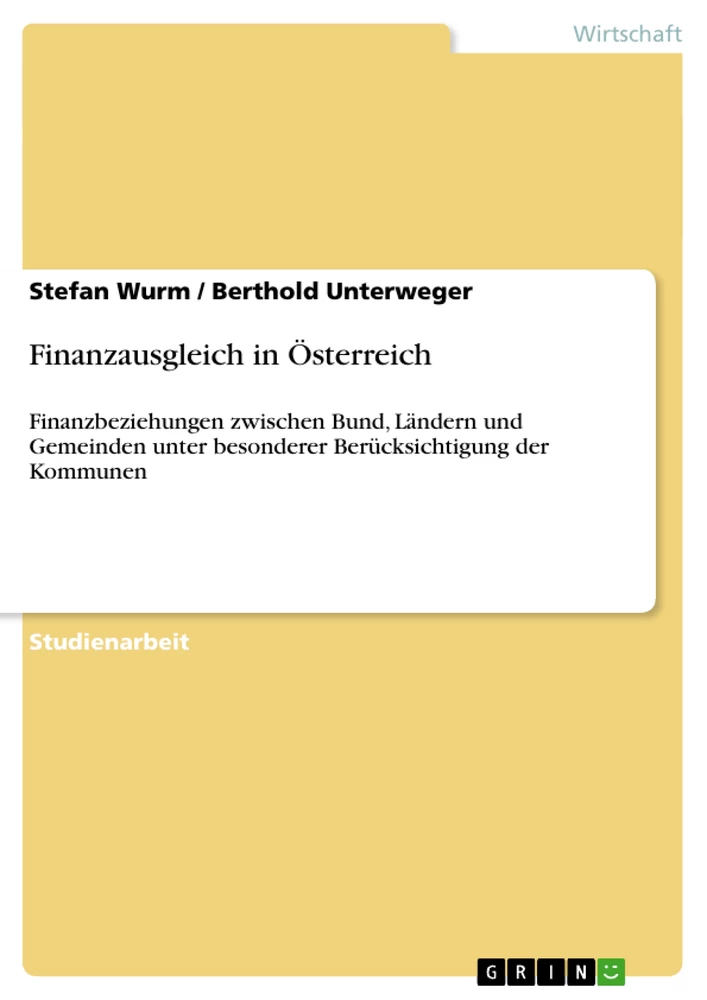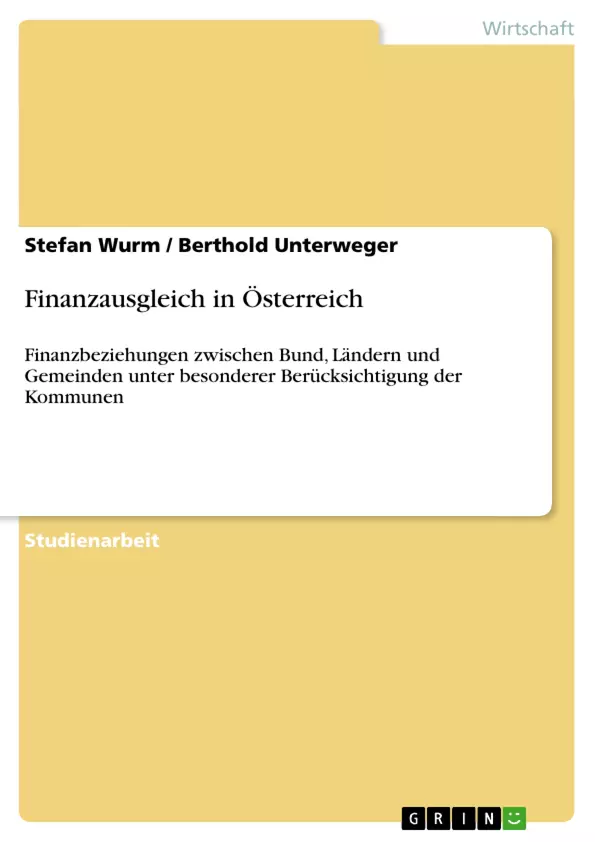Die Finanzverfassung sowie der Finanzausgleich stellen wesentliche Grundlagen für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben dar.
Verstanden wird dabei, bei umfassender Betrachtung, die Regelung der Aufgaben- und Ausgabenverteilung sowie die Verteilung der Mittel zur Finanzierung der Ausgaben auf die einzelnen Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden).
Im engeren Sinn wird dabei von der Verteilung der Steuerhoheit (eigene Abgaben) und der Ertragshoheit (Steuerverbund) inklusive verschiedener Transfers, wie beispielsweise Vorwegbezüge, Zuweisungen, Umlagen bei gegebener Kompetenzlage gesprochen.
Diese Seminararbeit liefert Informationen zum Finanzausgleich und stellt die Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden dar. Zunächst geben theoretische Erläuterungen Aufschluss über die Notwendigkeit des Finanzausgleichs in der Finanzmittelverteilung. Die zugehörige Aufteilungspolitik der finanziellen Ressourcen wird separat beschrieben. Beschrieben werden des Weiteren, die Arten des Finanzausgleichs (horizontal/vertikal; aktiv/passiv).
Schwerpunktmäßig dargestellt wird auch die realpolitische Abwicklung in Österreich unter den derzeitig geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen.
Da beim Finanzausgleich immer wieder Probleme, insbesondere für die kleineren Gebietskörperschaften (Gemeinden, Gemeindeverbände etc.), auftreten, werden diese anhand der aktuellen Situation im kommunalen Sektor erläutert und verschiedene Lösungsmodelle aus der wissenschaftlichen Literatur präsentiert.
Teilaspekte des Finanzausgleichs 2005 sowie die gegenwärtigen Entwicklungen aus der Sicht der kommunalen Ebene und wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen runden diese Seminararbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Abstract
- Einleitung
- Fragestellungen und Ziele der Arbeit
- Rechtliche Grundlagen und Prinzipien des österreichischen Finanzausgleichs
- Arten des Finanzausgleichs
- Aktiver Finanzausgleich
- Passiver Finanzausgleich
- Vertikaler Finanzausgleich
- Horizontaler Finanzausgleich
- Grundlagen, Grundprinzipien und vertikale Einnahmenzuteilung
- Möglichkeiten vertikaler Einnahmenzuteilung
- Trennsystem
- Verbundsystem
- Zuschlagssystem
- Zuweisungssystem
- Mischsystem
- Möglichkeiten vertikaler Einnahmenzuteilung
- Ablauf des österreichischen Finanzausgleichs
- Abgabenwesen des FAG
- Oberverteilung gem. § 9 FAG 2005
- Unterverteilung
- Transfers und Zuschüsse
- Sonderfall Wien
- Generelle Entwicklung der Einnahmen der Gemeinden aus dem Finanzausgleich
- Finanzausgleichs aus Sicht österreichischer Kommunen
- Finanzausgleich - Schwerpunkt Kommunen
- Auswirkungen des FAG 2005 auf die Kommunen
- Wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert den österreichischen Finanzausgleich, die Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, und beleuchtet dessen Auswirkungen auf die Kommunen. Die Arbeit zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über den Ablauf des Finanzausgleichs, seine rechtlichen Grundlagen und seine Herausforderungen zu bieten.
- Rechtliche Grundlagen und Prinzipien des österreichischen Finanzausgleichs
- Arten des Finanzausgleichs (aktiv/passiv, vertikal/horizontal)
- Ablauf des österreichischen Finanzausgleichs und seine praktische Umsetzung
- Der Finanzausgleich aus der Perspektive der österreichischen Kommunen
- Wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Ziel der Arbeit: die Darstellung der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sowie den Ablauf des Finanzausgleichs in Österreich, mit besonderem Fokus auf die Sicht der österreichischen Kommunen und abschließenden wirtschaftspolitischen Schlussfolgerungen.
Arten des Finanzausgleichs: Dieses Kapitel differenziert zwischen aktivem und passivem sowie vertikalem und horizontalem Finanzausgleich. Es legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis der verschiedenen Mechanismen der Finanzmittelverteilung dar und bereitet den Leser auf die detailliertere Betrachtung des österreichischen Systems vor. Die verschiedenen Arten des Finanzausgleichs werden systematisch erklärt und voneinander abgegrenzt.
Grundlagen, Grundprinzipien und vertikale Einnahmenzuteilung: Dieses Kapitel behandelt die fundamentalen Prinzipien der vertikalen Einnahmenzuteilung und untersucht verschiedene Modelle wie Trenn-, Verbund-, Zuschlags-, Zuweisungs- und Mischsysteme. Es analysiert die Vor- und Nachteile jedes Systems im Kontext der österreichischen Finanzarchitektur und beleuchtet deren Auswirkungen auf die Ressourcenverteilung zwischen den verschiedenen Regierungsebenen.
Ablauf des österreichischen Finanzausgleichs: Dieses Kapitel beschreibt den detaillierten Ablauf des österreichischen Finanzausgleichs, inklusive Abgabenwesen, Ober- und Unterverteilung sowie Transfers und Zuschüsse. Es beleuchtet den Sonderfall Wien und analysiert die generelle Entwicklung der Einnahmen der Gemeinden. Die verschiedenen Stufen des Prozesses, von der Erhebung der Steuern bis zur Verteilung an die Gemeinden, werden präzise dargestellt und durch konkrete Beispiele veranschaulicht. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die verschiedenen Arten der Abgaben und ihre Verteilung gelegt.
Finanzausgleichs aus Sicht österreichischer Kommunen: Dieses Kapitel widmet sich der Perspektive der österreichischen Kommunen auf den Finanzausgleich. Es analysiert die Auswirkungen des Finanzausgleichs auf die Gemeindehaushalte und -investitionen, beleuchtet Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze. Der Fokus liegt auf den konkreten Erfahrungen der Gemeinden und den daraus resultierenden politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen. Die Kapitel diskutiert kritische Punkte und gibt einen Einblick in die Herausforderungen, denen sich die Kommunen im Umgang mit dem Finanzausgleich gegenübersehen.
Schlüsselwörter
Finanzausgleich, Österreich, Bund, Länder, Gemeinden, Finanzbeziehungen, vertikaler Finanzausgleich, horizontaler Finanzausgleich, aktiver Finanzausgleich, passiver Finanzausgleich, Steuerhoheit, Ertragshoheit, Transfers, Gemeindehaushalte, kommunale Investitionen, Wirtschaftspolitik.
Häufig gestellte Fragen zum österreichischen Finanzausgleich
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert den österreichischen Finanzausgleich, die Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, und beleuchtet dessen Auswirkungen auf die Kommunen. Sie bietet einen umfassenden Überblick über den Ablauf des Finanzausgleichs, seine rechtlichen Grundlagen und seine Herausforderungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen Grundlagen und Prinzipien des österreichischen Finanzausgleichs, die verschiedenen Arten des Finanzausgleichs (aktiv/passiv, vertikal/horizontal), den Ablauf des Finanzausgleichs und seine praktische Umsetzung, den Finanzausgleich aus der Perspektive der österreichischen Kommunen und schließlich wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen.
Welche Arten des Finanzausgleichs werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen aktivem und passivem sowie vertikalem und horizontalem Finanzausgleich. Die verschiedenen Arten werden systematisch erklärt und voneinander abgegrenzt.
Wie ist der Ablauf des österreichischen Finanzausgleichs?
Das Kapitel zum Ablauf beschreibt den detaillierten Prozess, inklusive Abgabenwesen, Ober- und Unterverteilung, Transfers und Zuschüsse. Es beleuchtet den Sonderfall Wien und analysiert die generelle Entwicklung der Einnahmen der Gemeinden. Der Prozess wird von der Steuererhebung bis zur Verteilung an die Gemeinden präzise dargestellt.
Welche Modelle der vertikalen Einnahmenzuteilung werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht verschiedene Modelle der vertikalen Einnahmenzuteilung, darunter Trenn-, Verbund-, Zuschlags-, Zuweisungs- und Mischsysteme. Die Vor- und Nachteile jedes Systems im Kontext der österreichischen Finanzarchitektur und deren Auswirkungen auf die Ressourcenverteilung werden analysiert.
Wie wird der Finanzausgleich aus der Sicht der österreichischen Kommunen betrachtet?
Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen des Finanzausgleichs auf die Gemeindehaushalte und -investitionen, beleuchtet Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze aus der Perspektive der Kommunen. Der Fokus liegt auf den konkreten Erfahrungen der Gemeinden und den daraus resultierenden politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Finanzausgleich, Österreich, Bund, Länder, Gemeinden, Finanzbeziehungen, vertikaler Finanzausgleich, horizontaler Finanzausgleich, aktiver Finanzausgleich, passiver Finanzausgleich, Steuerhoheit, Ertragshoheit, Transfers, Gemeindehaushalte, kommunale Investitionen, Wirtschaftspolitik.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über den Ablauf des Finanzausgleichs, seine rechtlichen Grundlagen und seine Herausforderungen zu bieten, insbesondere aus der Sicht der österreichischen Kommunen.
- Quote paper
- Stefan Wurm (Author), Berthold Unterweger (Author), 2005, Finanzausgleich in Österreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85850