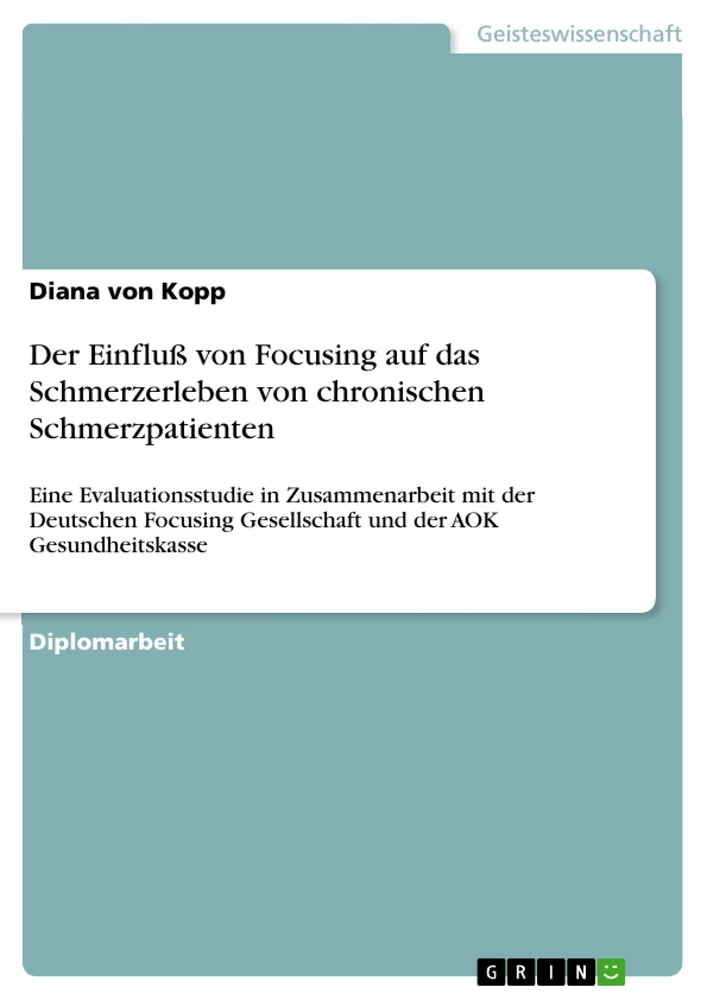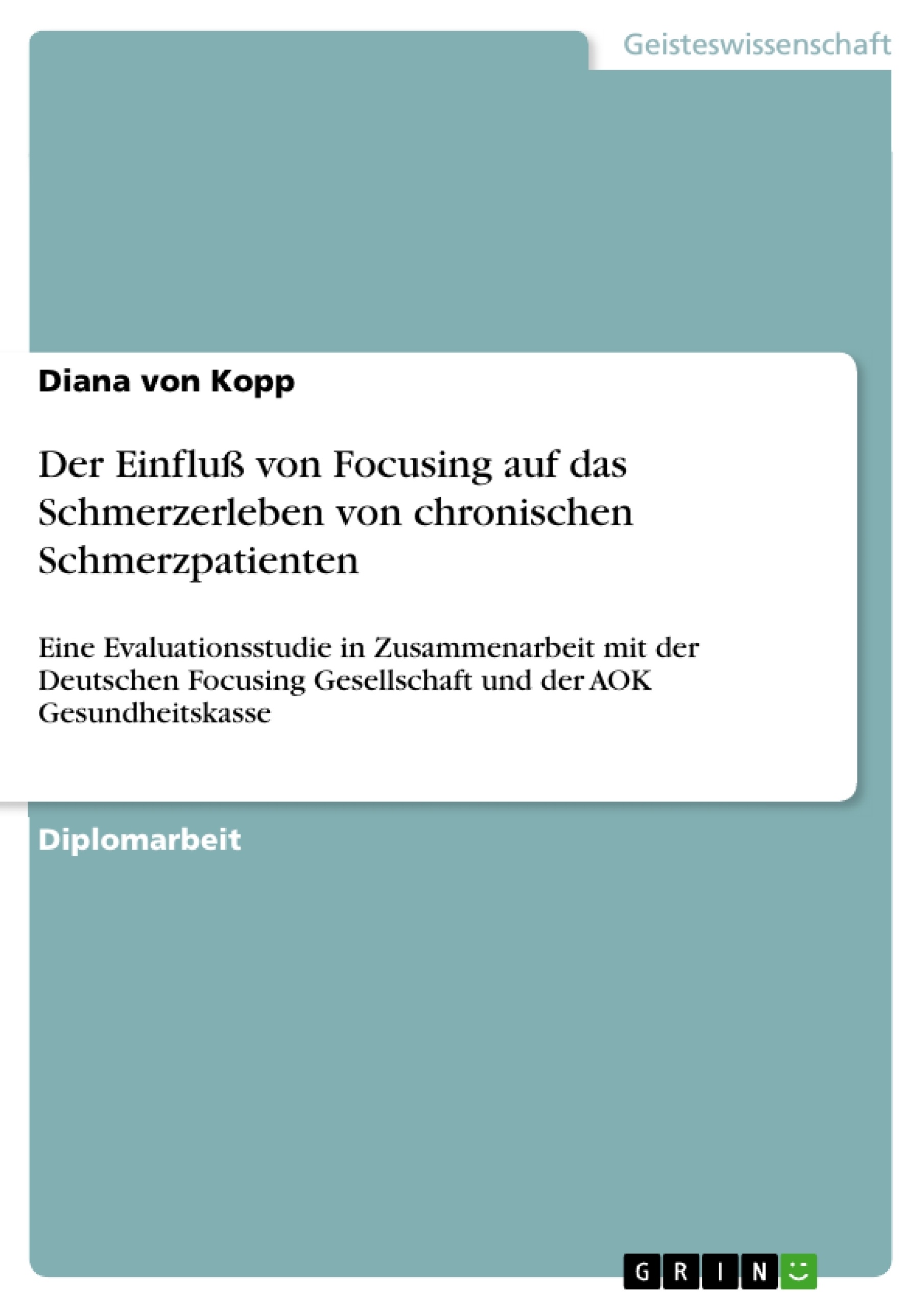In Deutschland leiden 5 – 8 Millionen Menschen an chronischen Schmerzen.
Wie eine Studie herausfand, welche die International Association for the Study of Pain in Auftrag gab, leidet sogar jeder dritte Patient in Allgemeinarztpraxen an Schmerzen, die bereits länger als 6 Monate andauern. Schmerzbedingte Arbeitsausfälle belaufen sich dabei auf 40 Milliarden Euro. Die häufigsten Beschwerden sind Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Tumorschmerzen und rheumatische Beschwerden.
Chronische Schmerzpatienten haben ihre eigene persönliche Schmerzgeschichte. Nicht selten haben sie eine Vielfalt von medikamentösen Therapieversuchen, schmerzhaften Operationen und anderen fehlgeschlagen Heilungsversuchen hinter sich. Vorschläge der Therapieform kamen dabei meist durch den behandelnden Arzt. Im günstigsten Fall wurde der Patient in die Therapieplanung mit einbezogen. Neben logischen Begründungen zum Für und Wider einzelner Interventionen gab es sicherlich eine intuitive Wahrnehmung der Angemessenheit der jeweiligen Therapie im Patienten selbst. Fraglich ist und bleibt jedoch inwieweit Raum vorhanden ist, auf diese Intuitionen einzugehen. Focusing stellt an diesem Ansatzpunkt eine Methode dar, die es ermöglicht, mit den eigenen Selbstheilungskräften in Kontakt zu treten. Die Aufmerksamkeit auf das Körpererleben als Ganzes führt zu Antworten, die auf logischem und analytischem Wege nicht möglich wären. Diese neue Erfahrung des Erlebens stärkt das Vertrauen in die eigenen Kräfte. Dies ist ganz im Sinne einer salutogenetischen Sichtweise, wonach ein hohes Gefühl der Verstehbarkeit, der Handhabbarkeit und der Sinnhaftigkeit persönlicher Lebensaufgaben mit körperlicher Gesundheit korrespondiert. Salutogenese betrachtet Schmerz als Warnsignal des Körpers, der aus seiner Mitte geraten ist. Focusing ermöglicht diesem Schmerz oder dem Symptom im Allgemeinen, zu „sprechen“. Herkömmliche Medizin bekämpft lediglich das Symptom. Im übertragenen Sinne löscht die pathologisch denkende Medizin den Brandmelder, während in der salutogenetisch denkenden Medizin der Brandmelder zum Feuer führt, das es zu löschen gilt. Mit Hilfe von Focusing kann der Patient selbst das Feuer löschen. In der folgenden Arbeit habe ich mir deshalb zur Aufgabe gestellt, die Wirksamkeit von Focusing an chronischen Schmerzpatienten zu überprüfen.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- 1 Problemstellung
- 2 Forschungsstand
- 3 Zielsetzung
- 4 Methodik der Arbeit
- 5 Aufbau der Arbeit
- 6 Begriffserklärungen
- 6.1 Schmerz
- 6.2 Chronischer Schmerz
- 6.3 Salutogenese
- 6.4 Focusing
- II Theoretischer und empirischer Hintergrund
- 1 Definition Schmerz
- 1.1 Chronische Schmerzen
- 1.2 Chronischer Schmerz als Stressor
- 1.3 Schmerzbewältigung
- 2 Sprechende Medizin und ihr Einfluss auf das Gehirn
- 3 Focusing
- 3.1 Exkurs: Biographie Gendlin's
- 3.2 Grundlagen und Thesen einer klientenzentrierten Theorie der gesunden menschlichen Entwicklung
- 3.3 Theorie der Persönlichkeitsentwicklung aus der Sicht klientenzentrierter Persönlichkeitspsychologie
- 3.4 Erleben
- 3.4.1 Strukturgebundenes Erleben und persönliche Entwicklung
- 3.5 Bedeutung unbedingter Wertschätzung im Focusing
- 3.6 Focusing als Prozess
- 3.6.1 Definition von Gendlin
- 3.6.2 Felt sense
- 3.6.3 Felt shift
- 3.7 Die sechs Focusing Schritte
- 3.7.1 Schritt: Freiraum schaffen
- 3.7.2 Schritt/Bewegung: den Felt Sense entstehen lassen
- 3.7.3 Schritt: Einen Griff finden
- 3.7.4 Schritt: Stimmigkeit (Resonanz) zwischen felt sense und Wort/Bild überprüfen
- 3.7.5 Zusammenfassung Schritt 1-4
- 3.7.6 Schritt - Anwendung des felt sense auf das Thema (Fragen stellen)
- 3.7.7 Schritt: Annehmen und Schützen
- 3.7.8 Abschließende Bemerkungen zu den Schritten
- 4 Abgrenzung von Focusing zu anderen Konstrukten
- 5 Entstehung von Schmerz aus der focusing orientierten Sichtweise
- 5.1 Griff-Modell
- 6 Salutogenese
- 6.1 Das Konzept der Salutogenese
- 6.2 Das Gesundheits-Krankheits-Kontinuum
- 6.3 Das Kohärenzgefühl
- 6.4 Einfluss des Kohärenzgefühls auf die Krankheitsverarbeitung
- 6.5 Entwicklung des Kohärenzgefühls
- 6.6 Veränderbarkeit des Kohärenzgefühls
- 6.7 Einfluss des Kohärenzgefühls auf die Gesundheit
- 6.8 Gesundheitliche Kontrollüberzeugungen
- 1 Definition Schmerz
- III Fragestellungen und Hypothesen
- 1 Hypothese zum Kohärenzgefühl
- 2 Hypothese zum affektiven Schmerzempfinden
- 3 Hypothese zum sensorischen Schmerzempfinden
- 4 Hypothese zum Wohlbefinden
- 5 Hypothese zum Bewältigungsstadium
- IV Methoden
- 1 Projektplanung und Datenerhebung
- 2 Soziodemographische Daten der Stichprobe
- 3 Erhebungsinstrumente
- 3. 1 Fragebogen zur Erfassung des Kohärenzgefühls von Antonovsky
- 3.1.1 Übersicht
- 3.1.2 Gütekriterien der Kohärenzskala
- 3.1.2.1 Objektivität
- 3.1.2.2 Reliabilität
- 3.1.2.3 Validität
- 3.2 Der Mehrdimensionale Befindlichkeitsfragebogen (MDBF)
- 3.2.1 Interpretation der MDBF Skalen
- 3.2.1.1 Gute/Schlechte Stimmung
- 3.2.1.2 Wachheit/Müdigkeit
- 3.2.1.3 Ruhe/Unruhe
- 3.2.1 Interpretation der MDBF Skalen
- 3.3 Der Freiburger Fragebogen zu Stadien der Bewältigung chronischer Schmerzen (FF-STABS)
- 3.3.1 Übersicht
- 3.3.2 Stadien der Schmerzbewältigung
- 3.3.2.1 Stadium der Sorglosigkeit
- 3.3.2.2 Stadium der Vorbereitung
- 3.3.2.3 Stadium der Handlung
- 3.3.2.4 Stadium der Aufrechterhaltung
- 3.3.3 Auswertung
- 3.4 Die Schmerzempfindungsskala SES
- 3.4.1 Übersicht
- 3.4.2 Auswertung
- 3.4.3 Gütekriterien
- 3.4.3.2 Reliabilität
- 3.4.3.3 Validität
- 3.5 Offene Fragen
- 3. 1 Fragebogen zur Erfassung des Kohärenzgefühls von Antonovsky
- V. Ergebnisse
- 1 Auswertung
- 1.1 Kohärenzsinn (SOC)
- 1.2 Befindlichkeit
- 1.3 Schmerzempfindungsscala
- 1.3.1 Affektive Schmerzwahrnehmung
- 1.3.2 Sensorische Schmerzwahrnehmung
- 1.4 Bewältigungsstadien
- 1.4.1 Sorglosigkeit
- 1.4.2 Vorbereitung
- 1.4.3 Handlung
- 1.4.4 Aufrechterhaltung
- 1.5 Korrelation Affektive Schmerzempfindung und Sorglosigkeit
- 1.6 Korrelation Affektive Schmerzempfindung und Aufrechterhaltung (t3)
- 1.7 Korrelation Affektive Schmerzempfindung und Aufrechterhaltung (t2)
- 2 Auswertung der Korrelationen
- 3 Gegenüberstellung Schmerzempfindlichkeit und SOC-Mittelwerte
- 3.1 Tabelle zur signifikanten Verbesserung der Schmerzempfindung
- 3.2 Tabelle zur signifikanten Verschlechterung der Schmerzempfindung
- 3.2.1 Subgruppen
- 3.2.1.1 Gruppe 1
- 3.2.1.2 Gruppe 2
- 3.2.1 Subgruppen
- 4 Auswertung der einzelnen Übungen
- 5. Auswertung der offenen Fragen
- 1 Auswertung
- VI Diskussion
- VII Schlussbemerkungen
- 1 Zusammenfassung
- 2.1 Fortschritt gegenüber dem Stand der Forschung
- 2.2 Grenzen
- 2.3 Schwachstellen
- 2.4 Verbesserungsmöglichkeiten
- 3. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Einfluss von Focusing auf das Schmerzerleben von chronischen Schmerzpatienten. Das Ziel ist es, die Wirksamkeit einer Focusing-basierten Schmerzbewältigungsgruppe zu evaluieren und den Zusammenhang zwischen dem Kohärenzgefühl, dem affektiven und sensorischen Schmerzempfinden sowie dem Bewältigungsstadium der Teilnehmer zu analysieren.
- Das Kohärenzgefühl der Patienten
- Die Wirksamkeit von Focusing zur Schmerzbewältigung
- Der Zusammenhang zwischen Focusing, Schmerzempfinden und Bewältigungsstadium
- Die Rolle von Focusing im Kontext der Salutogenese
- Der Einfluss von Focusing auf die affektive und sensorische Schmerzwahrnehmung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der chronischen Schmerzen und den aktuellen Forschungsstand dar. Sie skizziert die Zielsetzung der Arbeit und erläutert die Methodik sowie den Aufbau. In Kapitel II werden die theoretischen und empirischen Grundlagen zu Schmerz, chronischem Schmerz, Salutogenese und Focusing umfassend beleuchtet. Kapitel III formuliert die Fragestellungen und Hypothesen, die in der Untersuchung überprüft werden. Die Methoden und die verwendeten Erhebungsinstrumente werden in Kapitel IV beschrieben. Kapitel V präsentiert die Ergebnisse der Datenauswertung. Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt in Kapitel VI. In den Schlussbemerkungen werden die Ergebnisse zusammengefasst und die Grenzen der Untersuchung sowie mögliche zukünftige Forschungsrichtungen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Chronischer Schmerz, Focusing, Salutogenese, Kohärenzgefühl, Schmerzempfindung, Bewältigung, Schmerzbewältigung, Schmerztherapie, Focusing-basierte Schmerzbewältigungsgruppe.
- Citation du texte
- Diana von Kopp (Auteur), 2007, Der Einfluß von Focusing auf das Schmerzerleben von chronischen Schmerzpatienten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86027