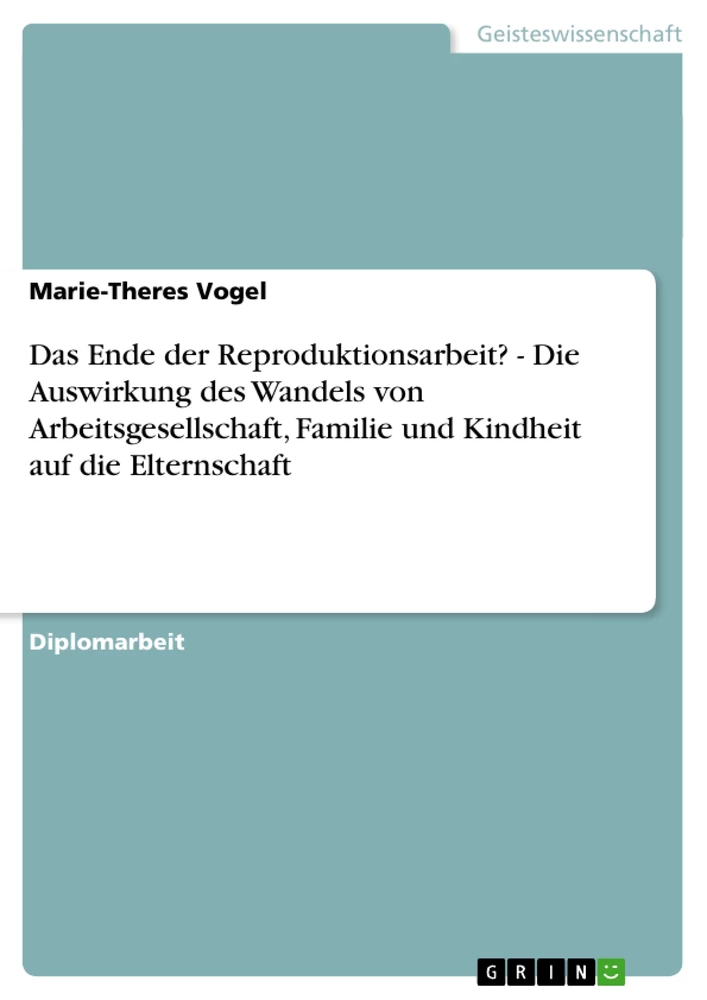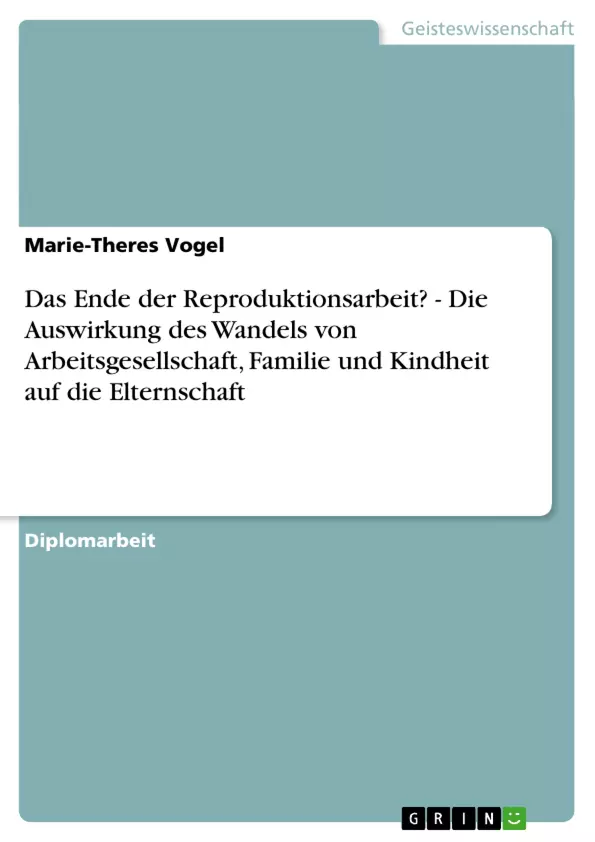Der demographische Wandel ist in Deutschland inzwischen seit einiger Zeit ins Bewusstsein der Menschen gerückt, vor allem als Horrorvision für die Jahre 2030 bis 2050, wenn mit der starken Überalterung ein gravierender Umbau der Bevölkerungszusammensetzung durch einen weiterhin starken Rückgang der Geburtenzahlen und eine erwartungsweise weiterhin steigende durchschnittliche Lebenserwartung intendiert sein wird. Damit werden bereits heute politischerseits gewaltige Einschnitte in das Sozialsystem des deutschen Staates begründet und vor allem Frauen beschworen, wieder mehr Kinder zu bekommen. Der ehemalige Innenminister Otto Schily mag als Beispiel dienen für eine hilflose Rhetorik über die deutsche Kinderarmut: „Kinder sind keine Belastung, sondern eine tiefe Bereicherung für die Eltern und auch für die gesamte Gesellschaft. Eine Absage an Kinder ist eine Absage an das Leben. Wir müssen in Deutschland den Wert von Kindern, von Familien, vom menschlichen Miteinander der Generationen im öffentlichen Bewusstsein stärken. Ohne eine solche offensive Wertedebatte laufen wir Gefahr, dass sich lebensfeindliche, zukunftsverneinende und egoistische Tendenzen in unserer Gesellschaft verstärken“ (BiB 2005, S.3).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. These I: Die Marktökonomie des digitalen Kapitalismus intensiviert die Arbeit, entgrenzt die moderne Arbeitsgesellschaft mit seinen geschlechtsspezifischen Implikationen und ignoriert die reproduktive Arbeit und Leistung von Frauen und Männern - dadurch Privatisierung dieses Problems und den damit verbundenen Kosten jeglicher Art - gleichzeitig nutzt der Markt die reproduktive Arbeit als kostenlose Ressource
- 1.1. Die Arbeitsgesellschaft
- 1.1.1. Was ist Arbeit?
- 1.1.2. Die Arbeitsgesellschaft der Postmoderne
- 1.1.2.1. Arbeit in der Postmoderne.
- 1.1.2.2. Charakteristika der Postmoderne
- 1.1.2.3. Geschlechterentgrenzung und Abwertungsprozesse der Reproduktionsarbeit in der postmodernen Arbeitsgesellschaft
- 1.2. Zusammenhänge zwischen Arbeit und Familie
- 1.2.1. Erwerbsarbeitsbeteiligung von Eltern
- 1.2.2. Arbeit, Elternschaft und Zeit
- 2. These II: Die Familie ist eine brüchige Basis für die heile Welt - Traditionalisierungsschub und Überforderungstendenz des Systems Familie im Spagat zwischen Integrations- und Funktionsaspekt
- 2.1. Was sind Familien?
- 2.2. Familienentwicklung und Haushalt
- 2.3. Wandel der Familie im Spiegel der amtlichen Statistik
- 2.3.1. Familienformen in der Haushaltsstatistik
- 2.3.2. Materielle Situation der Familien mit Kindern
- 2.3.2.1. Einkommenssituation von Familien
- 2.3.2.2. Wohnen.
- 2.3.2.3. Ausgaben für die Lebenshaltung
- 2.4. Theoretisch-soziologische Zugänge zu Familie
- 2.4.1. Strukturfunktionale Systemtheorie der Familie.
- 2.4.2. Neuere Systemtheorie nach Luhmann
- 2.4.3. Interaktionistische Familientheorie
- 2.5. Ambivalente Strukturen und Bewältigungskonstellationen
- 2.6. Familie als Institution
- 2.6.1. Verrechtlichungstendenzen von Familie
- 3. These III: Kindheit - eine segregierte, minorisierte und machtvoll ohnmächtige Daseinsform, die den Betreuungspersonen den Spagat der Integration in eine kinderfeindliche Welt abverlangt
- 3.1. Was ist Kindheit?
- 3.2. Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels auf die Kindheit
- 3.2.1. Kinder als Außenseiter der Gesellschaft?
- 3.2.1.1. ,,Schonraum Kindheit“
- 3.2.1.2. Die Evolutionsbiologisch anthropologische Sicht.
- 3.2.1.3. Der Wert von Kindern
- 3.2.2. Charakteristik der Kindheit in komplexen Gesellschaften
- 3.2.2.1. Wandel der Eltern-Kind-Beziehung und Auswirkungen auf die Kindheit
- 3.2.2.2. Wandel der modernen Kindheit.
- 3.3. Auswirkungen auf die Elternschaft
- 3.3.1. Auswirkungen der veränderten Eltern-Kind-Beziehung auf die Elternschaft
- 3.3.1.1. Modernes Exposé
- 3.3.1.2. Elterlicher Umgang mit den neuen Herausforderungen
- 3.3.1.3. Auswirkungen und Anforderungen der gewandelten Kindheit auf die Eltern
- 4. These IV: Familiale Arbeit liegt im Spannungsfeld zwischen Frustration und Abwertung und Möglichkeiten persönlicher Sinntiefen und Entwicklung
- 4.1. Geschlechterverhältnisse und die darin eingelassene Bewertung und Verteilung der familialen Arbeit
- 4.1.1. Philosophisches
- 4.1.2. Muttermythos und Geschlechterschmerz
- 4.1.3. Kulturelle Fesseln der Verteilung von Reproduktionsarbeit
- 4.1.3.1. Soziologie der Partnerschaft oder: Warum die Reproduktionsarbeit einseitig zu Lasten der Frau bleibt
- 4.1.3.2. Care und Bürgerrechte sowie die Privatisierung der Sorge
- 4.1.3.3. Empirie der Ungleichheit in familialen Lebensformen
- 4.1.4. Geschlechterkontrakttheorie
- 4.2. Zur Charakteristik von Familienarbeit
- 4.2.1. Auswirkungen eines Biographiewechsels
- 4.2.2. Regeln der der Familienarbeit
- 4.2.3. Warum manche trotzdem noch Eltern werden
- 5. These V: Menschen im reproduktionsfähigen Alter entscheiden sich aus Verantwortungsbewusstsein für weniger Kinder, da sie, wenn sie sich für Kinder entscheiden, diese auch intensiv begleiten möchten
- 5.1. Demographie
- 5.1.1. Demographische Entwicklung in Deutschland
- 5.1.2. Auswirkungen der demographischen Entwicklung
- 5.1.3. Muster generativen Verhaltens
- 5.1.4. Zur Kritik der Bevölkerungswissenschaft
- 5.2. Generatives Verhalten im Spannungsfeld von Natur und Kultur
- 5.3. Was die individuelle Entscheidung für oder gegen Kinder beeinflusst
- 5.3.1. Hürden des Kinderwunsches
- 5.3.2. Kinderlosigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die freie wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem Wandel der Arbeitsgesellschaft, Familie und Kindheit und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Elternschaft. Sie untersucht die Herausforderungen, die sich durch den digitalen Kapitalismus, die veränderten Familienstrukturen und die veränderte Kindheit für Eltern ergeben.
- Die Intensivierung und Entgrenzung der Arbeit im digitalen Kapitalismus
- Die Herausforderungen der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie
- Der Wandel von Familienstrukturen und seine Auswirkungen auf die Elternschaft
- Die Herausforderungen der modernen Kindheit und ihre Auswirkungen auf die Elternschaft
- Die Bedeutung der Reproduktionsarbeit und die Ungleichheit in ihrer Verteilung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den demographischen Wandel in Deutschland und stellt die Problematik der Vereinbarkeit von Beruf und Familie in den Mittelpunkt der Betrachtung. Sie zeigt auf, dass die Gesellschaft die Entscheidung für oder gegen Kinder als individuelle und zu verantwortende Entscheidung betrachtet, ohne die zugrunde liegenden gesellschaftlichen Bedingungen ausreichend zu berücksichtigen.
Kapitel 1 analysiert die Arbeitsgesellschaft im digitalen Kapitalismus. Es wird gezeigt, dass die Arbeitsgesellschaft durch die Intensivierung der Arbeit, die Entgrenzung der Arbeitszeit und die Abwertung der Reproduktionsarbeit geprägt ist. Diese Entwicklungen stellen Eltern vor große Herausforderungen, da sie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erschweren.
Kapitel 2 widmet sich der Familie als Institution. Es werden die Veränderungen der Familienstrukturen im Laufe der Zeit untersucht und die vielfältigen Herausforderungen beleuchtet, denen Familien heute gegenüberstehen. Von der materiellen Situation über theoretische Zugänge zu Familie bis hin zu den Verrechtlichungstendenzen von Familie werden verschiedene Aspekte behandelt.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Wandel der Kindheit. Es wird dargestellt, wie die moderne Kindheit durch die veränderte Eltern-Kind-Beziehung und die komplexen Anforderungen der Gesellschaft geprägt ist. Die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Elternschaft werden untersucht.
Kapitel 4 beleuchtet die familiale Arbeit im Spannungsfeld zwischen Frustration und Abwertung und Möglichkeiten persönlicher Sinntiefen und Entwicklung. Es wird der Fokus auf die Geschlechterverhältnisse und die ungleiche Verteilung der Reproduktionsarbeit gelegt. Weiterhin wird die Soziologie der Partnerschaft, die Privatisierung der Sorge und die empirische Ungleichheit in familialen Lebensformen behandelt.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Entscheidung für oder gegen Kinder. Die demographische Entwicklung in Deutschland wird analysiert und die Faktoren, die die individuelle Entscheidung für oder gegen Kinder beeinflussen, werden untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter der Arbeit sind: Arbeitsgesellschaft, digitaler Kapitalismus, Reproduktionsarbeit, Familie, Familienstrukturen, Kindheit, Elternschaft, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Geschlechterverhältnisse, Care, Demographie.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Reproduktionsarbeit?
Reproduktionsarbeit umfasst alle Tätigkeiten der Sorge, Erziehung, Hausarbeit und Pflege, die für den Erhalt der Gesellschaft notwendig sind, aber oft unbezahlt bleiben.
Wie beeinflusst der digitale Kapitalismus die Elternschaft?
Durch die Intensivierung und Entgrenzung der Arbeit wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erschwert, während Sorgearbeit ökonomisch abgewertet wird.
Warum wird die Entscheidung für Kinder heute als „egoistisch“ oder „lebensfeindlich“ diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet die politische Rhetorik zum demographischen Wandel, die Eltern oft unter Druck setzt, während strukturelle Hürden privatisiert werden.
Welchen Wandel hat die Kindheit in komplexen Gesellschaften erfahren?
Kindheit wird zunehmend als segregierter Raum wahrgenommen, der hohe Anforderungen an die Integration in eine oft kinderfeindliche Welt stellt.
Warum bleibt die Familienarbeit meist an den Frauen hängen?
Die Arbeit analysiert kulturelle Fesseln, den „Muttermythos“ und die Geschlechterkontrakttheorie als Ursachen für die ungleiche Verteilung der Reproduktionsarbeit.
- Citar trabajo
- Marie-Theres Vogel (Autor), 2006, Das Ende der Reproduktionsarbeit? - Die Auswirkung des Wandels von Arbeitsgesellschaft, Familie und Kindheit auf die Elternschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86050