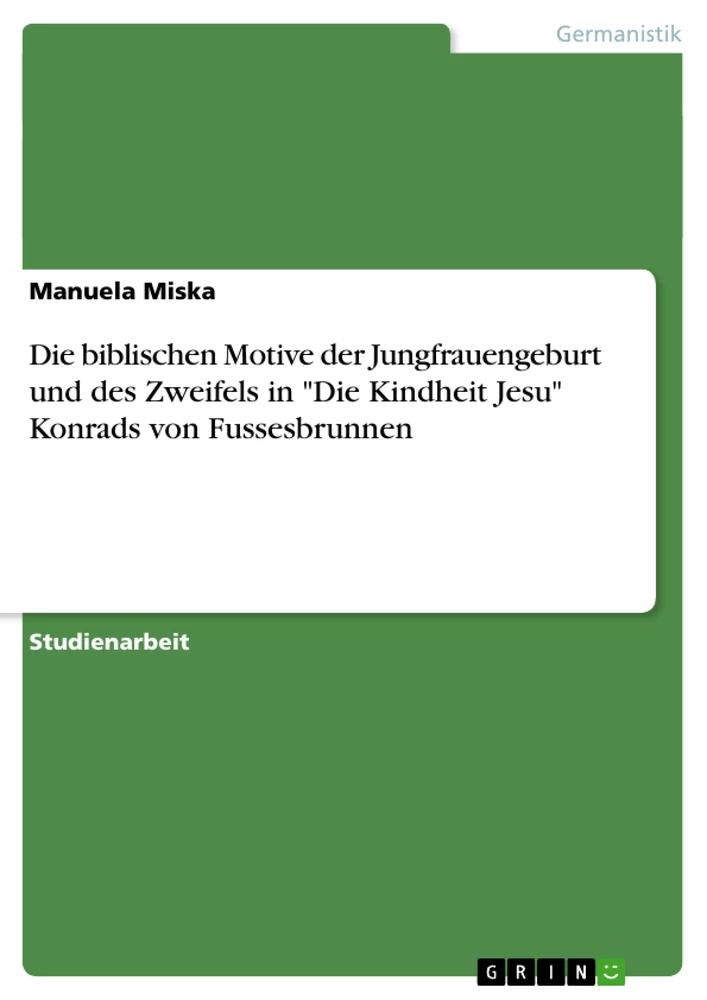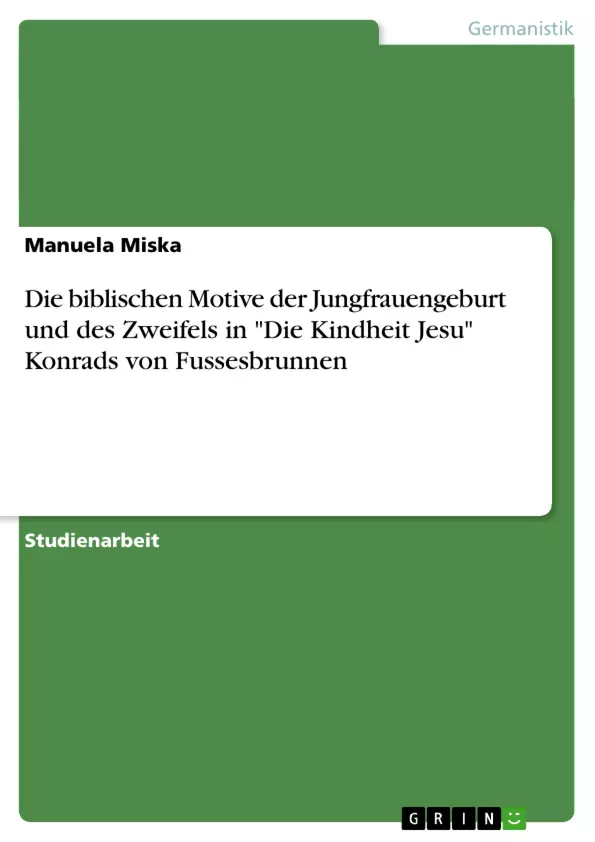Neben der Darstellung Christi nimmt die Mariendarstellung in der christlichen Tradition die wichtigste Position ein. Mit der gesonderten Betrachtung der Person Maria und ihres Lebens setzte bereits im frühen Christentum eine Entwicklung des Marienbildes ein, die bis in die heutige Zeit hinein reicht und die sich im Verlauf von 2000 Jahren verschiedenartig äußerte.
Die Kindheit Jesu nach Konrad von Fussesbrunnen ist, wie auch das erste größere Marienleben "Driu liet von der maget" des Priesters Wernher, dem Beginn der deutschsprachigen mittelalterlichen Marienepik zuzuordnen. Das Wirken Konrads von Fussesbrunnen bleibt einzig mit diesem umfassenden Werk verbunden, weitere Schriften des Dichters sind nicht überliefert.
Eine besondere Stellung innerhalb der mittelalterlichen Mariendichtung kommt der Kindheit Jesu zu, da sie in einem Maße und Umfang wie keine andere religiöse Dichtung nicht nur die Lebensgeschichte Marias, sondern auch die Geburts- und Kindheitsgeschichte Jesu beinhaltet.
Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die Figur der Maria, ihre Lebensgeschichte und ihre biblischen Erwähnungen sowie über Formen und Entwicklungen ihrer Verehrung als auch über die deutsche Mariendichtung im Mittelalter gegeben werden.
Der Hauptteil dieser Arbeit wird eingeleitet mit der Entstehungsgeschichte der Kindheit Jesu, welche mit einem Einblick in die Besonderheiten und in die literaturhistorische Stellung dieses Werkes schließt.
Da anhand zweier Szenen aus der Kindheit Jesu exemplarisch der Zweifel an der jungfräulichen Empfängnis Marias thematisiert wird, schließen Erklärungen und Erläuterungen zu den biblischen Motiven der Jungfrauengeburt und des durch den Jünger Thomas symbolisierten Zweifels an die Texthistorie an.
Weiterhin werden die Szenen „Josephs Klage“ sowie die „Hebammenszene“ unter der o. g. Themenstellung näher betrachtet und analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung des Marienbildes in Geschichte, Religion und Kultur
- Maria als Heiligenfigur
- Die deutsche Mariendichtung des Mittelalters
- Konrad von Fussesbrunnen, Die Kindheit Jesu
- Entstehungsgeschichte
- Die biblischen Motive der Jungfrauengeburt und des Zweifels
- „Josephs Klage“
- Die Hebammenszene
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Konrad von Fussesbrunnen's "Die Kindheit Jesu" im Kontext der mittelalterlichen Mariendichtung. Ziel ist es, die Entstehungsgeschichte des Werkes zu beleuchten und dessen Bedeutung innerhalb der deutschsprachigen Marienepik zu erörtern. Dabei werden ausgewählte Szenen analysiert, um die Darstellung Marias und die Thematisierung des Zweifels an der Jungfrauengeburt zu untersuchen.
- Die Entwicklung des Marienbildes im Mittelalter
- Die literaturhistorische Einordnung von "Die Kindheit Jesu"
- Die Darstellung des Zweifels an der Jungfrauengeburt
- Analyse ausgewählter Szenen (z.B. "Josephs Klage", "Hebammenszene")
- Der Einfluss biblischer Motive und apokrypher Schriften
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung ordnet Konrads von Fussesbrunnen "Die Kindheit Jesu" in den Kontext der beginnenden deutschsprachigen Marienepik ein und hebt die Besonderheit des Werkes hervor, indem es nicht nur Marias Leben, sondern auch die Geburts- und Kindheitsgeschichte Jesu umfassend darstellt. Sie kündigt den weiteren Verlauf der Arbeit an, der einen Überblick über Maria, ihre Verehrung und die mittelalterliche Mariendichtung bietet, bevor die Entstehungsgeschichte und ausgewählte Szenen aus "Die Kindheit Jesu" im Detail analysiert werden.
Die Entwicklung des Marienbildes in Geschichte, Religion und Kultur: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Marienbildes von den frühen Erwähnungen im Neuen Testament bis zur mittelalterlichen Verehrung. Es beleuchtet die vielfältigen Darstellungen Marias als Heilige Jungfrau, Gottesmutter, Schmerzensmutter etc., und betont den Einfluss kirchlicher und volkstümlicher Traditionen auf die Entwicklung des Marienbildes. Der Wandel von einer strengen, unnahbaren Darstellung hin zu einer menschlicheren, mit ihrem Kind verbundenen Figur wird ebenso thematisiert wie die theologische Bedeutung Marias als Mittlerin zwischen Ewigkeit und Menschlichkeit.
Konrad von Fussesbrunnen, Die Kindheit Jesu: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehungsgeschichte von "Die Kindheit Jesu", seiner literaturhistorischen Bedeutung und seiner Stellung innerhalb der mittelalterlichen Mariendichtung. Es analysiert ausgewählte Szenen, die den Zweifel an der jungfräulichen Empfängnis thematisieren, und untersucht deren biblische und literarische Hintergründe. Die Analyse konzentriert sich auf die exemplarische Behandlung des Zweifels anhand von "Josephs Klage" und der "Hebammenszene", um die künstlerische und theologische Gestaltung dieses zentralen Themas zu ergründen.
Schlüsselwörter
Mariendichtung, Mittelalter, Konrad von Fussesbrunnen, Die Kindheit Jesu, Jungfrauengeburt, Zweifel, Marienbild, Bibel, Apokryphen, Marienverehrung, Literaturgeschichte, Theologie.
Häufig gestellte Fragen zu Konrad von Fussesbrunnen: Die Kindheit Jesu
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert Konrad von Fussesbrunnen's "Die Kindheit Jesu" im Kontext der mittelalterlichen Mariendichtung. Sie untersucht die Entstehungsgeschichte des Werkes, seine Bedeutung innerhalb der deutschsprachigen Marienepik und die Darstellung Marias und des Zweifels an der Jungfrauengeburt. Ausgewählte Szenen, wie "Josephs Klage" und die "Hebammenszene", werden detailliert analysiert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Marienbildes im Mittelalter, die literaturhistorische Einordnung von "Die Kindheit Jesu", die Darstellung des Zweifels an der Jungfrauengeburt, den Einfluss biblischer Motive und apokrypher Schriften, sowie eine detaillierte Analyse ausgewählter Szenen. Die theologische und künstlerische Gestaltung des Zweifels an der Jungfrauengeburt steht im Mittelpunkt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Entwicklung des Marienbildes, ein Kapitel zu Konrad von Fussesbrunnen's "Die Kindheit Jesu" und eine Schlussbetrachtung. Die Einleitung stellt das Werk vor und skizziert den weiteren Verlauf. Das Kapitel zum Marienbild beleuchtet dessen Entwicklung von den Anfängen bis ins Mittelalter. Das zentrale Kapitel analysiert "Die Kindheit Jesu" und ausgewählte Szenen. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird der Zweifel an der Jungfrauengeburt dargestellt?
Der Zweifel an der Jungfrauengeburt wird anhand ausgewählter Szenen, insbesondere "Josephs Klage" und der "Hebammenszene", analysiert. Die Arbeit untersucht die biblischen und literarischen Hintergründe dieser Darstellungen und ergründet die künstlerische und theologische Gestaltung dieses zentralen Themas in Konrads Werk.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf biblische Texte, apokryphe Schriften und die mittelalterliche Marienliteratur. Sie untersucht die literaturhistorischen Zusammenhänge und den Einfluss verschiedener Traditionen auf die Darstellung Marias und der Jungfrauengeburt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mariendichtung, Mittelalter, Konrad von Fussesbrunnen, Die Kindheit Jesu, Jungfrauengeburt, Zweifel, Marienbild, Bibel, Apokryphen, Marienverehrung, Literaturgeschichte, Theologie.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler und Studenten der Literaturwissenschaft, Theologie und Geschichte, die sich mit der mittelalterlichen Literatur, der Marienverehrung und der deutschsprachigen Marienepik beschäftigen.
Wo finde ich den vollständigen Text?
(Hier könnte ein Link zum vollständigen Text eingefügt werden, falls verfügbar.)
- Citar trabajo
- Manuela Miska (Autor), 2002, Die biblischen Motive der Jungfrauengeburt und des Zweifels in "Die Kindheit Jesu" Konrads von Fussesbrunnen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86293