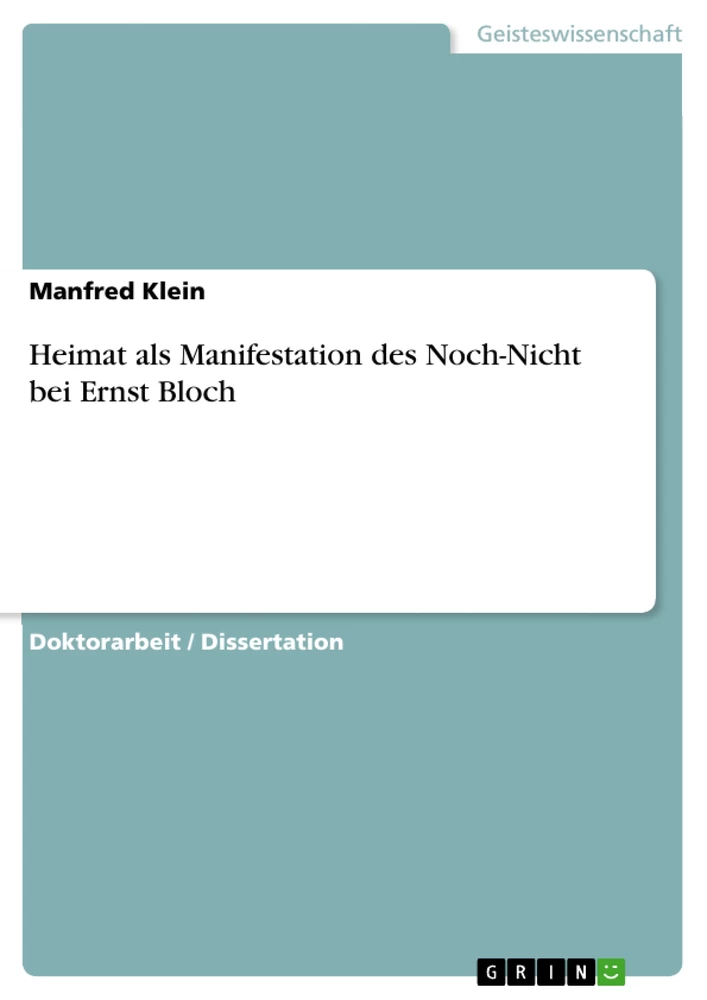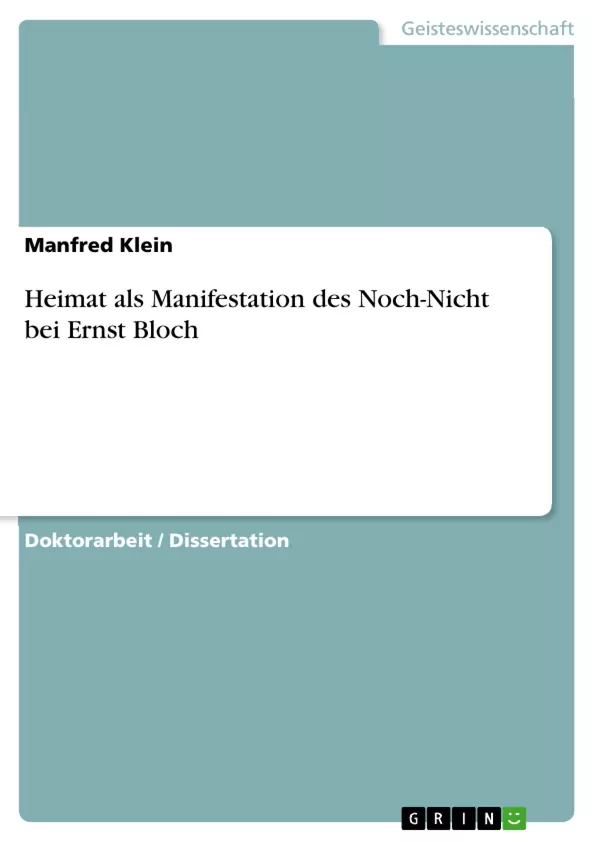Diese Dissertation befasst sich mit dem Phänomen Heimat im Allgemeinen, sowie dem Heimatbegriff von Ernst Bloch.
Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Alltagsphänomen Heimat?
Diese Fragestellung wird unter der Berücksichtigung anderer wissenschaftlicher Ergebnisse diskutiert, bevor die Philosophie Ernst Blochs dazu herangezogen wird.
Welche Assoziationen verfolgt Ernst Bloch, wenn er den Heimatbegriff verwendet und was genau bezeichnet er damit? Überschneidet sich seine Vorstellung mit der alltäglichen Verwendung des Begriffs?
Alle diesen Fragestellung wird in dieser Arbeit Schritt für Schritt nachgegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemaufriss
- 1.2. Einführung in das Thema
- 1.3. Vorgehensweise
- 2. Heimat
- 2.1. Begriffsproblematik
- 2.1.1. Etymologische Herleitung und Semantik
- 2.1.2. „Heimat“ – eine Begriffsgeschichte
- 2.1.3. Heimaten
- 2.1.4. Das Wort in anderen Sprachen
- 2.2. Heimat im allgemeinen Sprachgebrauch
- 2.2.1. Emotionale Aspekte der Heimat
- 2.2.2. Weitere Heimatbereiche
- 2.2.3. Heimat in der Mentalität des Menschen
- 2.2.4. Politisch-materielle Einordnung
- 2.2.5. Erschaffung, Bewahrung und Vernichtung von Heimat
- 2.2.6. Beheimatung in der Religion
- 2.2.6.1. Von Gott gegebene Heimat
- 2.2.6.2. Die jenseitige Welt
- 2.2.6.3. Religionsgemeinschaften als Heimat
- 2.2.6.4. Wirkung jüdischer Kultur auf den Begriff „Heimat“
- 2.3. Ernst Blochs Heimaten und das Judentum
- 2.3.1. Stationen seines Lebens
- 2.3.2. Ernst Bloch und seine jüdische Identität
- 2.4. Philosophische Implikationen von Heimat
- 2.4.1. Heimat in der romantischen Philosophie
- 2.4.1.1. Die Geburt der Romantik
- 2.4.1.2. Heimat bei Novalis
- 2.4.2. Heimat in der gegenwärtigen Philosophie
- 3. Sprachduktus und Schreibstil von Ernst Bloch
- 3.1. Schreiben im 20. Jahrhundert mit barocker Wortfülle
- 3.1.1. Ein Atheist mit religiöser Sprache
- 3.1.2. Kryptische Ausdrucksweise
- 4. Grundlinien: \"Geist der Utopie\"\
- 4.1. Entdeckung des Augenblicks
- 4.2. Möglichkeit der Selbsterkenntnis
- 5. Das antizipierende Bewusstsein
- 5.1. Triebe und Affekte
- 5.2. Differenz Nachttraum - Tagtraum
- 5.3. Es dämmert nach vorne
- 6. Das Noch-Nicht-Sein
- 6.1. Die ontologische Grundlage: Materie
- 6.1.1. Ernst Blochs Aristoteles-Rezeption
- 6.1.2. Der Materialismus bei Ernst Bloch
- 6.2. Sein Nicht-Sein - Prozess
- 6.3. Das Sein des Noch-Nicht-Seins
- 7. Vom Schein zum Vorschein
- 7.1. Etymologie und Verwendung des Wortes Schein/ Vorschein
- 7.2. Schein Erscheinung – Vorschein
- 7.3. Vorschein durch die Kunst
- 7.4. Lichtstrahl ins Dunkel
- 8. Blochs Assoziationen von Heimat
- 8.1. Charakterisierung
- 8.1.1. Ein möglicher Ursprung
- 8.2. Beitrag der Religionen
- 8.2.1. Die Integration des biblischen Hintergrunds
- 8.2.1.1. Jerusalem
- 8.2.1.2. Judentum und Christentum im Erlösungsplan
- 8.2.1.3. Messianismus und Paradies
- 8.2.2. Zum Einfluss der Mystik
- 8.3. Tod als Heimat?
- 8.3.1. Wunschbild mit nicht Wünschenswertem
- 8.3.2. Contra Nichts, Säkularisierung und der „rote Held\"\
- 8.3.3. Ausgangspunkt: „Forschungsreise“ und Dunkel des gelebten Augenblicks
- 8.3.4. Nicht-mehr-da-sein-können und Noch-Nicht
- 8.4. Der,,gefundene“ Mensch
- 8.4.1. Von der Arbeit zur Muẞe
- 8.4.2. Heimat entsteht durch Kunst und Architektur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Inaugural-Dissertation analysiert Ernst Blochs Schriften auf die Konzeption von Heimat als Manifestation des Noch-Nicht. Sie untersucht, wie Bloch das Konzept der Heimat in seiner Philosophie verwendet, und welche Rolle es in seiner Auseinandersetzung mit dem Judentum und der Geschichte spielt.
- Die Bedeutung des Noch-Nicht als zentrale Kategorie in Blochs Philosophie
- Die Rolle des Judentums in Blochs Heimatsbegriff
- Die Verbindung von Heimat, Utopie und Hoffnung in Blochs Werk
- Die Auseinandersetzung mit dem Konzept der Heimat in der romantischen Philosophie
- Die Analyse von Blochs Sprache und Schreibstil
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und skizziert die Vorgehensweise. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Begriff „Heimat“ und analysiert seine Geschichte, Semantik und Verwendung im allgemeinen Sprachgebrauch. Zudem wird die Bedeutung des Judentums im Kontext von Blochs Heimatsverständnis untersucht.
Kapitel drei beleuchtet Blochs Sprachduktus und Schreibstil, seine Verwendung von Metaphern und seiner spezifischen Art, Philosophie zu betreiben. Kapitel vier geht auf Blochs zentrale Ideen des „Geist der Utopie“ ein und erörtert die Entdeckung des Augenblicks und die Möglichkeit der Selbsterkenntnis.
Das fünfte Kapitel untersucht das antizipierende Bewusstsein, seine Triebe und Affekte sowie die Differenz zwischen Nachttraum und Tagtraum. Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit dem „Noch-Nicht-Sein“ als ontologischer Grundlage und beleuchtet Blochs Rezeption von Aristoteles und seinen Materialismus.
Kapitel sieben analysiert die Beziehung zwischen Schein und Vorschein, die Rolle der Kunst im Vorscheinprozess und die Suche nach Lichtstrahlen im Dunkel. Das achte und letzte Kapitel, das in dieser Vorschau nicht berücksichtigt wird, befasst sich mit Blochs Assoziationen von Heimat und untersucht verschiedene Aspekte wie den Einfluss der Religionen, den Tod als Heimat und die Rolle des „gefundenen“ Menschen.
Schlüsselwörter
Heimat, Noch-Nicht, Ernst Bloch, Utopie, Hoffnung, Judentum, Philosophie, Schreibstil, Materialismus, Schein, Vorschein, Kunst, Religion, Tod, „gefundener“ Mensch.
- Citation du texte
- Manfred Klein (Auteur), 2007, Heimat als Manifestation des Noch-Nicht bei Ernst Bloch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86300