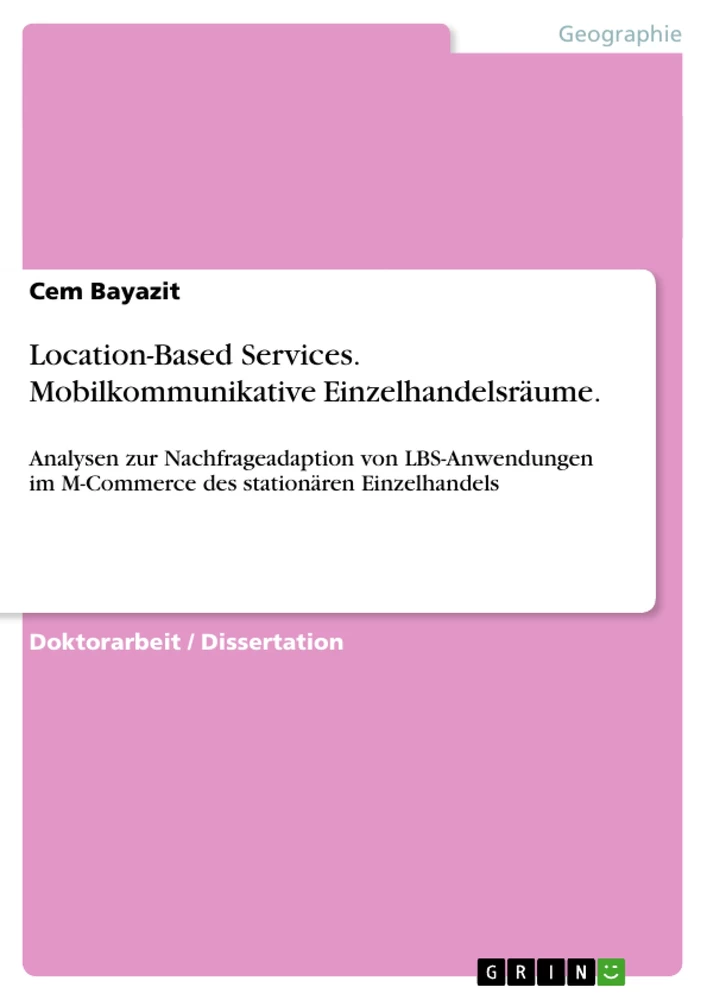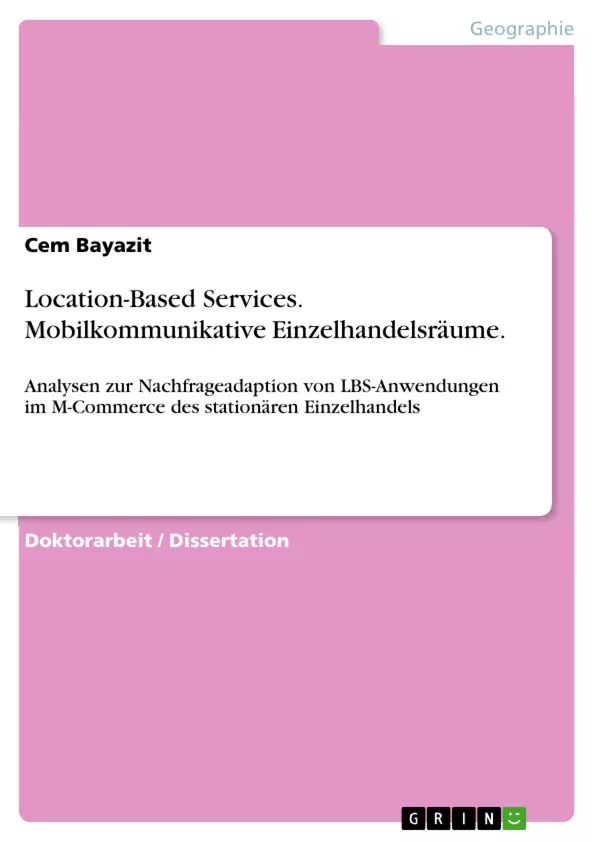Einleitend werden die Rahmenbedingungen der elektronisierten Geschäftstransaktionen im stationären Einzelhandel und der daraus folgende Einfluss von mobilkommunikativen Informationstechnologien erklärt. Auf dieser Grundlage werden die Auswirkungen von LBS-Anwendungen auf wirtschaftliche und raum-zeitliche Aspekte des Beziehungsgeflechts zwischen dem stationären Einzelhandel und dem Endkunden diskutiert. Ebenfalls wird auf die Time-Geography und die Affordanzen von LBS-Anwendungen im stationären Einzelhandel eingegangen. Anhand von statistischen Analysen durch Passantenbefragungen, werden empirische Ergebnisse ausgewiesen und diskutiert. Der Nachfragemarkt von LBS-Anwendungen im stationären Einzelhandel kann durch zwei Kriterien segmentiert werden. Das erste Kriterium ist die klassische soziodemographische Marktsegmentierung, die auf demographischen Kennzeichen wie Geschlecht und Alter, sowie auf sozioökonomischen Kennzeichen wie Ausbildung und Beruf beruht. Das zweite Kriterium ist die verhaltensorientierte Marktsegmentierung, die auf dem Informations- und Kommunikationsverhalten beruht. Diese erlaubt eine Segmentierung nach dem mobilkommunikativen Nutzungsverhalten, -art, -häufigkeit und -intensität. Jedoch ist unbedingt zu beachten, dass sich die Kriterien zur Marktsegmentierung wechselseitig beeinflussen. Zuvor werden die möglichen zukünftigen Veränderungen in der Time-Geography durch die neuartigen LBS-Anwendungen im stationären Einzelhandel diskutiert. Diese theoretische Analyse verdeutlicht, dass die klassische Time-Geography mit der Möglichkeit zur Telepräsenz eine Erweiterung zur virtuellen Dimension durch UBIQUITOUS COMPUTING erfährt, die wiederum eine Erweiterung der raum-zeitlichen Attribute der HÄGERSTRANDschen Theorie der Time-Geography gestattet. Im Anschluss an die empirischen und theoretischen Analysen werden die Hypothesen überprüft. Es werden anhand der Ergebnisse Hindernisse und Barrieren für eine künftige Adaption von LBS-Anwendungen im stationären Einzelhandel aufgezeigt. Hieraus werden Szenarien und Konzepte für die Zielgruppenansprache und Dynamisierung von LBS-Anwendungen im stationären Einzelhandel abgeleitet. Als Abschluss wird ein Ausblick auf die mögliche künftige Entwicklung von Kommunikationsräumen durch die Nutzung von LBS-Anwendungen im M-Commerce des stationären Einzelhandels gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung in die Thematik
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Zielsetzung
- 1.3. Rahmenbedingungen und Aufbau der Arbeit
- 1.3.1. Rahmenbedingungen
- 1.3.2. Aufbau
- 2. Information und Telekommunikation in der geographischen Forschung
- 2.1. Historischer Überblick der wissenschaftstheoretischen Ansätze
- 2.2. Elektronisierte Geschäftstransaktionen im stationären Einzelhandel
- 2.2.1. Wettbewerbs- und Handlungsdruck im stationären Einzelhandel
- 2.2.2. Einfluss von IuK-Technologien im stationären Einzelhandel
- 2.3. Das Zusammenwirken von Forschungsgegenständen
- B. Mobilität, Technik und Gesellschaft
- 3. Die mobile und vernetzte Gesellschaft
- 3.1. IuK-Technologieentwicklung und die vernetzte mobile Gesellschaft
- 3.2. Unterschiedliche zeitliche und räumliche Adaptionen von Innovationen
- 3.3. Mobilität und Telekommunikation
- 4. Technische Grundlagen und Formen
- 4.1. Geodaten, Informationen und Austausch
- 4.1.1. GIS und DBMS
- 4.1.1.1. Geographische Informationssysteme
- 4.1.1.2. Datenbanken
- 4.1.2. Lokalräumliche Informationen
- 4.1.2.1. Geodaten und Geoinformationen
- 4.1.2.2. Geokodierung und Georeferenzierung von Daten
- 4.1.2.3. Produkt- und Dienstleistungsbeschaffenheiten im M-Commerce
- 4.1.2.4. Spatial Content
- 4.1.3. SyncML
- 4.2. Mobilkommunikative Übertragungstechniken als Informationskanal
- 4.2.1. Zellulare Mobilfunkstandards
- 4.2.1.1. GSM (Global System for Mobile Communication)
- 4.2.1.2. IMT-2000
- 4.2.1.3. DECT und TETRA
- 4.2.2. Mobile IP-Netze
- 4.2.3. Mobile Broadband Systeme (MBS)
- 4.2.4. Local Area Communication Systems (LACS)
- 4.3. Lokalisierung von mobilen Endgeräten
- 4.3.1. Terminalbasierte Positionsbestimmung (Handset-Based)
- 4.3.1.1. Satellitengestützte Positionsbestimmung
- 4.3.1.2. E-OTD (Enhanced Observed Time Difference)
- 4.3.2. Stationsbasierte Positionsbestimmung (Network-Based)
- 4.3.2.1. Zellenbasierte Positionsbestimmung
- 4.3.2.2. AOA (Angle of Arrival)
- 4.3.2.3. TOA (Time of Arrival)
- 4.3.2.4. TDOA (Time Distance of Arrival)
- 4.3.2.5. Multipath Fingerprint
- 4.3.2.6. Manuelle Positionsbestimmung
- 4.3.3. Kombinationen
- 4.4. Location-Based Services (LBS)
- 4.4.1. Definitorische Annäherung
- 4.4.2. Kategorien der LBS-Anwendungen
- 4.4.3. LBS-Kategorie der selektiv gezielten Informationsverbreitung
- 4.4.4. LBS-Charakteristika
- 5. Der Einzelhandel in der mobilen Gesellschaft
- 5.1. Einzelhandelsrelevante Mobilitätstypen
- 5.2. Der stationäre Einzelhandel im Spannungsfeld der Mobilität
- 6. Mobilkommunikative Wirtschaft
- 6.1. Mobile Business
- 6.2. Mobile Anwendungen
- 6.3. Mobile Commerce
- 6.3.1. Die Entwicklung zum M-Commerce
- 6.3.2. Wandel von E-Commerce zu M-Commerce
- 6.3.3. M-Commerce Wettbewerbspotenziale im stationären Einzelhandel
- 6.3.3.1. M-Commerce Individualisierungspotenzial im stationären Einzelhandel
- 6.3.3.2. M-Commerce Schnelligkeitspotenzial im stationären Einzelhandel
- 6.3.3.3. M-Commerce Innovationspotenzial im stationären Einzelhandel
- 6.3.3.4. M-Commerce Imagepotenzial im stationären Einzelhandel
- 6.3.3.5. M-Commerce Kostensenkungspotenzial im stationären Einzelhandel
- 6.3.3.6. M-Commerce Multi-Channel-Potenzial im stationären Einzelhandel
- 7. Time-Geography und Affordanzen von LBS-Anwendungen im stationären Einzelhandel
- 7.1. Time-Geography
- 7.1.1. Raum-Zeit-Verbindung
- 7.1.2. Beschränkungen und Raum-Zeit-Prisma
- 7.2. Virtuelle Telepräsenz und LBS
- 7.2.1. Virtuelle Telepräsenz
- 7.2.2. Beschränkungen von LBS-Anwendungen
- 7.3. Aufforderungscharakter und Affordanz von LBS-Anwendungen
- 7.3.1. Affordanz – die Wahrnehmung des Nutzens
- 7.3.2. Erweiterte Theorien der Affordanz
- 7.4. Time-Geography in Verbindung mit Affordanzen
- 7.4.1. Modellierungen von Beschränkungen mit Affordanzen
- 7.4.2. Entscheidungsfindung und Benutzervorlieben
- 7.4.2.1. Entscheidungsfindung mit Affordanzen und Beschränkungen
- 7.4.2.2. Modellierungen von Benutzervorlieben
- D. Hypothesen
- 8. Hypothesen
- E. Analyseergebnisse und Diskussion
- 9. Theoretische Veränderungen in der Time-Geography durch LBS-Anwendungen im stationären Einzelhandel
- 9.1. Erweiterung zur virtuellen Dimension durch UBIQUITOUS COMPUTING
- 9.2. Änderungen der HÄGERSTRANDschen raum-zeitlichen Attribute
- 10. Empirisch-statistische Untersuchungen
- 10.1. Statistische Vorgehensweise
- 10.2. GMI – Geographisches Mobiles Informationssystem
- 10.3. Mobilkommunikative Einzelhandelsräume
- 10.3.1. Sozioökonomische und soziomobilkommunikative Kennzahlen
- 10.3.2. Nutzungsarten des Mobiltelefons
- 10.3.3. Einkaufensverhalten mit dem PC und dem Mobiltelefon
- 10.3.4. Argumente gegen das Einkaufen mit dem Mobiltelefon
- 10.3.5. Nachfragestruktur für lokalräumliche Einkäufe mit dem Mobiltelefon
- 10.3.6. Informationsreichweiten für einen Einkauf über das Mobiltelefon
- 10.3.7. Logistische Regressionsanalyse
- 11. Schlussfolgerung für die Hypothesen
- F. Fazit, Szenarien und Ausblick
- 12. Fazit
- 12.1. Zielgruppen von LBS-Anwendungen des stationären Einzelhandels
- 12.2. Hindernisse und Barrieren
- 12.3. Konzepte für Zielgruppenansprache und Dynamisierung von LBS-Anwendungen im stationären Einzelhandel
- 13. Szenarien
- 13.1. LACS-LBS-Anwendungen im stationären Einzelhandel
- 13.1.1. Einzelhandel über Bluetooth
- 13.1.2. Einzelhandel und Werbung über RFID
- 13.2. LBS über WACS
- 14. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation untersucht den Einfluss mobilkommunikativer lokalräumlicher Informationen des stationären Einzelhandels auf das individuelle Einkaufsverhalten und die damit verbundenen Veränderungen im Tagesablauf. Ziel ist die Darstellung erfolgsversprechender Location-Based Services (LBS) im M-Commerce des stationären Handels.
- Nachfrageadaption von LBS-Anwendungen
- Einfluss von Mobilkommunikation auf Aktionsräume
- Raum-Zeit-Verbindungen im Kontext von Time-Geography und Affordanzen
- Empirische Analyse des Nachfragemarktes für LBS
- Szenarien und Konzepte zur Zielgruppenansprache und Dynamisierung von LBS-Anwendungen
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einführung in die Thematik: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, beschreibt die Problemstellung der Nachfrageadaption von LBS im stationären Einzelhandel, definiert die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den Aufbau. Ein historischer Überblick über die Rolle von Informations- und Kommunikationstechniken in der geographischen Forschung wird gegeben, ebenso wie eine Analyse des Wettbewerbsdrucks und des Handlungsdrucks durch IuK-Technologien auf den stationären Einzelhandel.
B. Mobilität, Technik und Gesellschaft: Hier werden die mobile und vernetzte Gesellschaft, die IuK-Technologieentwicklung und die technischen Grundlagen von LBS-Anwendungen detailliert erläutert. Die Kapitel behandeln die Lokalisierung mobiler Endgeräte, verschiedene Mobilfunkstandards (GSM, UMTS, DECT, TETRA) und Nahbereichskommunikationssysteme (LACS) wie Bluetooth und RFID. Der Einfluss der virtuellen Mobilität auf Raum und Zeit wird im Kontext der Time-Geography diskutiert.
C. Wirtschaft, Handel und Raum-Zeit-Verbindungen: Der Einzelhandel in der mobilen Gesellschaft und die mobilkommunikative Wirtschaft werden analysiert. Die Kapitel behandeln Mobile Business und M-Commerce, ihre Potenziale für den stationären Einzelhandel, sowie die Time-Geography und Affordanzen von LBS-Anwendungen. Es wird die Verknüpfung von Time-Geography und Affordanztheorien zur Erklärung des individuellen Handelns im Raum und in der Zeit herangezogen.
D. Hypothesen: Dieses Kapitel formuliert die zentralen Hypothesen der Arbeit, die im weiteren Verlauf empirisch untersucht werden. Es geht um räumliche Abhängigkeiten der LBS-Nutzung, sozioökonomische Einflüsse auf das Nutzerverhalten, Affordanzen mobiler Endgeräte und Dienste, den Einfluss von E-Commerce-Erfahrungen und die potenziellen Veränderungen der Time-Geography durch UBIQUITOUS Computing.
E. Analyseergebnisse und Diskussion: Die empirischen Ergebnisse aus zwei Studien (GMI und mobilkommunikative Einzelhandelsräume) werden präsentiert und im Kontext der Hypothesen diskutiert. Die Ergebnisse zeigen unter anderem soziodemografische und technische Einflussfaktoren auf die Akzeptanz von LBS-Anwendungen und die Notwendigkeit einer Erweiterung der Time-Geography. Die theoretischen Veränderungen in der Time-Geography durch LBS werden im Bezug zu UBIQUITOUS COMPUTING analysiert.
F. Fazit, Szenarien und Ausblick: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen, zeigt Zielgruppen für LBS-Anwendungen auf, identifiziert Hindernisse und Barrieren für deren Adaption und entwickelt Konzepte für die Zielgruppenansprache und Dynamisierung von LBS im stationären Einzelhandel. Drei Szenarien für LBS-Anwendungen (über LACS, über WACS und durch RFID) werden vorgestellt, die auf die spezifischen Charakteristika der einzelnen Technologien eingehen. Abschließend wird ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung von Kommunikationsräumen gegeben.
Schlüsselwörter
Mobilkommunikation, M-Commerce, stationärer Einzelhandel, Location-Based Services (LBS), Time-Geography, Affordanzen, UBIQUITOUS Computing, Marktsegmentierung, soziodemografische Faktoren, Nutzerverhalten, räumliche Reichweite, Informationsasymmetrie, Wettbewerbsvorteile, Zielgruppenansprache, Multi-Channel-Strategie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Dissertation: Mobilkommunikative lokalräumliche Informationen im stationären Einzelhandel
Was ist das zentrale Thema der Dissertation?
Die Dissertation untersucht den Einfluss mobilkommunikativer lokalräumlicher Informationen des stationären Einzelhandels auf das individuelle Einkaufsverhalten und die damit verbundenen Veränderungen im Tagesablauf. Das Hauptziel ist die Darstellung erfolgsversprechender Location-Based Services (LBS) im M-Commerce des stationären Handels.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Nachfrageadaption von LBS-Anwendungen, den Einfluss der Mobilkommunikation auf Aktionsräume, Raum-Zeit-Verbindungen im Kontext von Time-Geography und Affordanzen, die empirische Analyse des Nachfragemarktes für LBS und Szenarien sowie Konzepte zur Zielgruppenansprache und Dynamisierung von LBS-Anwendungen.
Wie ist die Dissertation strukturiert?
Die Dissertation ist in sechs Hauptteile gegliedert: Einleitung mit Problemstellung und Zielsetzung, ein Abschnitt über Mobilität, Technik und Gesellschaft (inkl. technischer Grundlagen von LBS und Mobilfunkstandards), ein Abschnitt über Wirtschaft, Handel und Raum-Zeit-Verbindungen (inkl. Time-Geography und Affordanzen), die Formulierung von Hypothesen, die Präsentation und Diskussion der Analyseergebnisse (inkl. empirischer Studien) und abschließend ein Fazit mit Szenarien und Ausblick.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Dissertation kombiniert theoretische Ansätze (Time-Geography, Affordanztheorie) mit empirischen Untersuchungen. Es werden zwei Studien (GMI und mobilkommunikative Einzelhandelsräume) durchgeführt, die soziodemografische und technische Einflussfaktoren auf die Akzeptanz von LBS-Anwendungen analysieren. Statistische Verfahren, wie die logistische Regressionsanalyse, werden eingesetzt.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die empirischen Ergebnisse zeigen soziodemografische und technische Einflussfaktoren auf die Akzeptanz von LBS-Anwendungen. Die Notwendigkeit einer Erweiterung der Time-Geography wird aufgezeigt, und die theoretischen Veränderungen in der Time-Geography durch LBS werden im Bezug zu UBIQUITOUS COMPUTING analysiert. Die Arbeit identifiziert auch Zielgruppen für LBS-Anwendungen, Hindernisse und Barrieren für deren Adaption und entwickelt Konzepte für die Zielgruppenansprache und Dynamisierung von LBS im stationären Einzelhandel.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Mobilkommunikation, M-Commerce, stationärer Einzelhandel, Location-Based Services (LBS), Time-Geography, Affordanzen, UBIQUITOUS Computing, Marktsegmentierung, soziodemografische Faktoren, Nutzerverhalten, räumliche Reichweite, Informationsasymmetrie, Wettbewerbsvorteile, Zielgruppenansprache, Multi-Channel-Strategie.
Welche konkreten Technologien werden betrachtet?
Die Dissertation behandelt verschiedene Mobilfunkstandards (GSM, UMTS, DECT, TETRA), Nahbereichskommunikationssysteme (LACS) wie Bluetooth und RFID, und Location-Based Services (LBS). Es werden auch Szenarien für LBS-Anwendungen über LACS und WACS vorgestellt.
Was ist das Fazit der Dissertation?
Die Dissertation zeigt das Potenzial von LBS-Anwendungen im stationären Einzelhandel auf, identifiziert jedoch auch Hindernisse und Barrieren für deren Adaption. Sie liefert Konzepte für die Zielgruppenansprache und Dynamisierung von LBS und präsentiert verschiedene Szenarien für zukünftige Anwendungen. Die Arbeit erweitert das Verständnis von Raum-Zeit-Verbindungen im Kontext des mobilen Einkaufsverhaltens.
- Quote paper
- Cem Bayazit (Author), 2007, Location-Based Services. Mobilkommunikative Einzelhandelsräume., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86335