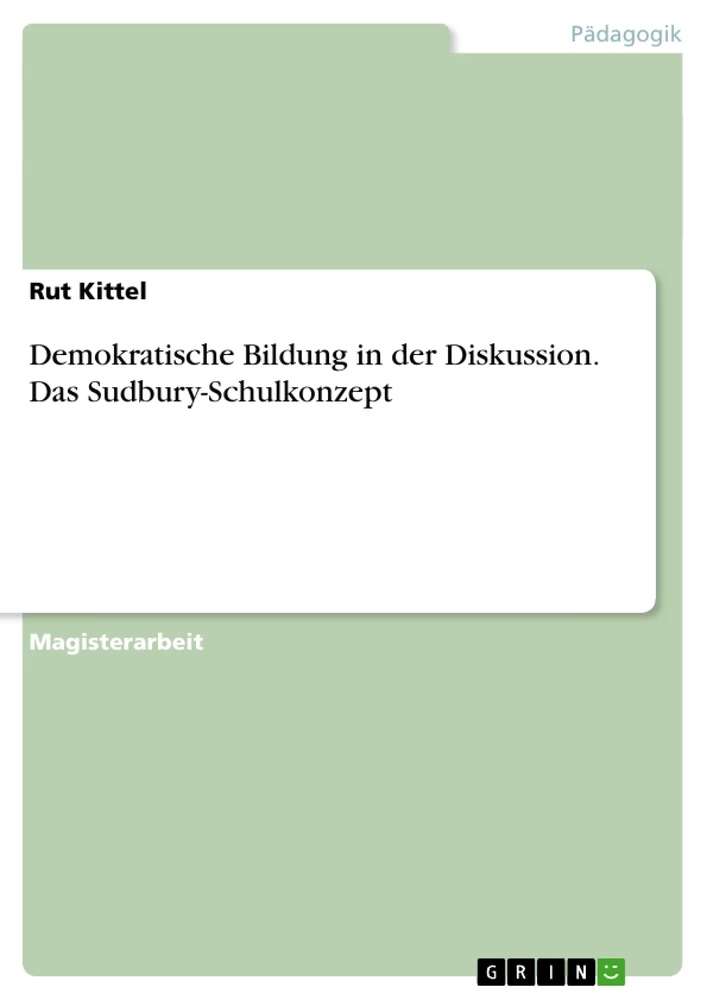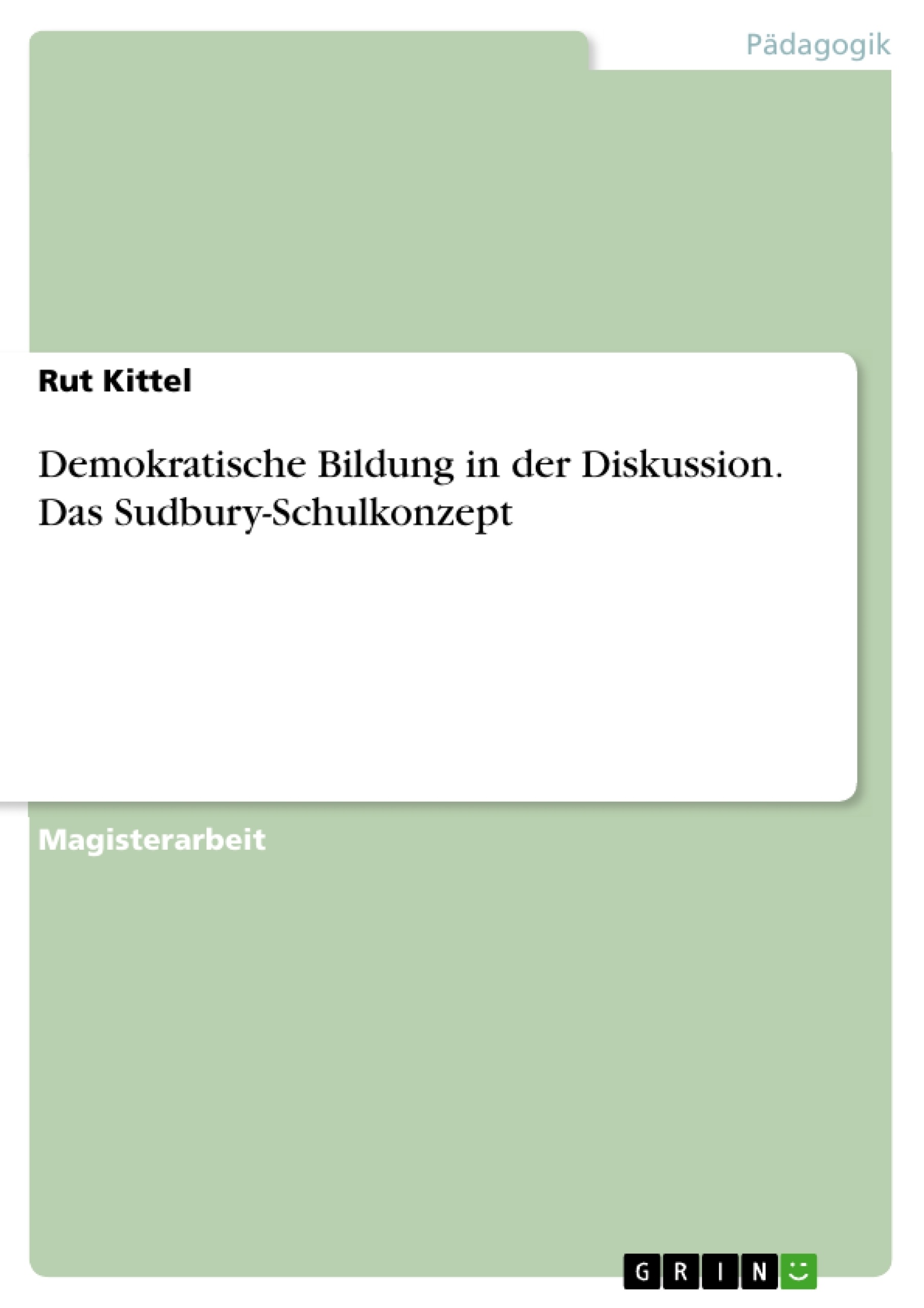Seit ewigen Zeiten beschäftigt sich die Gesellschaft mit der Erziehung ihrer Kinder. Welche Erziehung ist die Richtige bzw. brauchen wir sie überhaupt? Was soll mit Erziehung eigentlich erreicht werden? Was braucht die Gesellschaft? Was braucht der Einzelne? Wer darf über den „Kanon“ des Lernens entscheiden? Kann es einen allgemeingültigen „Kanon“ des Lernens überhaupt geben? Wie müssen wir unsere Kinder vorbereiten, damit sie den Anforderungen des erwachsenen Lebens standhalten können und in diesem Zusammenhang die Frage: Können wir das überhaupt?
Inwieweit dürfen wir eigentlich die Gegenwart, das Glück des Kindes an jedem einzelnen Tag, für die Vorbereitung auf eine ungewisse Zukunft opfern?
Dass Bildung bzw. Entwicklung ohne einen für alle gültigen übergeordneten Plan, ohne offenes oder verstecktes Curriculum, ohne Motivation oder Anleitung durch professionelle Erwachsene usw. möglich sein kann, proklamiert das Sudbury Schulkonzept.
Kann eine solche Bildungsform überhaupt realistisch sein in Anbetracht der Tatsache, dass Menschen bzw. Umwelt und Kultur immer auf andere einwirken? Kann es also so etwas wie Selbstbestimmung in der Bildung überhaupt geben bzw. wäre eine latent vorhandene Fremdbestimmung ein Problem in einem Umfeld, das auf Selbstmotivation und Selbststeuerung ausgerichtet ist?
In diesem Sinne befasst sich diese Magisterarbeit mit der Idee der demokratischen Bildung, wie sie an Sudbury Valley Schulen praktiziert wird. Dabei geht es zuerst einmal darum, wie sich die so genannte demokratische Bildung nach diesem Konzept selbst versteht. Auf was ist sie aufgebaut? Warum nennt sie sich demokratisch und wie unterscheidet sie sich von traditioneller Erziehung bzw. welche Sicht auf das Lernen spiegelt sie wieder?
Auf welchen Grundlagen baut diese Bildungsform auf und welche Möglichkeiten im Bezug auf aktuelle Problematiken unserer Zeit, wie z.B. Chancengleichheit, lebenslangen Lernen und Flexibilität, Leistungsgesellschaft, Konfliktfähigkeit bzw. Umgang mit der eigenen Freiheit könnte sie bieten?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Demokratische Bildung, wie sie an Sudbury-Schulen praktiziert wird
- Demokratie - Versuch einer Annäherung
- Die Säulen der demokratischen Bildung
- Wie demokratisch sind Sudbury-Schulen?
- ,,Schola semper reformanda“
- Die Grundfesten des Lernens
- Informelles und formales Lernen
- Diskrepanzen zwischen Regelschule und Alternativschule und der in Sudbury-Schulen praktizierten demokratischen Idee
- Demokratische Bildung basiert nicht auf neuen Ideen. Das demokratische Erbe der Reformpädagogik
- Was liegt dieser Bildungsform zugrunde und welche Anliegen hat sie?
- Menschenbild und eine andere Sicht auf das Lernen
- Die Furcht vor der Freiheit. Vorbehalte und Chancen im Zusammenhang mit demokratischer Freiheit
- Demokratische Bildung und Leistung
- Demokratische Bildung und Verplanungs- bzw. Pädagogisierungstendenzen in der Gesellschaft
- Demokratische Bildung und Überlegungen zu Gehorsam und Ungehorsam bzw. Konformität
- Demokratisches Lernen und Umgang mit Konflikten Konflikterfahrungen in der Sozialisation
- Forderungen an die schulische (Aus-)Bildung
- Was erwartet unsere Kinder in 20 Jahren?
- Kompatibilität des Konzeptes mit Forderungen an Zukunftsfähigkeit
- Was ist aus solchen Schülern geworden
- Grenzen dieser Bildungsform
- Schwierigkeiten mit demokratischen Prozessen
- demokratische Schulen & Deutschland: eine schwierige Beziehung
- Ergebnisse so genannter demokratischer Schulen
- Grenzen demokratischer Bildung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht das Konzept demokratischer Bildung, wie es an Sudbury-Schulen praktiziert wird. Ziel ist es, die Grundlagen, Ziele und Herausforderungen dieses Ansatzes zu beleuchten und dessen Kompatibilität mit den Anforderungen einer demokratischen Gesellschaft zu diskutieren. Die Arbeit analysiert die praktische Umsetzung des Konzepts und hinterfragt dessen Grenzen und Potentiale.
- Die theoretischen Grundlagen demokratischer Bildung
- Die praktische Umsetzung an Sudbury-Schulen
- Der Vergleich mit traditionellen Schulformen
- Die Herausforderungen und Grenzen demokratischer Bildung
- Die Zukunftsfähigkeit des Konzepts
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die grundsätzlichen Fragen zur Erziehung und Bildung von Kindern. Sie problematisiert die Frage nach einem allgemein gültigen Kanon des Lernens und hinterfragt die Vorbereitung der Kinder auf eine ungewisse Zukunft. Die Arbeit fokussiert sich auf demokratische Bildung im Kontext von Sudbury-Schulen, deren Konzept im Detail untersucht wird. Die Arbeit fragt nach der Realisierbarkeit selbstbestimmter Bildung und den möglichen Ergebnissen eines solchen Ansatzes.
Demokratische Bildung, wie sie an Sudbury-Schulen praktiziert wird: Dieses Kapitel führt in das Konzept der demokratischen Bildung an Sudbury-Schulen ein. Es definiert den Begriff der Demokratie im Bildungskontext, beleuchtet die Säulen demokratischer Bildung und analysiert den Grad der tatsächlichen Demokratisierung an diesen Schulen. Der Abschnitt "Schola semper reformanda" betont den kontinuierlichen Veränderungsprozess und die Anpassungsfähigkeit des Systems. Der Fokus liegt auf den Grundfesten des Lernens, dem Unterschied zwischen informellem und formelle Lernen sowie die Diskrepanzen zwischen Regelschulen und dem Sudbury-Modell. Schließlich werden die historischen Wurzeln in der Reformpädagogik aufgezeigt.
Was liegt dieser Bildungsform zugrunde und welche Anliegen hat sie?: Dieses Kapitel erörtert die philosophischen und pädagogischen Grundlagen der demokratischen Bildung. Es beleuchtet das Menschenbild, das diesem Ansatz zugrunde liegt und die Sichtweise auf Lernen. Es thematisiert die Furcht vor der Freiheit und die damit verbundenen Vorbehalte und Chancen. Zusätzlich werden Fragen nach Leistung, dem Umgang mit Verplanungs- und Pädagogisierungstendenzen in der Gesellschaft, sowie die Auseinandersetzung mit Gehorsam, Ungehorsam und Konformität erörtert. Schließlich wird der Umgang mit Konflikten im demokratischen Lernprozess analysiert.
Forderungen an die schulische (Aus-)Bildung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Zukunftsperspektiven der demokratischen Bildung. Es untersucht die Anforderungen an die Bildung in Zukunft, die Kompatibilität des Sudbury-Konzeptes mit diesen Anforderungen und analysiert die Ergebnisse von ehemaligen Schülern dieser Schulform.
Grenzen dieser Bildungsform: Dieses Kapitel widmet sich den Herausforderungen und Grenzen demokratischer Bildung an Sudbury-Schulen. Es analysiert Schwierigkeiten im Umgang mit demokratischen Prozessen, die spezifischen Herausforderungen in Deutschland und die Ergebnisse von demokratischen Schulen im Allgemeinen. Schließlich wird eine kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen demokratischer Bildung im Gesamten präsentiert.
Schlüsselwörter
Demokratische Bildung, Sudbury-Schulen, Selbstbestimmung, Partizipation, Reformpädagogik, Alternativschule, Konfliktlösung, Zukunftsfähigkeit, Kompatibilität, Grenzen der Demokratie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Demokratische Bildung an Sudbury-Schulen
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht das Konzept der demokratischen Bildung, wie es an Sudbury-Schulen praktiziert wird. Sie beleuchtet die Grundlagen, Ziele und Herausforderungen dieses Ansatzes und diskutiert dessen Kompatibilität mit den Anforderungen einer demokratischen Gesellschaft. Die Arbeit analysiert die praktische Umsetzung, hinterfragt Grenzen und Potentiale und betrachtet die Zukunftsfähigkeit des Konzepts.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die theoretischen Grundlagen demokratischer Bildung, die praktische Umsetzung an Sudbury-Schulen, einen Vergleich mit traditionellen Schulformen, die Herausforderungen und Grenzen demokratischer Bildung sowie die Zukunftsfähigkeit des Konzepts. Sie analysiert das Menschenbild, das diesem Ansatz zugrunde liegt, den Umgang mit Freiheit und Leistung, die Auseinandersetzung mit Verplanungs- und Pädagogisierungstendenzen, Gehorsam, Ungehorsam und Konformität sowie den Umgang mit Konflikten. Die Arbeit untersucht auch die Anforderungen an die Bildung in der Zukunft und die Ergebnisse von ehemaligen Schülern dieser Schulform.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Demokratische Bildung an Sudbury-Schulen (mit Unterkapiteln zu Demokratie, Säulen demokratischer Bildung, Informelles und formelles Lernen, Diskrepanzen zu Regelschulen und dem historischen Erbe), die zugrundeliegenden Anliegen und philosophischen Grundlagen, Forderungen an die schulische Bildung und die Grenzen dieser Bildungsform (einschließlich Schwierigkeiten mit demokratischen Prozessen, der Situation in Deutschland und einer kritischen Auseinandersetzung mit den Grenzen demokratischer Bildung). Sie enthält zudem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Die Schlüsselwörter der Arbeit sind: Demokratische Bildung, Sudbury-Schulen, Selbstbestimmung, Partizipation, Reformpädagogik, Alternativschule, Konfliktlösung, Zukunftsfähigkeit, Kompatibilität, Grenzen der Demokratie.
Welche Fragen werden in der Einleitung gestellt?
Die Einleitung beleuchtet grundsätzliche Fragen zur Erziehung und Bildung von Kindern, problematisiert die Frage nach einem allgemein gültigen Kanon des Lernens und hinterfragt die Vorbereitung der Kinder auf eine ungewisse Zukunft. Sie fokussiert sich auf demokratische Bildung im Kontext von Sudbury-Schulen und fragt nach der Realisierbarkeit selbstbestimmter Bildung und den möglichen Ergebnissen eines solchen Ansatzes.
Was wird im Kapitel über die praktische Umsetzung an Sudbury-Schulen behandelt?
Dieses Kapitel führt in das Konzept der demokratischen Bildung an Sudbury-Schulen ein. Es definiert den Begriff der Demokratie im Bildungskontext, beleuchtet die Säulen demokratischer Bildung und analysiert den Grad der tatsächlichen Demokratisierung an diesen Schulen. Es betont den kontinuierlichen Veränderungsprozess und die Anpassungsfähigkeit des Systems, fokussiert auf die Grundfesten des Lernens, den Unterschied zwischen informellem und formelle Lernen und die Diskrepanzen zwischen Regelschulen und dem Sudbury-Modell. Es werden auch die historischen Wurzeln in der Reformpädagogik aufgezeigt.
Wie wird der Umgang mit Konflikten behandelt?
Der Umgang mit Konflikten im demokratischen Lernprozess wird analysiert, insbesondere im Kontext der Auseinandersetzung mit Gehorsam, Ungehorsam und Konformität.
Wie wird die Zukunftsfähigkeit des Konzepts bewertet?
Die Zukunftsfähigkeit wird im Kapitel "Forderungen an die schulische (Aus-)Bildung" untersucht, indem die Anforderungen an die Bildung in der Zukunft, die Kompatibilität des Sudbury-Konzeptes mit diesen Anforderungen und die Ergebnisse von ehemaligen Schülern dieser Schulform analysiert werden.
Welche Grenzen der demokratischen Bildung werden diskutiert?
Das Kapitel "Grenzen dieser Bildungsform" widmet sich den Herausforderungen und Grenzen demokratischer Bildung an Sudbury-Schulen. Es analysiert Schwierigkeiten im Umgang mit demokratischen Prozessen, die spezifischen Herausforderungen in Deutschland und die Ergebnisse von demokratischen Schulen im Allgemeinen und präsentiert eine kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen demokratischer Bildung.
- Citation du texte
- Magister Rut Kittel (Auteur), 2006, Demokratische Bildung in der Diskussion. Das Sudbury-Schulkonzept, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86403