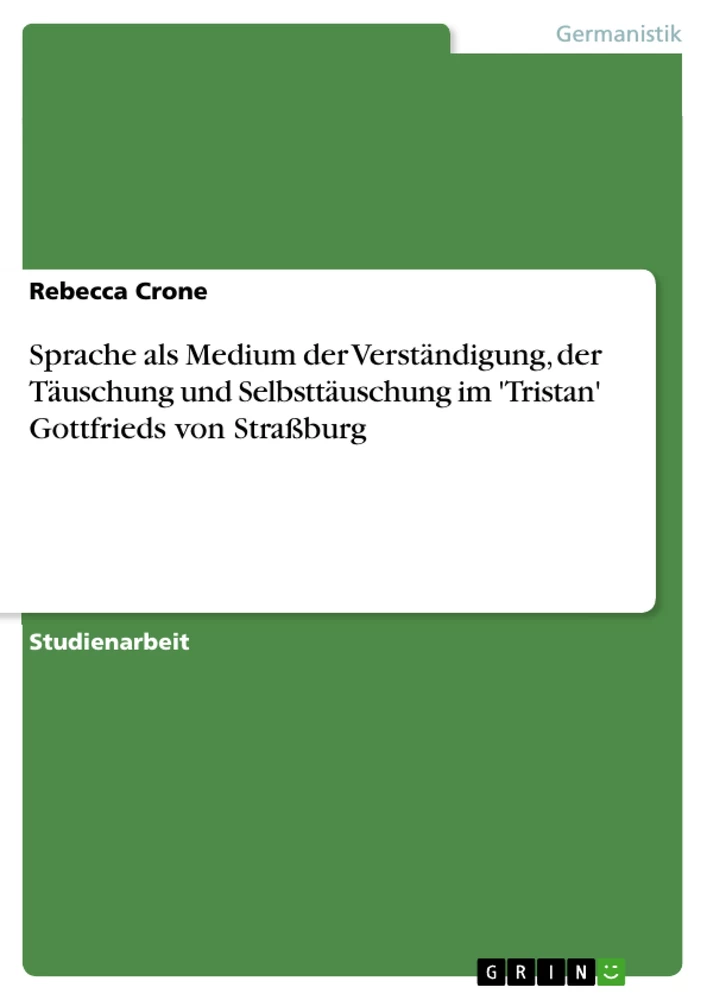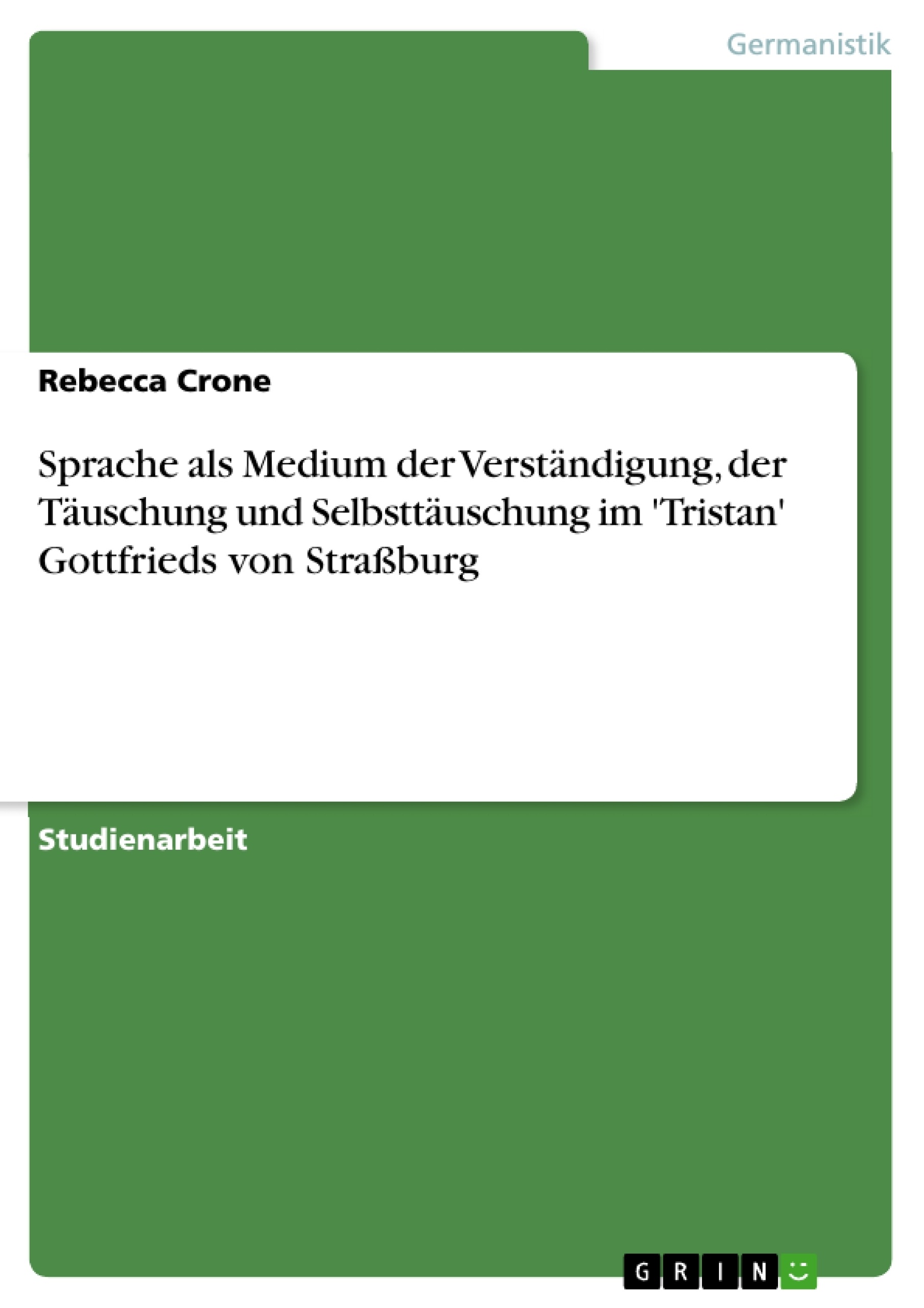Ich habe mich in meiner Arbeit für das Thema „Sprache als Medium der Verständigung, der Täuschung und Selbsttäuschung“ entschieden, da es mich beim Lesen der Lektüre fasziniert hat, in welch vielfältiger Weise Gottfried von Straßburg seine Hauptgestalten Sprache einsetzen lässt.
Gottfried von Straßburg gehört zu den bedeutendsten Dichtern des hohen Mittelalters. Er schafft es, in sein Werk so viel Gefühl einfließen zu lassen, dass die Geschichte den Leser vollkommen in ihren Bann zieht.
Ich möchte in meiner Arbeit aufzeigen, wie die Liebenden Sprache als Mittel der Täuschung und Selbsttäuschung einsetzen. Schon beim erstmaligen Lesen ist mir aufgefallen, dass die List als ständiger Begleiter der Hauptgestalten fungiert und sich wie ein roter Faden durch das Werk zieht.
Zu Beginn meiner Arbeit werde ich kurz auf den Autor des Epos und die Entstehungszeit eingehen. Des Weiteren möchte ich auf die problematische Beziehung zwischen Tristan und Isolde mit der höfischen Gesellschaft hinweisen, um dann auf die anfänglichen Hinterhalte einzugehen, die Marke für seine Frau Isolde präpariert. Darauf folgend werde ich zusätzlich auf die eingesetzte Körpersprache eingehen, um zu zeigen, dass die Figuren nicht nur durch Wortsprache täuschen. Es wird sich zeigen, dass alle Hauptfiguren Sprache als Mittel zur Täuschung einsetzen. Für mich als Leser scheint es, besonders in den Bettgesprächen so, als würden die Figuren in einen Wettstreit geraten, wer Sprache besser einsetzen kann und sie sich so darin verlieren, dass sie sich oft selbst täuschen.
Es kann wohl nicht bezweifelt werden, dass in Gottfrieds „Tristan“ die Liebe, die die beiden Hauptfiguren Tristan und Isolde aneinander kettet, Achse und Mittelpunkt darstellt, um die das ganze Geschehen sich dreht. Diese Liebe, die eigentlich nicht sein darf, treibt die beiden Liebenden in eine nicht enden wollende Spirale aus Täuschung und List.
Über den Autor des vor allem aus neuzeitlicher Sicht wohl berühmtesten Tristanromans des europäischen Mittelalters ist nichts bekannt. Seine Person ist weder in zeitgenössischen Urkunden nachweisbar, noch nennt der Autor in der Dichtung selbst seinen Namen, zumindest dann nicht, wenn man die berechtigten Zweifel daran teilt, dass es sich bei dem ersten Buchstaben des von Gottfried kunstvoll in seinen Text integrierten Akrostichons um eine bescheiden abgekürzte und getarnte Selbstnennung des Autors handelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gottfrieds „Tristan“
- 2.1 Zum Autor
- 2.2 Die Entstehungszeit
- 3. Die höfische Gesellschaft
- 4. Die Bettgespräche
- 4.1 Markes erste List
- 4.2 Markes zweite List
- 4.3 Markes dritte List
- 4.4 Die Rolle von Brangäne und Majodo
- 5. Das praktische Experiment
- 5.1 Der Hinterhalt Melots
- 5.2 Der Hinterhalt im Ölbaum
- 6. Die Minnegrotte
- 7. Tristan und Isolde Weißhand
- 8. Die Fortsetzungen von Türheim und Freiberg
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwendung von Sprache als Mittel der Verständigung, Täuschung und Selbsttäuschung in Gottfried von Straßburgs „Tristan“. Die Analyse fokussiert auf die Hauptfiguren und deren Strategien im Umgang mit Sprache in verschiedenen Situationen.
- Sprache als Werkzeug der Manipulation und Täuschung
- Die Rolle der Sprache in der Liebesbeziehung zwischen Tristan und Isolde
- Der Einfluss der höfischen Gesellschaft auf die sprachliche Kommunikation
- Selbsttäuschung als Folge strategischen Sprachgebrauchs
- Die Funktion von List und Täuschung in der Handlung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt das zentrale Thema der Arbeit: die vielfältige Verwendung von Sprache als Mittel der Verständigung, Täuschung und Selbsttäuschung in Gottfried von Straßburgs „Tristan“. Die Autorin hebt die Faszination hervor, die ihr der sprachliche Umgang der Hauptfiguren beim Lesen des Werkes vermittelt hat. Sie kündigt ihre Absicht an, aufzuzeigen, wie Tristan und Isolde Sprache als Mittel der Täuschung und Selbsttäuschung einsetzen und wie die List als roter Faden durch das Werk verläuft. Die Einleitung stellt kurz den Autor und die Entstehungszeit vor und skizziert den weiteren Aufbau der Arbeit, der die Beziehung zwischen Tristan, Isolde und der höfischen Gesellschaft, sowie die von Marke ausgehenden Hinterhalte beinhaltet.
2. Gottfrieds „Tristan“: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Autor Gottfried von Straßburg und die Entstehungszeit seines Werkes. Es wird die Unsicherheit bezüglich der Identität des Autors erörtert, wobei die Anerkennung von Gottfried von Straßburg als Autor durch andere Dichter des 13. Jahrhunderts hervorgehoben wird. Die Abschätzung der Entstehungszeit um 1210 basiert auf den literarischen Anspielungen und Erwähnungen anderer Dichter in Gottfrieds Werk, die entweder bereits verstorben oder noch am Leben waren. Das Kapitel beleuchtet somit den historischen Kontext der Entstehung des „Tristan“-Romans.
3. Die höfische Gesellschaft: Dieses Kapitel analysiert das problematische Verhältnis Tristans zum Königshof bereits vor seiner Liebesbeziehung zu Isolde. Es beschreibt Tristans schwierige Position am Hof und seinen Umgang mit Intrigen, wobei seine intellektuellen und kriegerischen Fähigkeiten, List und Verstellung betont werden. Die Liebesbeziehung zu Isolde wird als eine Steigerung der bestehenden Bedrohung durch den Hof dargestellt. Ehe und Gesellschaft werden als negativ auf die Liebesbeziehung wirkende Faktoren identifiziert, die Tristan und Isolde zu Lügen und Betrügereien zwingen und die Unvereinbarkeit der öffentlichen Sphäre des Hofes und der heimlichen Sphäre ihrer Liebe hervorheben.
Schlüsselwörter
Gottfried von Straßburg, Tristan, Isolde, Sprache, Täuschung, Selbsttäuschung, List, höfische Gesellschaft, mittelhochdeutsche Literatur, Liebesbeziehung, mittelalterliche Romanliteratur.
Häufig gestellte Fragen zu Gottfried von Straßburgs „Tristan“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die vielfältige Verwendung von Sprache in Gottfried von Straßburgs „Tristan“, insbesondere als Mittel der Verständigung, Täuschung und Selbsttäuschung. Der Fokus liegt auf den Strategien der Hauptfiguren im Umgang mit Sprache in unterschiedlichen Situationen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht unter anderem Sprache als Werkzeug der Manipulation und Täuschung, die Rolle der Sprache in der Liebesbeziehung zwischen Tristan und Isolde, den Einfluss der höfischen Gesellschaft auf die Kommunikation, Selbsttäuschung als Folge strategischen Sprachgebrauchs und die Funktion von List und Täuschung in der Handlung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung, die das Thema und den Aufbau der Arbeit umreißt; ein Kapitel über Gottfried von Straßburg und die Entstehungszeit seines Werkes; ein Kapitel über die höfische Gesellschaft und deren Einfluss auf Tristan und Isolde; Kapitel, die verschiedene Aspekte der List und Täuschung im Werk detailliert untersuchen (z.B. Markes Listen, die Bettgespräche, die Minnegrotte); ein Kapitel über die Fortsetzungen des „Tristan“ durch Türheim und Freiberg; und abschließend ein Fazit.
Wie wird die Sprache in Gottfrieds „Tristan“ dargestellt?
Die Arbeit zeigt, wie Tristan und Isolde Sprache strategisch einsetzen, um zu täuschen und sich selbst zu täuschen. Die Analyse beleuchtet, wie Sprache die Liebesbeziehung, die Intrigen am Hof und die Handlung des Werkes beeinflusst.
Welche Rolle spielt die höfische Gesellschaft?
Die höfische Gesellschaft wird als ein wichtiger Kontextfaktor dargestellt, der die Liebesbeziehung zwischen Tristan und Isolde negativ beeinflusst und sie zu Lügen und Betrügereien zwingt. Das schwierige Verhältnis Tristans zum Hof wird bereits vor seiner Beziehung zu Isolde beschrieben.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Gottfried von Straßburg, Tristan, Isolde, Sprache, Täuschung, Selbsttäuschung, List, höfische Gesellschaft, mittelhochdeutsche Literatur, Liebesbeziehung, mittelalterliche Romanliteratur.
Was ist das Ziel dieser Arbeit?
Die Arbeit möchte die komplexe und vielschichtige Verwendung von Sprache in Gottfrieds „Tristan“ aufzeigen und analysieren, wie Sprache als Mittel der Manipulation, Täuschung und Selbsttäuschung die Handlung und die Beziehungen der Figuren prägt.
- Quote paper
- Rebecca Crone (Author), 2006, Sprache als Medium der Verständigung, der Täuschung und Selbsttäuschung im 'Tristan' Gottfrieds von Straßburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86432