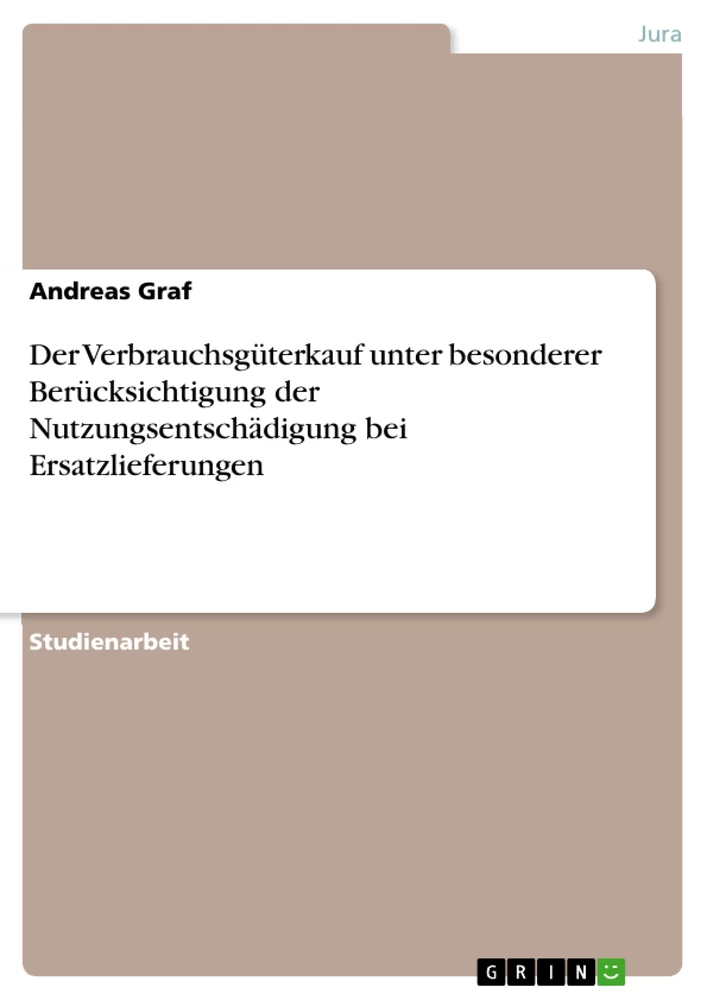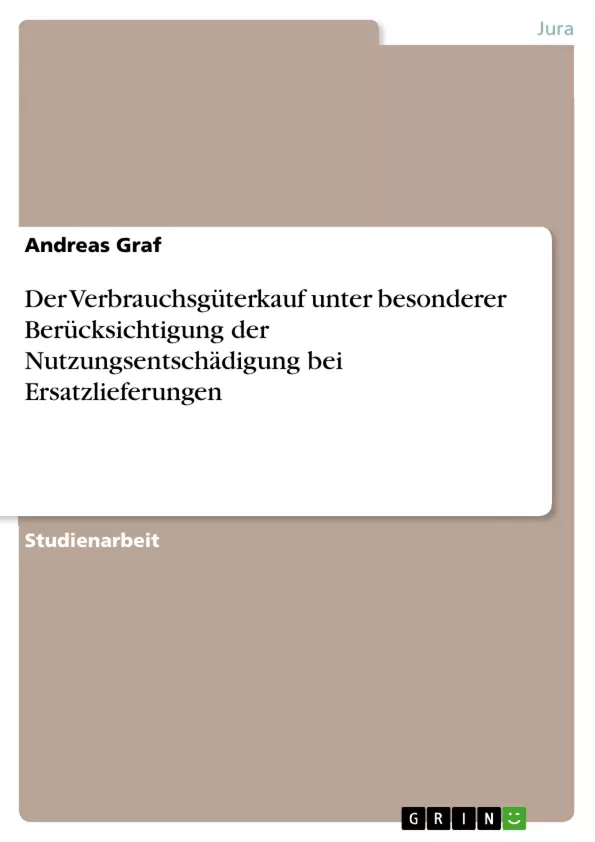Die Regelungen zum Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 - 479 BGB) wurden im Rahmen des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes in den Besonderen Teil des Schuldrechts des BGB eingearbeitet und traten erstmalig zum 1.1.2002 in Kraft. Der deutsche Gesetzgeber hat dabei die Vorgaben der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie der Europäischen Union beachtet und umgesetzt. Als wichtigste Intention dieser EU-Richtlinie ist die Verbesserung des Verbraucherschutzes im Hinblick auf den zusammenwachsenden europäischen Binnenmarkt und den damit einhergehenden freien Warenverkehr im Gemeinschaftsgebiet zu nennen. Aber auch unter dem Aspekt wachsender Marktmacht von Unternehmen, aggressiver Produktwerbung und des Feilbietens von Waren minderwertiger Qualität und kurzer Lebensdauer sollen die Rechte des Verbrauchers im Wirtschaftsleben gestärkt werden.
In der vorliegenden Arbeit soll zunächst ein Überblick über den Anwendungsbereich und die Besonderheiten beim Verbrauchsgüterkauf gegeben werden. Dazu werden die einschlägigen Regelungen des BGB dargestellt und eingehend erläutert. Dem Praxisbezug gilt dabei besonderer Augenmerk, so dass viele Beispiele und Fälle Eingang in die Arbeit gefunden haben.
Der Problemschwerpunkt richtet sich auf die Frage, ob der Verkäufer einen Anspruch auf Nutzungsentschädigung hat, wenn der Verbraucher einen Mangel an der Kaufsache geltend macht und daraufhin eine Ersatzlieferung vom Verkäufer erhält. Diese Frage wird sowohl im rechtswissenschaftlichen Schrifttum als auch von Verbraucherverbänden und Unternehmen sehr kontrovers diskutiert. Zur Verdeutlichung des Problems und zur Entwicklung von Lösungsansätzen wird ein Streitfall untersucht, der bundesweit für Aufsehen sorgte und jüngst dem BGH zur Entscheidung vorgelegen hat.
Verbraucher ist gemäß § 13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Der Personenkreis wird insofern vom § 13 BGB klar umrissen: Nur natürliche Personen können als Verbraucher handeln.
Probleme können sich in der Praxis aus der Konkretisierung des Kaufzwecks und damit der Abgrenzung zwischen der privaten und gewerblichen bzw. freiberuflichen Sphäre ergeben. Das ist z. B. dann der Fall, wenn die Kaufsache zu verschiedenen bzw. gemischten Zwecken genutzt werden soll:
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung.
- B. Die gesetzlichen Regelungen zum Verbrauchsgüterkauf.
- I. Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereich
- 1. Der Verbraucher (§ 13 BGB).
- 2. Der Unternehmer (§ 14 BGB)..
- 3. Bewegliche Sachen (§§ 90, 90a BGB)...
- 4. Der Verbrauchsgüterkauf (§ 474 Abs. I S. 1 BGB)..
- II. Sonderregelungen zum Zweck des Verbraucherschutzes....
- 1. Fall des Versendungskaufs (§ 474 Abs. II BGB)...
- 2. Abweichende Vereinbarungen (§ 475 BGB)...
- 3. Umkehrung der Beweislast (§ 476 BGB)
- 4. Sonderbestimmungen für Garantien (§ 477 BGB).
- III. Rückgriffsansprüche des Unternehmers..
- 1. Rückgriff gegen den Lieferanten (§ 478 BGB).
- 2. Verjährung von Rückgriffsansprüchen (§ 479 BGB).
- IV. Nutzungsentschädigung bei Ersatzlieferung
- 1. Zum Sachverhalt..
- 2. Auslegung des § 439 IV BGB nach der Normenlehre
- a) Grammatische Auslegung
- b) Systematische Auslegung
- c) Historische Auslegung
- d) Teleologische Auslegung
- 3. Ergebnis der Auslegung
- 4. Richtlinienkonformität des § 439 IV BGB.
- C. Ausblick.....
- Der Anwendungsbereich des Verbrauchsgüterkaufs
- Die rechtliche Situation des Verbrauchers und des Unternehmers
- Besondere Regelungen zum Verbraucherschutz
- Der Rückgriff des Unternehmers
- Die Frage der Nutzungsentschädigung bei Ersatzlieferung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Verbrauchsgüterkauf und seine Besonderheiten im deutschen Recht. Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Grundlagen des Verbrauchsgüterkaufs, insbesondere die im Schuldrechtsmodernisierungsgesetz von 2001 eingefügten Regelungen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Thema der Nutzungsentschädigung bei Ersatzlieferungen. Die Arbeit beleuchtet den Anwendungsbereich des Verbrauchsgüterkaufs, die Besonderheiten des Rechtsverhältnisses zwischen Verbraucher und Unternehmer und die relevanten Rechtsgrundlagen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung beleuchtet die rechtliche Einordnung des Verbrauchsgüterkaufs und seine Entwicklung. Dabei werden die Intentionen des Gesetzgebers und die Bedeutung des Verbraucherschutzes im europäischen Kontext hervorgehoben. Im Anschluss werden die Begriffsbestimmungen und der Anwendungsbereich des Verbrauchsgüterkaufs detailliert untersucht. Es werden die wichtigsten Begrifflichkeiten wie Verbraucher, Unternehmer und bewegliche Sache definiert und anhand von Beispielen erläutert. Die Sonderregelungen zum Verbraucherschutz werden im nächsten Kapitel behandelt. Dazu gehören unter anderem der Versendungskauf, abweichende Vereinbarungen und die Umkehrung der Beweislast. Auch Garantien und die speziellen Regelungen für den Verbraucher werden beleuchtet. Die Rückgriffsansprüche des Unternehmers werden im nächsten Kapitel untersucht. Es werden die Rechtsgrundlagen für den Rückgriff gegen den Lieferanten sowie die Verjährungsfristen für diese Ansprüche erläutert. Das Kapitel „Nutzungsentschädigung bei Ersatzlieferung“ fokussiert auf die Kernfrage der Arbeit. Es werden die rechtlichen Grundlagen für die Forderung nach Nutzungsentschädigung bei Ersatzlieferung analysiert, die unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten des § 439 IV BGB werden beleuchtet und eine umfassende Bewertung der Thematik gegeben.
Schlüsselwörter
Verbrauchsgüterkauf, Verbraucher, Unternehmer, Verbraucherschutz, Ersatzlieferung, Nutzungsentschädigung, Schuldrechtsmodernisierung, BGB, § 439 IV BGB, Rechtsprechung, Streitfall, Rechtswissenschaft
Häufig gestellte Fragen
Hat der Verkäufer Anspruch auf Nutzungsentschädigung bei Ersatzlieferung?
Dies ist ein zentraler Streitpunkt der Arbeit, der insbesondere im Hinblick auf die Richtlinienkonformität des § 439 IV BGB und die Rechte des Verbrauchers untersucht wird.
Wer gilt laut § 13 BGB als Verbraucher?
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Was bedeutet die „Umkehrung der Beweislast“ gemäß § 476 BGB?
Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten nach Gefahrübergang ein Sachmangel, wird vermutet, dass die Sache bereits bei Übergabe mangelhaft war.
Was regelt das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz für den Verbrauchsgüterkauf?
Es integrierte EU-Richtlinien in das BGB, um den Verbraucherschutz im europäischen Binnenmarkt zu stärken und Rechte bei mangelhafter Ware zu festigen.
Können Unternehmer Rückgriffsansprüche gegen Lieferanten geltend machen?
Ja, § 478 BGB regelt den Rückgriff des Unternehmers gegen seinen Lieferanten, wenn er die Ware aufgrund eines Mangels vom Verbraucher zurücknehmen musste.
- Quote paper
- Andreas Graf (Author), 2007, Der Verbrauchsgüterkauf unter besonderer Berücksichtigung der Nutzungsentschädigung bei Ersatzlieferungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86433