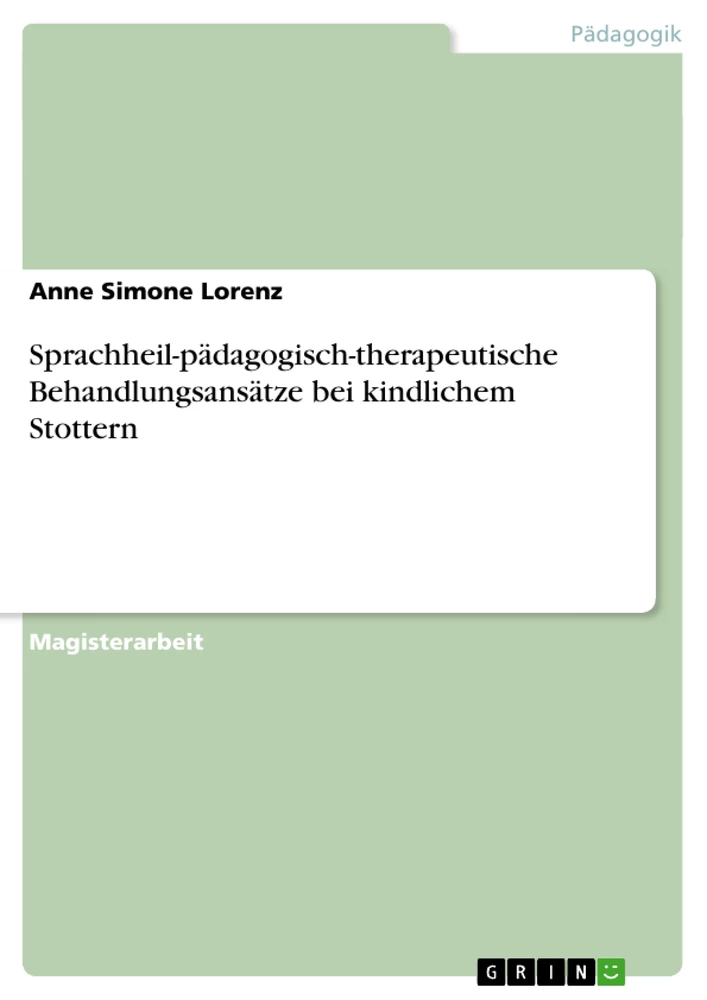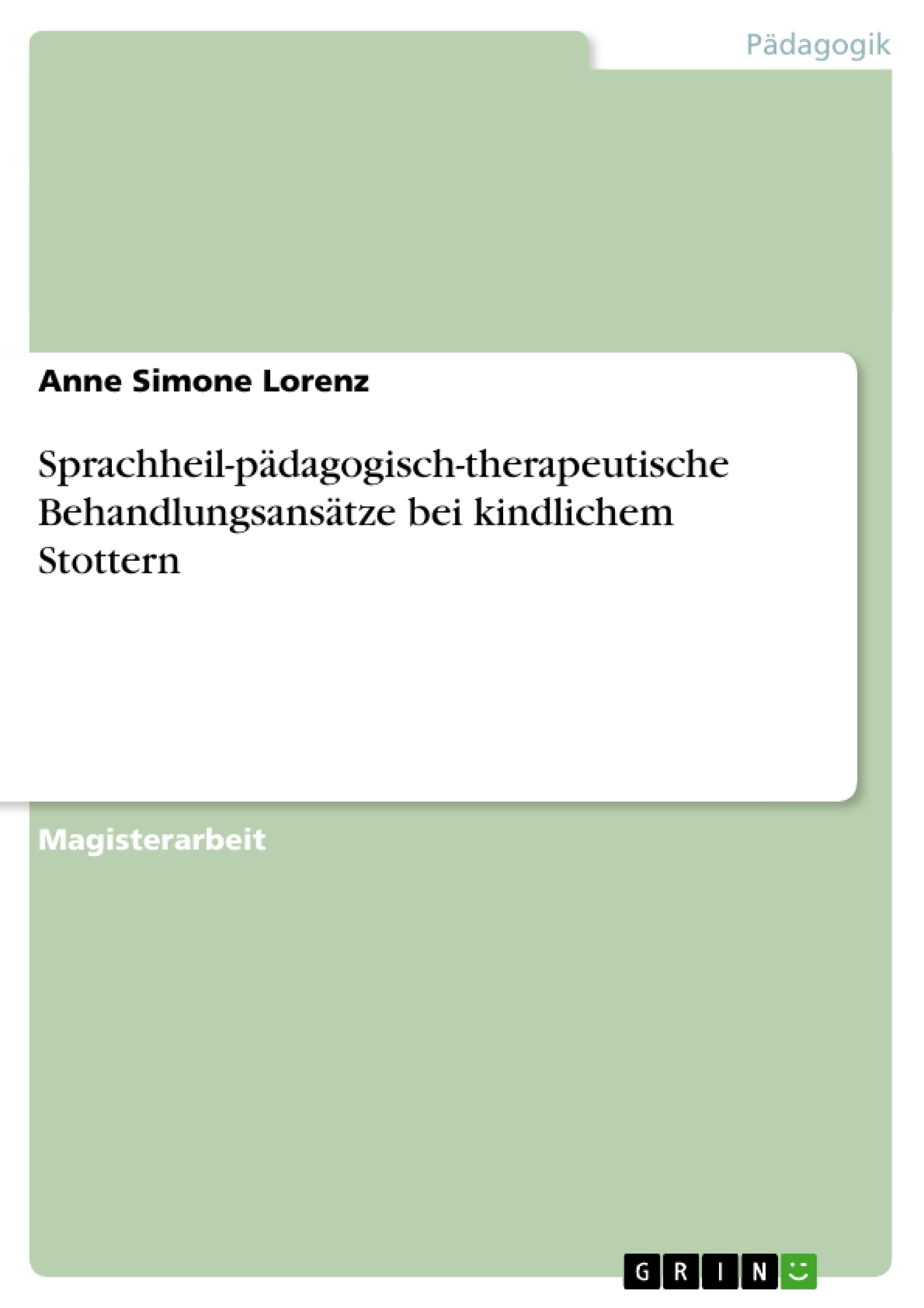Wer bei kindlichem Stottern berät, begibt sich in einen dynamischen Informationsaustausch mit dem zu Beratenden und verfolgt das Ziel, der Komplexität und Individualität des Phänomens Stottern gerecht zu werden, indem keine einseitig gedachten Therapien eingeleitet werden und andererseits alle denkbaren Möglichkeiten bei der Behandlung des Individuums Berücksichtigung und in Form von besprochenen und vereinbarten Therapiemaßnahmen Anwendung finden.
Vorab ist zunächst festzuhalten, dass es nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen keinen allgemein gültigen wirksamsten Ansatz gibt, sondern nur die optimale individuelle Methodenkombination für ein Kind und seine Familie. Die Effizienz dieser Methodenkombination ist, und hier schließt sich der Kreis, abhängig von dem gemeinsamen Austausch des Therapeuten, des Patienten und der Eltern. Nur auf diese Weise können Therapieerfolge und -misserfolge kenntlich gemacht und effiziente Methoden wirksam eingesetzt werden.
Diese Arbeit beruht auf der Annahme einer individuellen Ursachenkombination nach multikausaler Theorie und ist auf den einzelnen Patienten im Sinne der idiographischen Sichtweise bezogen. Die idiographische Sichtweise erweitert die bisherigen Ausführungen dadurch, indem sie davon ausgeht, dass jede sprachliche Auffälligkeit in der Lage ist, ihre eigene biographische Vorgeschichte und ihre eigene Problematik vorzuweisen. Das entsprechende diagnostisch-therapeutische Konzept berücksichtigt vorhandene Ressourcen und Kompetenzen betroffener Personen. Nach Iven (1995) besteht die Aufgabe der Therapeutin darin, eine therapeutische Beziehung zu schaffen, in der Selbstreflexion und eigengesteuerte Handlungsalternative möglich werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Vorwort
- II. Einleitung
- III. Klinisches Bild
- III.1 Kindliches Stottern
- III.1.1 Definition
- III.1.2 Häufigkeit und Verbreitung
- III.1.3 Kern- und Begleitsymptome
- III.1.4 Abgrenzung normaler Sprechunflüssigkeiten von beginnendem Stottern
- III.2 Entstehung des Stotterns
- III.2.1 Aktueller Forschungsstand
- III.2.2 Ursachen des Stotterns
- III.2.3 Begleitende Faktoren des Stotterns
- III.3 Psycholinguistische Dimension des Stotterns
- III.4 Entwicklungsverläufe
- IV. (Sprachheil-)pädagogisch-therapeutische Beratung
- IV.1 Anamneseerhebung: Situation des Erstgesprächs
- IV.2 Anamnesefragebogen
- IV.2.1 Beschreibung der aktuellen Symptomatik
- IV.2.2 Wie gehen Kind und Umwelt mit dem Stottern um?
- IV.2.3 Therapiemotivation bei Eltern und Kind
- IV.2.4 Anwesenheit des Kindes?
- IV.3 Befunderhebung
- IV.3.1 Erstdiagnostik als Grundlage der Therapieplanung
- IV.3.2. Ressourcenorientierte Diagnostik und Therapie
- IV.3.3 Umgang mit Stottern als Tabuthema
- IV.3.4 Durchführung und Dokumentation der Untersuchung
- IV.4 Befundbogen
- IV.4.1 Von der Diagnostik zur Therapieplanung
- IV.4.2 Untersuchung verschiedener Sprechleistungsstufen
- IV.4.3 Beobachtung von Einflussfaktoren
- V. (Sprachheil-)pädagogisch-therapeutische Behandlung
- V.1 Therapieansätze
- V.1.1 Direkte und indirekte Therapieansätze
- V.1.2 Indikationskriterien für die Auswahl des Therapieansatzes
- V.1.3 Elternberatung, Elterarbeit und Elterntraining
- V.1.4 Spieltherapeutisch geprägte Sprachtherapie (Katz-Bernstein)
- V.1.5 Fluency-Shaping-Programme
- V.1.6 Sprechtechniken
- V.1.7 Modifikationstherapie nach Dell und van Riper (»Non Avoidance«)
- V.2 Kriterien und Voraussetzungen für die Therapie
- V.2.1 Gründe für frühzeitigen Therapiebeginn
- V.2.2 Indikationen
- V.2.3 Prognosefaktoren
- V.2.4 Therapeutische Grundhaltungen gegenüber Kind und Bezugspersonen
- V.3 Umgang mit dem Stottern in der Therapie
- V.3.1 Akzeptanz des Stotterns durch die Therapeutin
- V.3.2 Flüssigere Perioden
- V.4 Förderung mit Therapiebausteinen
- V.4.1 Die Therapiebausteine
- V.4.2 Atemtherapie und Tonusregulation
- V.4.3 Körpersprache und rhythmisch-melodischer Ausdruck
- V.4.4 Modifikation des Stotterns und Modeling
- V.5 (Sprachheil-)pädagogisch-therapeutische Beratung
- V.5.1 Beratungsaspekte
- V.5.2 Information zum Stottern und zu beeinflussenden Faktoren
- V.5.3 Allgemeine Förderung des flüssigen Sprechens
- V.5.4 Sprachliches Kommunikationsverhalten
- V.6. Ende der (sprachheil-)pädagogisch-therapeutischen Beratung und Behandlung
- Anamneseerhebung und Befunderhebung als Grundlage der Therapieplanung
- Verschiedene Therapieansätze für Stottern bei Kindern, ihre Indikationen und Voraussetzungen
- Die Bedeutung von Elternberatung, Elterarbeit und Elterntraining in der Stottertherapie
- Umgang mit dem Stottern in der Therapie, Förderung mit Therapiebausteinen
- Die Rolle der (sprachheil-)pädagogisch-therapeutischen Beratung in der Stottertherapie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit zielt darauf ab, die (sprachheil-)pädagogisch-therapeutischen Beratungs- und Behandlungsansätze bei kindlichem Stottern zu beleuchten und zu analysieren. Der Fokus liegt dabei auf der praktischen Anwendung und der optimalen Unterstützung von Kindern, die unter Stottern leiden.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition von kindlichem Stottern, einschließlich der Häufigkeit, Kern- und Begleitsymptome und der Abgrenzung von normalen Sprechunflüssigkeiten. Anschließend wird die Entstehung des Stotterns beleuchtet, wobei der aktuelle Forschungsstand, Ursachen und begleitende Faktoren betrachtet werden.
Die Kapitel IV und V befassen sich mit der (sprachheil-)pädagogisch-therapeutischen Beratung und Behandlung. Die Anamneseerhebung, der Anamnesefragebogen, die Befunderhebung und die Therapieplanung werden detailliert beschrieben. Es werden verschiedene Therapieansätze, deren Indikationskriterien und Voraussetzungen sowie die Bedeutung der Elternberatung und des Elterntrainings vorgestellt.
Im weiteren Verlauf wird der Umgang mit dem Stottern in der Therapie, die Förderung mit Therapiebausteinen und die Rolle der (sprachheil-)pädagogisch-therapeutischen Beratung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kindliches Stottern, Sprachheilpädagogik, (sprachheil-)pädagogisch-therapeutische Beratung, Therapieansätze, Elternberatung, Elterntraining, Anamnese, Befunderhebung, Therapieplanung, Stottertherapie, Behandlungsansätze.
- Citar trabajo
- Magistra Artium Anne Simone Lorenz (Autor), 2007, Sprachheil-pädagogisch-therapeutische Behandlungsansätze bei kindlichem Stottern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86540