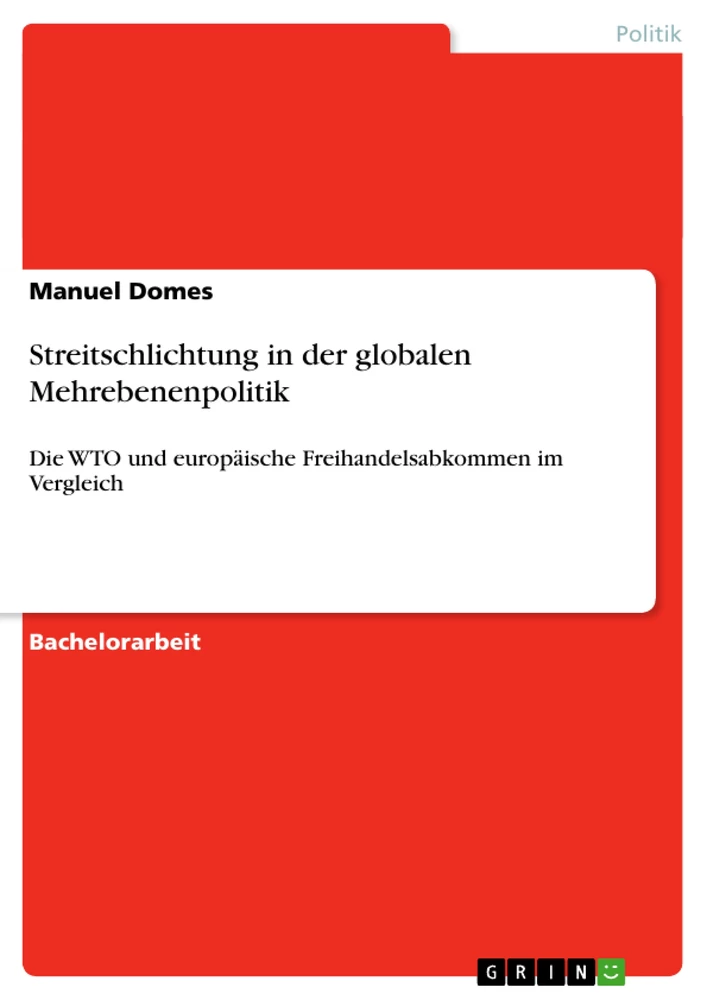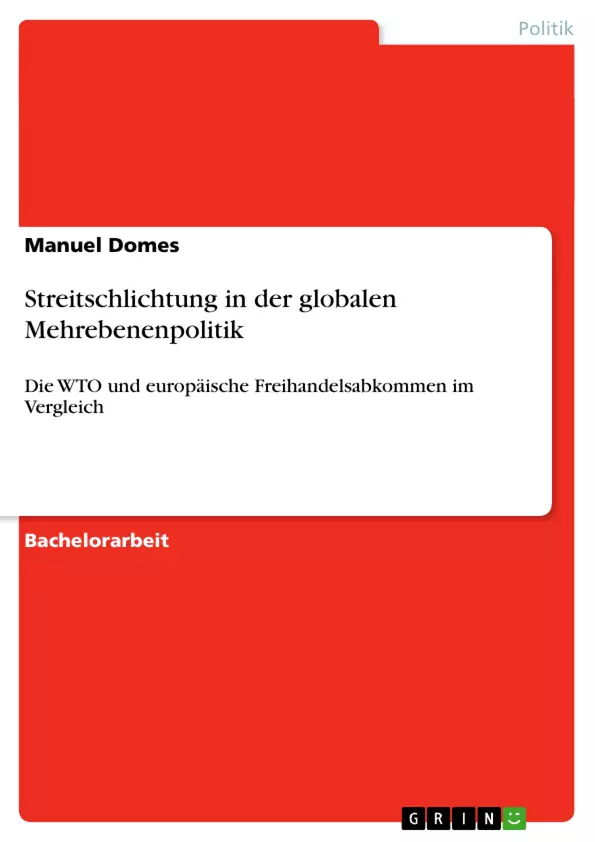Zwei Großtrends haben die internationalen Wirtschaftsbeziehungen und deren politische Gestaltung seit den 90er Jahren dominiert. Dies sind zum einen die zunehmende Institutionalisierung durch die WTO, deren quasi-universeller Charakter und die fortschreitende Verrechtlichung der Handelsbeziehungen im Rahmen des WTO-Streitschlichtungsmechanismus.
Parallel hierzu entwickelt sich aber auch noch eine andere Dimension der Welthandelsordnung beständig weiter fort, die durch zunehmende Regionalisierung und das Schließen von Freihandelsabkommen außerhalb des multilateralen Rahmens der WTO geprägt ist.
Während der Verrechtlichungsschritt vom GATT zur WTO von einer Vielzahl von Studien untersucht und kritisch reflektiert wurde (stellvertretend für viele: Zangl 2006), gibt es nur wenige Studien, die die WTO mit ihren regionalen und bilateralen Gegenparts in Bezug auf den Aspekt der Streitschlichtung hin systematisch vergleichen. Hier liegt das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit.
„Streitschlichtung“ ist nämlich ein weiter Begriff, und der von der WTO vorgezeichnete Weg einer weitgehend verrechtlichten Streitbeilegung, welcher häufig quasirechtsstaatliche Qualitäten zugeschrieben werden (Zangl 2006, Robles 2006), ist bei weitem nicht die einzige Option für die Beilegung zwischenstaatlicher Meinungsverschiedenheiten.
In meinem Ansatz kommt der Berücksichtigung von Machtasymmetrien für die Analyse des Ausmaßes von Verrechtlichung eine entscheidende Rolle zu. Denn echte Verrechtlichung, sowohl der Normen wie auch des Verhaltens, lässt sich nur feststellen, wenn auch im internationalen Rahmen, analog zum nationalen Rechtsstaat, die Gleichheit vor dem Gesetz gilt und auch durchgesetzt wird. Vor diesem Hintergrund begründet sich auch das besondere Augenmerk dieser Studie auf die Perspektive von Entwicklungsländern im Welthandel.
Eine Analyse der im Rahmen der WTO erreichten Verrechtlichung unter besonderer Berücksichtigung von Machtasymmetrien wird dementsprechend als analytische Folie für den Vergleich mit ihren regionalen Gegenparts dienen. Abschließend werde ich auch auf die vielfältigen Interaktionen und Interdependenzen zwischen diesen Ebenen eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen und Begriffserläuterungen
- Theoretischer Rahmen: Verrechtlichung der internationalen Beziehungen
- Die institutionalistische Perspektive
- Zur Rolle von Machtasymmetrien
- Die Ausbreitung der Verrechtlichung von Verfahren und Verhalten
- Operationalisierung
- Verrechtlichung im Rahmen der WTO
- Vom GATT zur WTO: Institutionelle Grundlagen der Streitschlichtung
- Vor- und Nachteile des Verfahrens für Entwicklungsländer
- Untersuchung
- Eine erste Bilanz
- Statistische Analysen des Streitverhaltens
- Qualitative Fallstudien
- Zusammenfassung: Verrechtlichung von Verfahren und Verhalten?
- Verrechtlichung in regionalen Handelsabkommen
- Vier EU-Abkommen im Vergleich
- Südafrika
- Mexiko
- Chile
- Economic Partnership Agreements
- Zusammenfassung und Bewertung der Befunde
- Vier EU-Abkommen im Vergleich
- Bewertung und Ausblick
- Verrechtlichung „,à la carte\"?
- Der Nutzen der institutionalistischen Perspektive
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Streitschlichtung in der globalen Mehrebenenpolitik, indem sie die WTO und europäische Freihandelsabkommen hinsichtlich ihres Verrechtlichungsgrades vergleicht. Sie verfolgt dabei das Ziel, die Entwicklungen in der Welthandelsordnung zu analysieren und zu bewerten, insbesondere im Hinblick auf die Rolle von Machtasymmetrien und die Perspektive von Entwicklungsländern.
- Verrechtlichung von Streitschlichtungsverfahren in der WTO und in regionalen Handelsabkommen
- Rolle von Machtasymmetrien und die Bedeutung der Perspektive von Entwicklungsländern
- Vergleich verschiedener institutioneller Designs und ihrer Auswirkungen auf die Verrechtlichung
- Bewertung des Trends zur „Entrechtlichung“ in der Welthandelsordnung
- Nützlichkeit der institutionalistischen Perspektive für die Analyse der Streitschlichtung in der globalen Mehrebenenpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Streitschlichtung in der globalen Mehrebenenpolitik ein und stellt die Relevanz des Themas dar. Kapitel 2 behandelt die Grundlagen und Begriffserläuterungen, während Kapitel 3 den theoretischen Rahmen der Arbeit, die institutionalistische Perspektive, erläutert. Kapitel 4 befasst sich mit der Verrechtlichung im Rahmen der WTO und analysiert die Entwicklung des WTO-Streitschlichtungsmechanismus. Kapitel 5 vergleicht die Verrechtlichung in vier EU-Freihandelsabkommen und bewertet die Befunde. Kapitel 6 schließlich diskutiert die Bewertung und den Ausblick auf die Zukunft der Streitschlichtung in der globalen Mehrebenenpolitik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen der Verrechtlichung, Streitschlichtung, Machtasymmetrien, WTO, Freihandelsabkommen, Entwicklungsländer, institutionalistische Perspektive, globale Mehrebenenpolitik und der Welthandelsordnung. Die Studie analysiert die Prozesse der Verrechtlichung in verschiedenen institutionellen Kontexten und befasst sich insbesondere mit der Bedeutung der Perspektive von Entwicklungsländern im Welthandel.
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert die Streitschlichtung in der WTO?
Der WTO-Streitschlichtungsmechanismus ist ein hochgradig verrechtlichtes Verfahren, das auf festen Regeln basiert und quasirechtsstaatliche Qualitäten zur Beilegung von Handelskonflikten besitzt.
Was ist der Unterschied zwischen der WTO und regionalen Handelsabkommen?
Regionale Abkommen (wie die der EU mit Mexiko oder Chile) weisen oft unterschiedliche Grade der Verrechtlichung auf, die in der Arbeit systematisch mit dem multilateralen Rahmen der WTO verglichen werden.
Welche Rolle spielen Machtasymmetrien bei der Streitschlichtung?
Echte Verrechtlichung setzt voraus, dass auch kleine Entwicklungsländer ihre Rechte gegenüber mächtigen Industriestaaten durchsetzen können. Die Arbeit untersucht, ob dies in der Praxis gelingt.
Was versteht man unter „Verrechtlichung à la carte“?
Der Begriff beschreibt den Trend, dass Staaten je nach Interesse zwischen verschiedenen Streitschlichtungsebenen wählen, was zu einer „Entrechtlichung“ der globalen Ordnung führen kann.
Bietet die WTO Vorteile für Entwicklungsländer?
Die Arbeit analysiert Vor- und Nachteile des Verfahrens und zieht eine Bilanz anhand statistischer Analysen des Streitverhaltens und qualitativer Fallstudien.
- Arbeit zitieren
- Manuel Domes (Autor:in), 2007, Streitschlichtung in der globalen Mehrebenenpolitik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86565