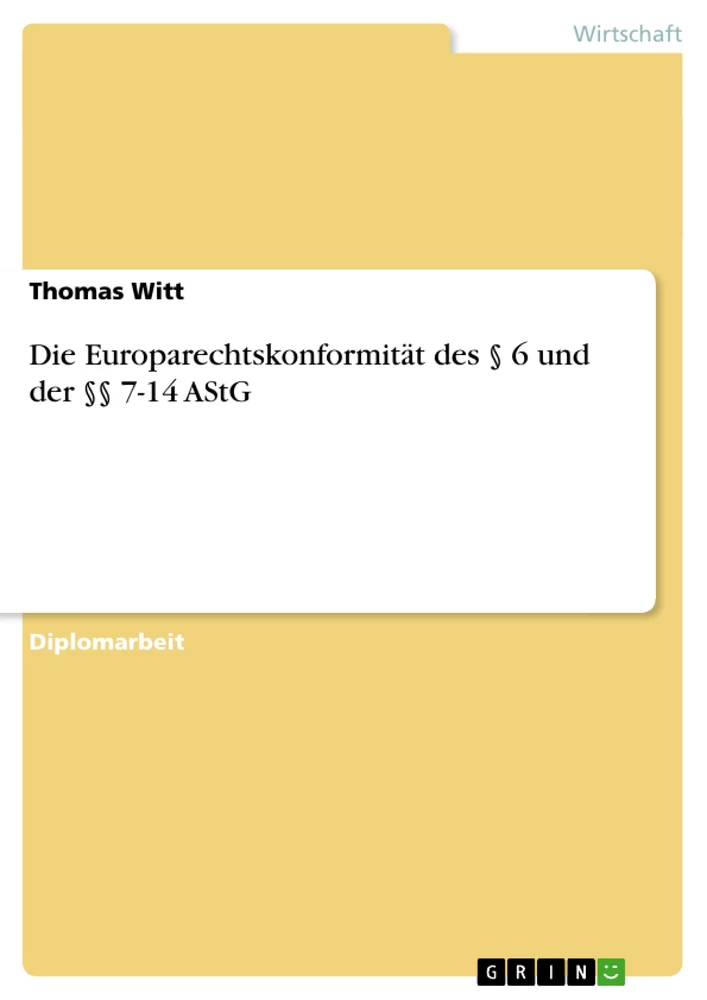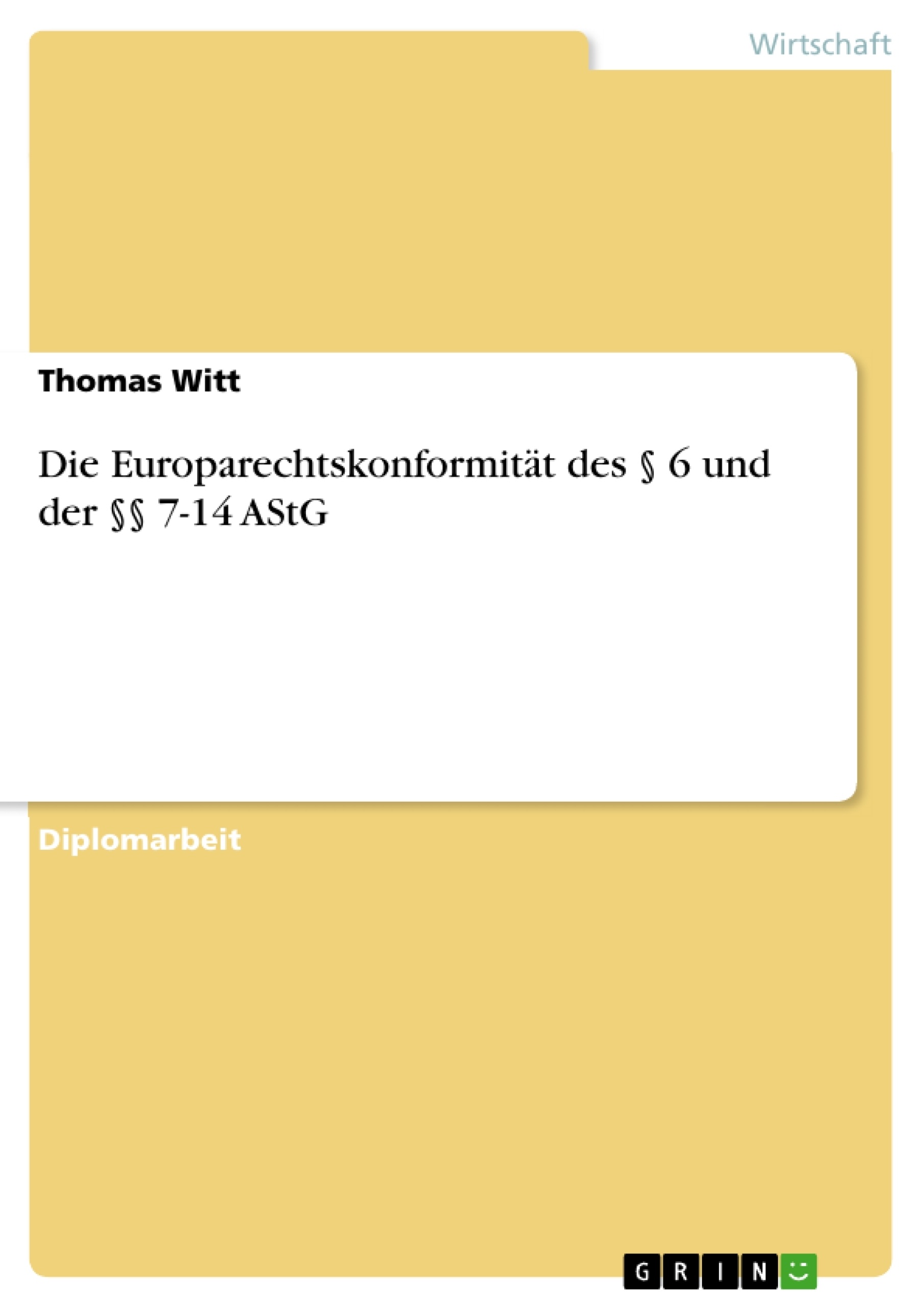1. Einleitung
1.1 Problemstellung
Schon vor gut zwei Jahrhunderten beschrieb der berühmte Philosoph Immanuel Kant in seiner visionären Schrift „Zum ewigen Frieden“ die wohlfahrtssteigernde Kraft ökonomischer Wertschöpfung. Auch Vertreter der Freihandelslehre wie z.B. Adam Smith und David Ricardo propagierten die Liberalisierung der nationalen Faktor- und Gütermärkte zur Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsraumes, der zu einer Steigerung der Gesamtwohlfahrt führen sollte. Beginnend mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Jahre 1957, wurde im selbigen Vertrag der freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Arbeit und Kapital erstmalig kodifiziert. Die Idee des gemeinsamen Binnenmarktes wurde anfangs durch sekundärrechtliche Maßnahmen wie z.B. die EG-Amtshilfe-Richtlinie oder die Mutter-Tochter-Richtlinie umgesetzt. Erst in den letzten Jahren wurde das Binnenmarktkonzept zunehmend durch primäres Gemeinschaftsrecht umgesetzt bzw. gewährleistet.
Durch die Unterzeichnung der „Europäischen Verträge“ hat sich die Bundesrepublik Deutschland u.a. zur Einhaltung der europäischen Grundfreiheiten und den sich daraus ergebenden Diskriminierungs- und Beschränkungsverboten verpflichtet. Diesem rechtswirksamen Bekenntnis zu einer liberalen Wirtschaftsordnung steht das Interesse der Bundesrepublik Deutschland auf die Durchführung eigener wirtschafts- und fiskalpolitischer Ziele entgegen. Diesem Konkurrenzverhältnis wurde jedoch bis weit in die neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts keine große Bedeutung beigemessen. Erst in den letzten Jahren häuften sich die Klagen von Marktteilnehmern gegen potentiell gemeinschaftsrechtswidrige nationale Rechtsnormen. Die dadurch vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft (EuGH) erlassenen Urteile verschärfen vor allem im Bereich der direkten Steuern das Spannungsverhältnis zwischen den dem Binnenmarktgedanken zu Grunde liegenden europäischen Grundfreiheiten und dem nationalen Steuerrecht der einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft. Der Gesetzgeber wird sich dadurch einer Vielzahl von Herausforderungen stellen müssen. Mit den BMF-Schreiben v. 08.06.2005 und v. 08.01.2007 wurde im Bereich des AStG ein erster Versuch unternommen, diesen Herausforderungen zu begegnen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wichtige europäische Grundfreiheiten und ihre Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft
- Grundlagen
- Schutzbereich der Grundfreiheiten des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
- Rechtfertigungsgründe für die Beeinträchtigung der Grundfreiheiten
- Die Prüfung der Europarechtskonformität des § 6 AStG
- Die Konzeption des § 6 AStG a.F.
- Verstoß des § 6 AStG a.F. gegen die Grundfreiheiten des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
- Ergebnis der Untersuchung der Europarechtskonformität des § 6 AStG a.F.
- Würdigung der Neufassung des § 6 AStG durch das SESTEG als Reaktion des deutschen Gesetzgebers auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs „de Lasteyrie du Saillant“
- Die Prüfung der Europarechtskonformität der §§ 7-14 AStG
- Allgemeines
- Zielsetzung und Leitkonzepte der §§ 7-14 AStG
- Verstoß der §§ 7-14 AStG gegen die Grundfreiheiten des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
- Ergebnis der Untersuchung der Europarechtskonformität der §§ 7-14 AStG
- Zusammenfassung und Ausblick auf aktuelle Entwicklungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Europarechtskonformität des § 6 und der §§ 7-14 des Außensteuergesetzes (AStG). Ziel ist es, die Vereinbarkeit dieser Paragraphen mit den europäischen Grundfreiheiten zu prüfen und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen der deutschen Gesetzgebung auf die Freizügigkeit von Kapital und Arbeitnehmern im europäischen Binnenmarkt.
- Europarechtskonformität des § 6 AStG
- Europarechtskonformität der §§ 7-14 AStG (Controlled Foreign Corporation Legislation)
- Europäische Grundfreiheiten (Niederlassungsfreiheit, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Kapitalverkehrsfreiheit)
- Rechtfertigungsgründe für Einschränkungen der Grundfreiheiten
- Analyse der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Europarechtskonformität des § 6 und der §§ 7-14 AStG ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Sie skizziert die Problemstellung, die im weiteren Verlauf detailliert untersucht wird – die Vereinbarkeit deutscher Steuergesetze mit europäischem Recht.
Wichtige europäische Grundfreiheiten und ihre Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die spätere Prüfung der Europarechtskonformität. Es erläutert die Ziele, Organe und Rechtsakte der Europäischen Union, den Vorrang des EU-Rechts und die materiellen und formellen Maßstäbe der europäischen Grundfreiheiten, insbesondere der Niederlassungsfreiheit, der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der Kapitalverkehrsfreiheit. Es analysiert detailliert die Schutzbereiche dieser Freiheiten und die möglichen Rechtfertigungsgründe für deren Einschränkungen durch nationale Gesetzgebungen.
Die Prüfung der Europarechtskonformität des § 6 AStG: Dieses Kapitel untersucht die alte Fassung des § 6 AStG und dessen Vereinbarkeit mit den europäischen Grundfreiheiten anhand des Urteils des Europäischen Gerichtshofs „de Lasteyrie du Saillant“. Die Analyse umfasst die systematische Stellung und den Zweck des Paragraphen, seine Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolgen. Die Auswirkungen des Gerichtsurteils auf die deutsche Gesetzgebung werden ebenso beleuchtet, wie die Reaktion des deutschen Gesetzgebers durch die Neufassung des § 6 AStG.
Die Prüfung der Europarechtskonformität der §§ 7-14 AStG: Dieses Kapitel befasst sich mit der Prüfung der §§ 7-14 AStG, die die Besteuerung von Controlled Foreign Corporations (CFCs) regeln. Es analysiert die Zielsetzung und die Konzeption dieser Paragraphen, die Tatbestandsvoraussetzungen und die Rechtsfolgen. Der Fokus liegt auf der Vereinbarkeit mit den europäischen Grundfreiheiten, insbesondere im Kontext des Urteils „Cadbury-Schweppes“. Die Kapitel untersucht verschiedene gemeinschaftsrechtliche Problemfelder auf der Tatbestandsebene und der Rechtsfolgenebene der §§ 7-14 AStG und die damit verbundenen Herausforderungen für die deutsche Steuergesetzgebung.
Schlüsselwörter
Europarecht, Außensteuergesetz (AStG), § 6 AStG, §§ 7-14 AStG, Grundfreiheiten, Niederlassungsfreiheit, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Kapitalverkehrsfreiheit, Europäischer Gerichtshof, Controlled Foreign Corporation (CFC), Rechtfertigungsgründe, Steuerharmonisierung, de Lasteyrie du Saillant, Cadbury-Schweppes.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Europarechtskonformität des Außensteuergesetzes (AStG)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Vereinbarkeit des § 6 und der §§ 7-14 des deutschen Außensteuergesetzes (AStG) mit dem Europarecht. Der Fokus liegt auf der Prüfung der Konformität mit den europäischen Grundfreiheiten und der Analyse relevanter Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH).
Welche europäischen Grundfreiheiten werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Niederlassungsfreiheit, die Arbeitnehmerfreizügigkeit und die Kapitalverkehrsfreiheit. Es wird analysiert, wie diese Freiheiten durch das AStG potenziell beeinträchtigt werden und welche Rechtfertigungsgründe gegebenenfalls greifen.
Wie wird die Europarechtskonformität des § 6 AStG geprüft?
Die Arbeit analysiert die alte und neue Fassung des § 6 AStG im Lichte der Rechtsprechung des EuGH, insbesondere unter Bezugnahme auf das Urteil „de Lasteyrie du Saillant“. Es wird untersucht, ob der Paragraph mit den europäischen Grundfreiheiten vereinbar ist und wie der deutsche Gesetzgeber auf das EuGH-Urteil reagiert hat.
Wie wird die Europarechtskonformität der §§ 7-14 AStG geprüft?
Die §§ 7-14 AStG, die die Besteuerung von Controlled Foreign Corporations (CFCs) regeln, werden auf ihre Vereinbarkeit mit den europäischen Grundfreiheiten geprüft. Die Analyse berücksichtigt die Zielsetzung und Konzeption dieser Paragraphen sowie relevante Rechtsprechung, beispielsweise das Urteil „Cadbury-Schweppes“. Die Arbeit beleuchtet verschiedene gemeinschaftsrechtliche Problemfelder auf der Tatbestandsebene und der Rechtsfolgenebene.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Europarecht, Außensteuergesetz (AStG), § 6 AStG, §§ 7-14 AStG, Grundfreiheiten, Niederlassungsfreiheit, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Kapitalverkehrsfreiheit, Europäischer Gerichtshof, Controlled Foreign Corporation (CFC), Rechtfertigungsgründe, Steuerharmonisierung, de Lasteyrie du Saillant, Cadbury-Schweppes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den wichtigen europäischen Grundfreiheiten und ihrer Auslegung durch den EuGH, ein Kapitel zur Prüfung der Europarechtskonformität des § 6 AStG, ein Kapitel zur Prüfung der Europarechtskonformität der §§ 7-14 AStG und eine Zusammenfassung mit Ausblick.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Vereinbarkeit des § 6 und der §§ 7-14 AStG mit den europäischen Grundfreiheiten zu untersuchen und die Auswirkungen der deutschen Steuergesetzgebung auf die Freizügigkeit von Kapital und Arbeitnehmern im europäischen Binnenmarkt zu beleuchten.
- Quote paper
- Thomas Witt (Author), 2007, Die Europarechtskonformität des § 6 und der §§ 7-14 AStG, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86570