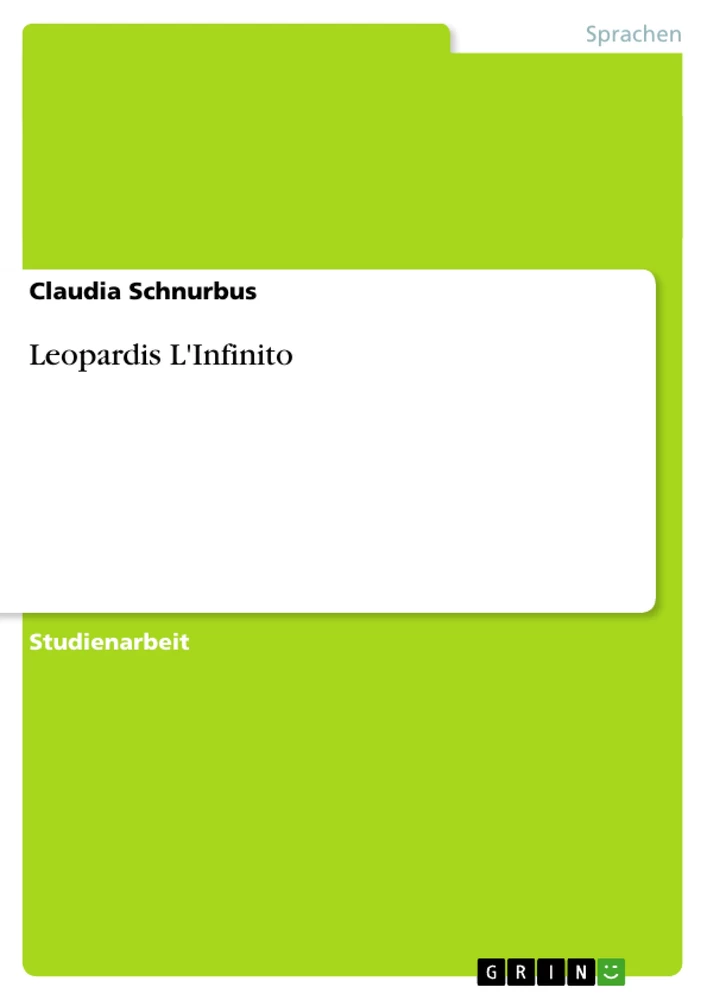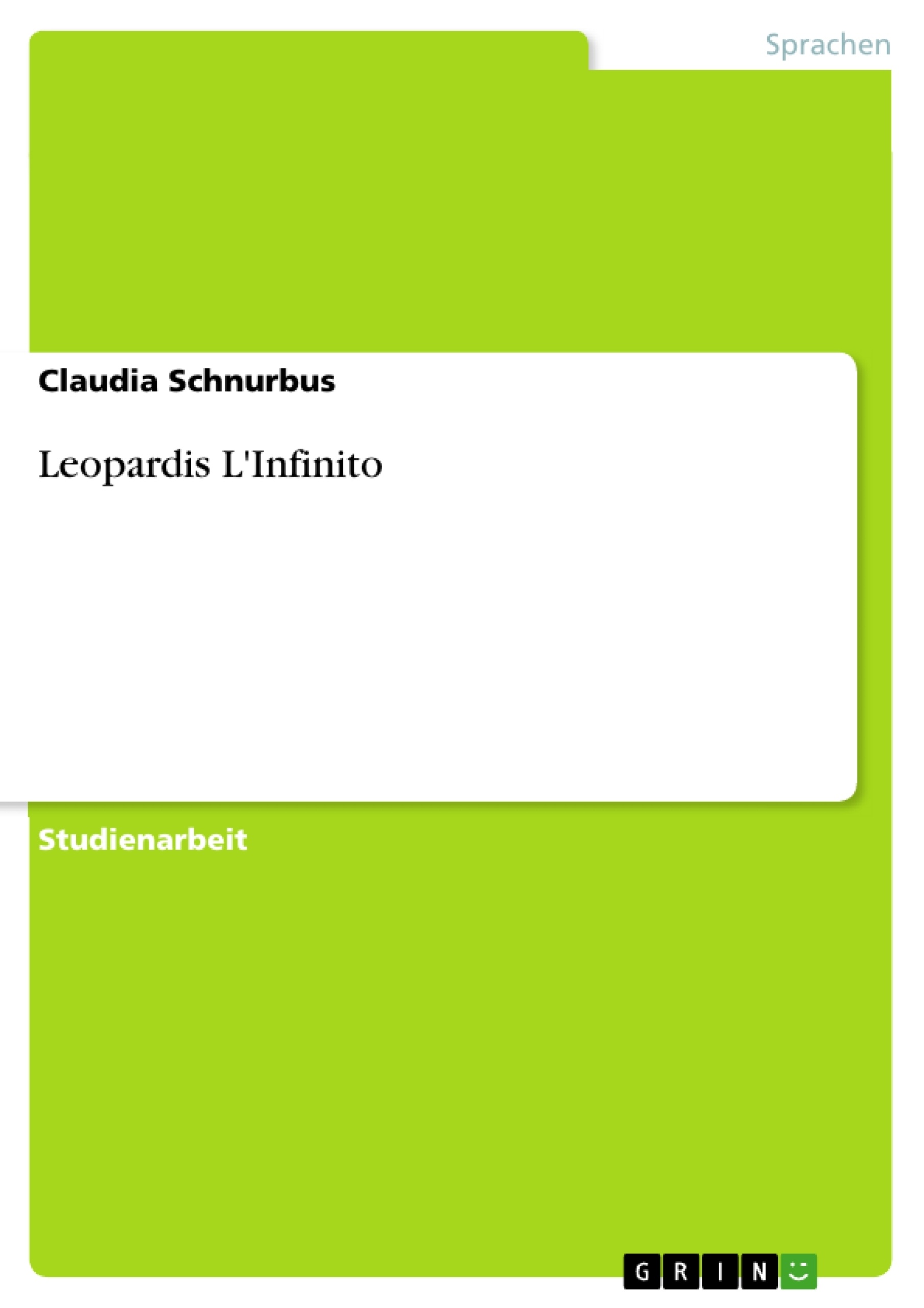Giacomo Leopardi, einer der bedeutendsten Dichter der italienischen Literaturgeschichte, wurde 1798 als Sohn einer verarmten Adelsfamilie geboren. Leopardi wuchs zurückgezogen von der Welt in der verschlafenen Provinz Recanati in einer durch die Napoleonischen Feldzüge und die Französische Revolution von Unruhen geprägten Zeit auf. Er entpuppte sich schon früh als "Wunderkind", das sich selbst Griechisch und Hebräisch beibrachte und schon mit sechzehn Jahren alle wichtigen klassischen lateinischen und griechischen Texte gelesen hatte. Seine außergewöhnliche Intelligenz, eine leichte Körperbehinderung und die Erziehung durch seinen reaktionären und konservativen Vater grenzten ihn während seiner Jugend stark von seinen Altersgenossen ab. In dieser Umgebung entwickelte Leopardi ein sehr pessimistisches Weltbild, das sich in seinem ganzen Werk niederschlägt und ausdrückt, wie langweilig und sinnlos er das Leben empfand.
Rein zeitlich gesehen kann man Leopardi als Romantiker bezeichnen. Obwohl er einerseits den Rationalismus und die Entmystifizierung der Welt durch die Aufklärung bedauerte, spielt in seinen Werken besonders auch aufklärerisches Gedankengut eine große Rolle. Im Gegensatz zu den Romantikern, die das Mittelalter wiederbeleben wollten, galt ihm die Antike als ideales Vorbild. Sein Werk besteht aus vielen, teilweise unfertigen und unveröffentlichten Dramen, Essays und Gedichten. Seine wichtigsten Werke sind die "Canti", die "Operette morali", seine "Pensieri" und das sehr umfangreiche tagebuchähnliche "Zibaldone".
Leopardi war - soviel lässt sich zumindest sagen - ein hoffnungsloser Pessimist und Nihilist, dessen Werk Ausdruck eines bestimmten Lebensgefühls ist, geprägt von seiner persönlichen Biographie.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Interpretation des Gedichtes L'Infinito
- Erste formale Analyse und Gliederung des Gedichts
- Idyllische und religiöse Elemente
- Die Unendlichkeit - Furcht oder Trost?
- Der Wind als Stimme
- Die Metapher des Schiffbruchs
- Poesie des Indefinito
- Leopardi im Vergleich mit Pascal
- Blaise Pascal und seine Philosophie
- Warum ein Vergleich zwischen Leopardi und Pascal?
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Analyse und Interpretation des Gedichts „L'Infinito“ von Giacomo Leopardi. Sie setzt sich zum Ziel, die formale und inhaltliche Struktur des Gedichtes zu analysieren und seine zentralen Themen zu beleuchten. Darüber hinaus wird ein Vergleich zwischen Leopardis Gedankengut und dem von Blaise Pascal gezogen, um die Ähnlichkeiten und Unterschiede in ihren philosophischen Ansätzen zu beleuchten.
- Formale Analyse des Gedichts „L'Infinito“
- Interpretation der philosophischen und religiösen Elemente im Gedicht
- Das Thema der Unendlichkeit und ihre Auswirkungen auf den Menschen
- Vergleich der philosophischen Ansätze von Leopardi und Pascal
- Die Rolle von Sprache und Poesie in der Darstellung der Unendlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Das Kapitel gibt eine kurze Einführung in das Leben und Werk von Giacomo Leopardi. Es beleuchtet seine Biographie, seine philosophischen Prägungen und die Bedeutung seiner Werke, insbesondere der „Canti“, für die italienische Literaturgeschichte.
Interpretation des Gedichtes L'Infinito
Dieses Kapitel befasst sich mit der Analyse des Gedichts „L'Infinito“. Es untersucht die formale Struktur, die bildhaften Mittel und die zentralen Themen, die in dem Gedicht behandelt werden.
Leopardi im Vergleich mit Pascal
Dieses Kapitel stellt einen Vergleich zwischen den philosophischen Ansätzen von Leopardi und Blaise Pascal auf. Es beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Überlegungen zu den Themen Unendlichkeit, Leben und Tod.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind: Giacomo Leopardi, „L'Infinito“, Poesie des Indefinito, Unendlichkeit, Leben und Tod, Pessimismus, Nihilismus, Philosophie, Blaise Pascal, Vergleich, Literaturgeschichte, „Canti“.
- Citar trabajo
- Claudia Schnurbus (Autor), 2002, Leopardis L'Infinito, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8659