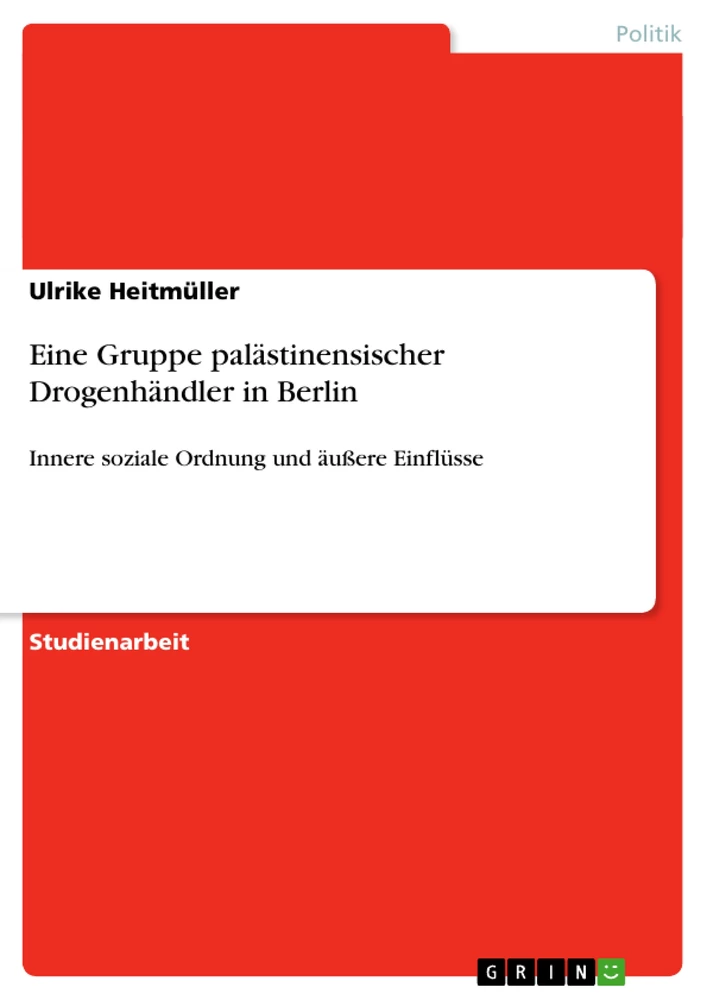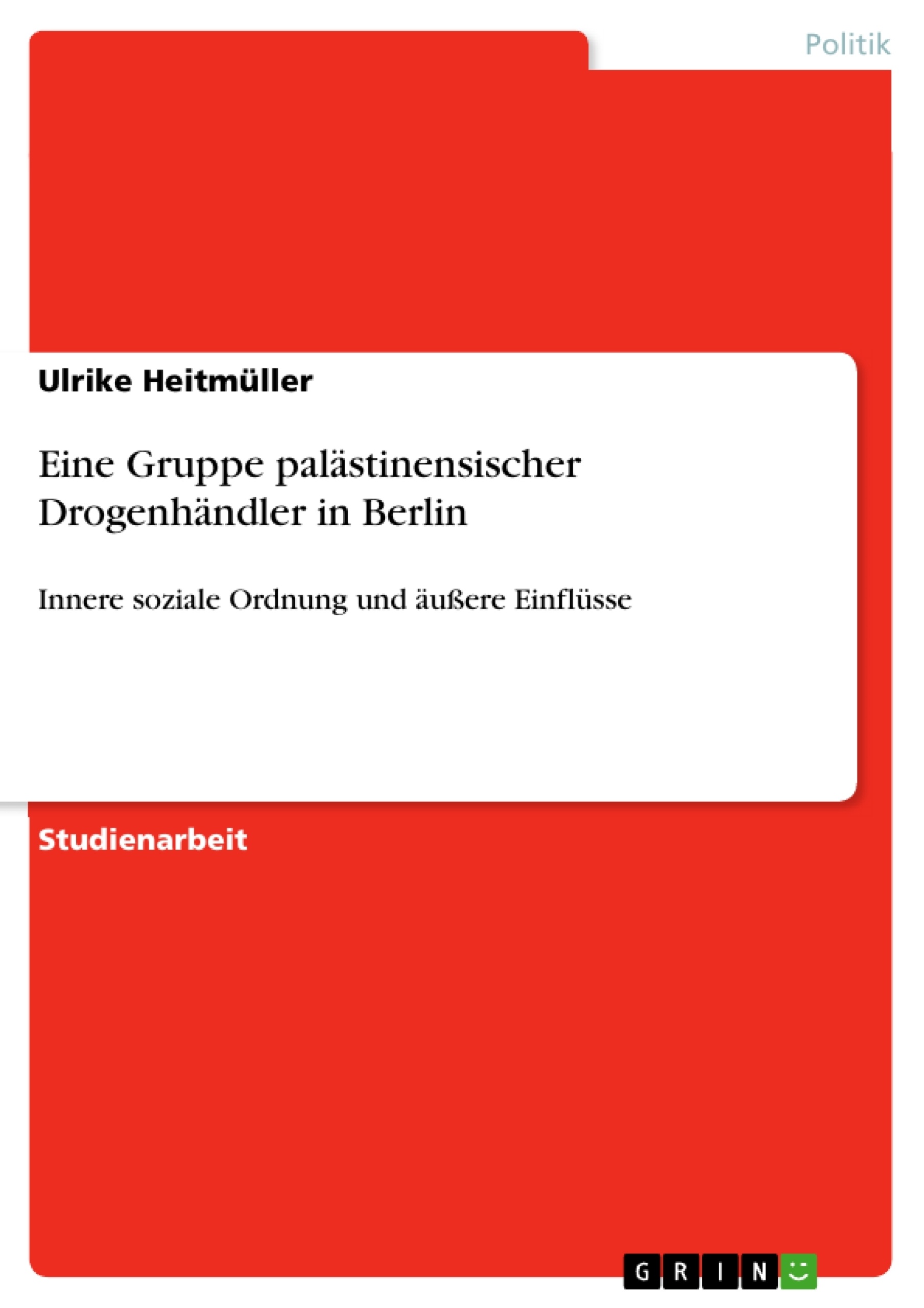Diese Hausarbeit handelt von einer Gruppe palästinensischer Drogenhändler, die in einem Berliner Park ihrer Tätigkeit nachgehen.
Ich wollte wissen, warum die Männer – Frauen sah ich nie - mit Drogen handeln und beschloss, eine Fallstudie über sie zu verfassen. Ich hatte die Hypothese, dass sie sich nicht in die Gesellschaft einfügen wollen: Drogenhandel als Protest.
Ich ging in den Park und stellte mich vor: eine Studentin und Journalistin, die eine Hausarbeit und Zeitungsartikel über ihre Zusammenarbeit schreiben möchte.
Wir sprachen viermal längere Zeit miteinander - zwischen sieben und 35 Minuten - und ich sah sie regelmäßig etwa ein- bis dreimal wöchentlich über einen Zeitraum von etwa drei Monaten.
Es hat sich gezeigt, dass die Männer, mit denen ich gesprochen habe, noch mit 30 Jahren ziemlich planlos in den Tag hinein leben. Sie organisieren ihre kleine „Arbeit“, aber sie organisieren nicht ihr Leben. Im Gegenteil: Sie schimpfen auf George W. Bush, Deutschland und „die Juden“, und sie behaupten, dass sie gar nicht anders könnten als mit Drogen zu handeln. Das verrät Scham - damit schien die Protest-Hypothese erledigt.
Ich fragte mich: Warum leben sie so? Ist wirklich der Rest der Welt „Schuld“ an ihrem „Schicksal“? Wäre das eine tragfähige Hypothese? Schaffen sie es nicht, ihr Leben zu gestalten?
Ich beschloss, Governance anhand der äußeren Einflüsse (Kapitel 2) und der inneren sozialen Ordnung (Kapitel 3) ihrer Gruppe zu untersuchen. Als analytische Instrumente sollten mir vor allem Theorien der Entscheidungsprozesse und des Neuen Institutionalismus dienen: Wie wirken Individuum, Gruppe und Umgebung auf einander? Welche Möglichkeiten haben die palästinensischen Drogenhändler, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen - und sie dann auch durchzusetzen? Welche Institutionen fördern, welche behindern sie, welche können sie ihrerseits gestalten?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Palästinensische Drogenhändler
- Äußere Einflüsse - Die Erzählungen der Drogenhändler
- Volkszugehörigkeit: Palästinenser - und „die Juden“
- Geschichte, Herkunft und die Registrierung bei der UNRWA
- Die Abgrenzung gegenüber „den Juden“
- Aufenthaltsstatus und rechtliche Restriktionen
- Palästinenser in Deutschland und Berlin
- Verschiedene Arten des Aufenthaltsstatus
- Palästinenser in Berlin ohne Aufenthaltserlaubnis
- Warum dealen die Männer trotzdem? Entscheidungstheorie
- Was wird hier gespielt?
- Weitere äußere Einflüsse
- Noch ein Spiel: Drogenhändler gegen Polizei
- Die Deutschen
- Die anderen Palästinenser in Berlin
- Das kriminelle Milieu
- Innere soziale Ordnung - Beobachtungen
- Arbeitsaufteilung: Rollen und Jobs
- Jobs im Drogenhandel
- Palästinensische verglichen mit afrikanischen Dealergruppen
- Mimetische Isomorphie - Legitimität oder Inkrementalismus?
- Hierarchie mit vielen Brüchen
- Rangordnung und gesellschaftliche Stellung
- Veränderungen innerhalb der Gruppe
- Zwei Standorte: Zwei Untergruppen - aber ohne scharfe Trennung
- Netzwerk und Kultur
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht eine Gruppe palästinensischer Drogenhändler in Berlin. Ziel ist es, die Lebenswelt dieser Männer anhand der äußeren Einflüsse (rechtliche Situation, gesellschaftliche Wahrnehmung) und der inneren sozialen Ordnung (Arbeitsteilung, Hierarchie) zu analysieren. Die Studie verwendet Theorien der Entscheidungsprozesse und des Neuen Institutionalismus, um die Interaktion zwischen Individuum, Gruppe und Umwelt zu beleuchten.
- Die Auswirkungen des Aufenthaltsstatus und rechtlicher Restriktionen auf die Lebensentscheidungen der Drogenhändler.
- Die Rolle der sozialen und kulturellen Zugehörigkeit (palästinensische Identität) im Kontext des Drogenhandels.
- Die innere Organisation und Hierarchie der Dealergruppe.
- Die Interaktion der Gruppe mit anderen Akteuren (Polizei, andere kriminelle Gruppen, die deutsche Gesellschaft).
- Die Entscheidungsfindungsprozesse innerhalb der Gruppe und deren Auswirkungen auf das Handeln der einzelnen Mitglieder.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Palästinensische Drogenhändler: Die Einleitung beschreibt die Ausgangshypothese, dass der Drogenhandel als Protest gegen die Gesellschaft verstanden werden könnte. Die Autorin beschreibt ihre Feldforschung im Park, ihre Methode der Datenerhebung durch Gespräche und Beobachtungen, sowie die ethischen Herausforderungen dieser Vorgehensweise. Die anfängliche Hypothese wird jedoch durch die Gespräche mit den Drogenhändlern relativiert, die ihre Situation eher als ein Ergebnis äußerer Umstände und mangelnder Zukunftsperspektiven beschreiben. Die Arbeit konzentriert sich darauf, die Governance-Strukturen zu untersuchen, die den Drogenhandel beeinflussen – sowohl die äußeren Einflüsse (Kapitel 2) als auch die innere soziale Ordnung (Kapitel 3) der Gruppe.
Äußere Einflüsse - Die Erzählungen der Drogenhändler: Dieses Kapitel untersucht die äußeren Einflüsse, die das Leben und die Entscheidungen der palästinensischen Drogenhändler prägen. Es analysiert die Bedeutung ihrer palästinensischen Identität, die Auswirkungen ihres Aufenthaltsstatus (einschließlich derjenigen ohne Aufenthaltserlaubnis) und die Herausforderungen, die sie im Umgang mit deutschen Behörden und der deutschen Gesellschaft erfahren. Die Kapitelteile untersuchen die wahrgenommenen Benachteiligungen und die Rolle dieser Wahrnehmung in ihrer Entscheidung, mit Drogen zu handeln. Es wird auch die Interaktion mit der Polizei, anderen palästinensischen Gruppen und dem kriminellen Milieu beleuchtet, um die komplexen externen Faktoren, die ihre Handlungen beeinflussen, aufzuzeigen.
Innere soziale Ordnung - Beobachtungen: Dieses Kapitel widmet sich der inneren Organisation und Struktur der Gruppe der palästinensischen Drogenhändler. Es untersucht die Arbeitsteilung und Rollen innerhalb der Gruppe, vergleicht sie mit anderen Dealergruppen (z.B. afrikanischen Gruppen) und analysiert die Hierarchie und deren Bruchstellen. Die Autorin betrachtet die Dynamik innerhalb der Gruppe und die komplexen Beziehungen zwischen den Mitgliedern, um zu verstehen, wie die Gruppe funktioniert und wie interne Strukturen ihre Aktivitäten beeinflussen. Die Kapitelteile beleuchten die kulturellen und sozialen Aspekte der Gruppenorganisation, die neben der pragmatischen Arbeitsteilung auch die interne Dynamik und die Zugehörigkeit prägen.
Schlüsselwörter
Palästinensische Drogenhändler, Berlin, Drogenhandel, Governance, Aufenthaltsstatus, soziale Ordnung, Entscheidungstheorie, Neuer Institutionalismus, Identität, kriminelles Milieu, Integration, Feldforschung.
Häufig gestellte Fragen: Palästinensische Drogenhändler in Berlin
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Diese Arbeit untersucht eine Gruppe palästinensischer Drogenhändler in Berlin. Sie analysiert ihre Lebenswelt, indem sie äußere Einflüsse (rechtliche Situation, gesellschaftliche Wahrnehmung) und die innere soziale Ordnung (Arbeitsteilung, Hierarchie) dieser Gruppe betrachtet.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie basiert auf Feldforschung, die im Park durchgeführt wurde. Die Datenerhebung erfolgte durch Gespräche und Beobachtungen der Drogenhändler. Die Autorin beschreibt auch die ethischen Herausforderungen dieser Vorgehensweise.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Studie verwendet Theorien der Entscheidungsprozesse und des Neuen Institutionalismus, um die Interaktion zwischen Individuum, Gruppe und Umwelt zu beleuchten.
Welche äußeren Einflüsse werden untersucht?
Das Kapitel "Äußere Einflüsse" analysiert die Bedeutung der palästinensischen Identität der Händler, die Auswirkungen ihres Aufenthaltsstatus (inkl. derer ohne Aufenthaltserlaubnis), die Herausforderungen im Umgang mit deutschen Behörden und der deutschen Gesellschaft, wahrgenommene Benachteiligungen und deren Einfluss auf die Entscheidung, Drogen zu handeln. Die Interaktion mit Polizei, anderen palästinensischen Gruppen und dem kriminellen Milieu wird ebenfalls beleuchtet.
Wie wird die innere soziale Ordnung der Gruppe beschrieben?
Das Kapitel "Innere soziale Ordnung" untersucht die Arbeitsteilung und Rollen innerhalb der Gruppe, vergleicht sie mit anderen Dealergruppen (z.B. afrikanischen Gruppen), analysiert die Hierarchie und deren Bruchstellen, die Dynamik innerhalb der Gruppe und die komplexen Beziehungen zwischen den Mitgliedern. Kulturelle und soziale Aspekte der Gruppenorganisation werden ebenfalls betrachtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den äußeren Einflüssen, ein Kapitel zur inneren sozialen Ordnung und einen Schluss. Die Einleitung beschreibt die Ausgangshypothese und die Methodik. Die Kapitel fassen die Ergebnisse der Analyse der äußeren und inneren Faktoren zusammen, welche die Lebenswelt und die Entscheidungen der Drogenhändler beeinflussen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Studie?
Schlüsselwörter sind: Palästinensische Drogenhändler, Berlin, Drogenhandel, Governance, Aufenthaltsstatus, soziale Ordnung, Entscheidungstheorie, Neuer Institutionalismus, Identität, kriminelles Milieu, Integration, Feldforschung.
Welche Hauptziele verfolgt die Studie?
Die Studie zielt darauf ab, die Auswirkungen des Aufenthaltsstatus und rechtlicher Restriktionen auf die Lebensentscheidungen der Drogenhändler zu untersuchen, die Rolle der sozialen und kulturellen Zugehörigkeit (palästinensische Identität) im Kontext des Drogenhandels zu beleuchten, die innere Organisation und Hierarchie der Dealergruppe zu analysieren, die Interaktion der Gruppe mit anderen Akteuren (Polizei, andere kriminelle Gruppen, die deutsche Gesellschaft) zu untersuchen und die Entscheidungsfindungsprozesse innerhalb der Gruppe und deren Auswirkungen auf das Handeln der einzelnen Mitglieder zu analysieren.
Wie wird die Ausgangshypothese bewertet?
Die anfängliche Hypothese, dass der Drogenhandel als Protest gegen die Gesellschaft verstanden werden könnte, wird durch die Gespräche mit den Drogenhändlern relativiert. Sie beschreiben ihre Situation eher als ein Ergebnis äußerer Umstände und mangelnder Zukunftsperspektiven.
- Citar trabajo
- Ulrike Heitmüller (Autor), 2007, Eine Gruppe palästinensischer Drogenhändler in Berlin, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86813