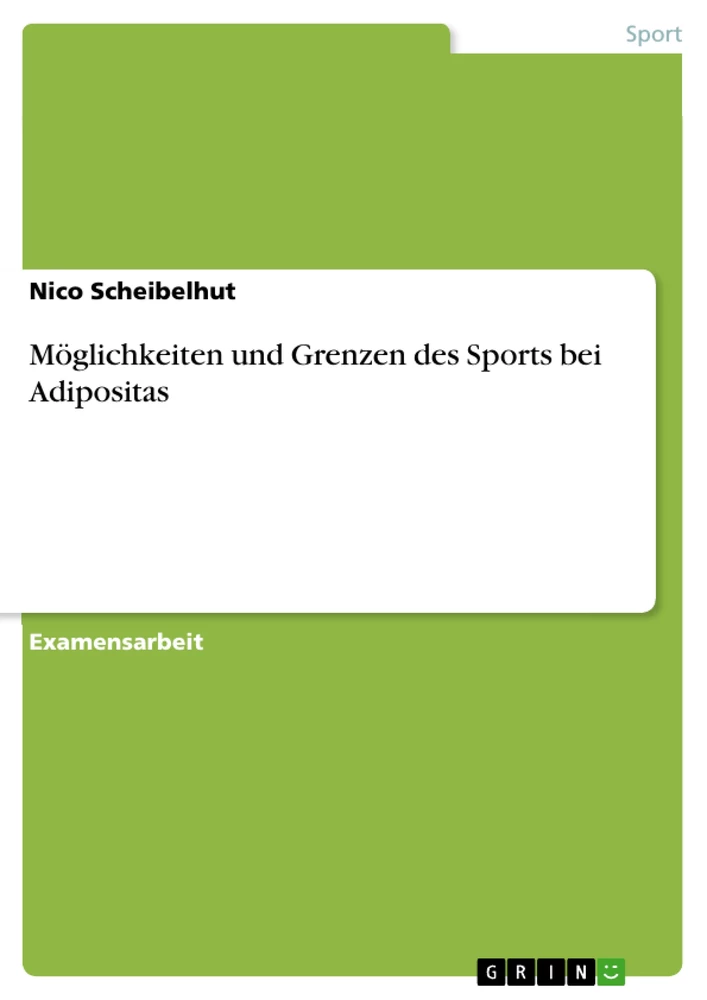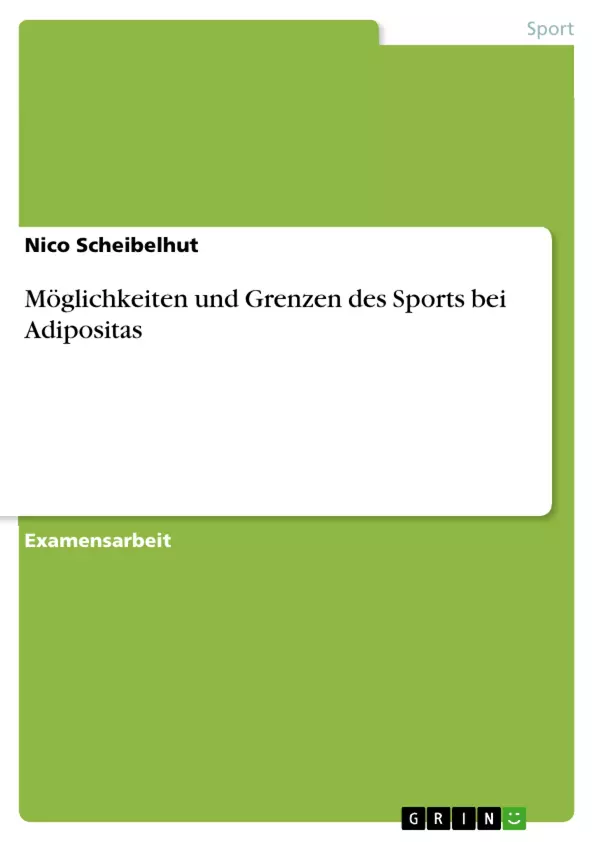"Dem Menschen, der Nahrung zu sich nimmt, kann es nicht gut gehen,
wenn er nicht gleichzeitig seinen Körper durch sportliche Ertüchtigung beansprucht.“
(Hippokrates von Kós, 460-370 v. Chr.)
„Essen ist ständig um uns herum: auf der Straße, im Fernsehen, bei unseren Freizeitaktivitäten – überall ist es ein Thema. Eigentlich kein Problem, solange sich Essen und Bewegung die Waage halten. Da wir uns aber immer weniger bewegen und mehr essen, entsteht ein Ungleichgewicht.“
(Bundesverbraucherministerin Renate Künast, Mai 2004)
Als die Bundesregierung am 09.05.2007 Fit statt fett, den viel beachteten 5-Punkte-Plan gegen Fettleibigkeit, vorlegte, ging es um eine Thematik, die seit Hippokrates - seit 2500 Jahren also - die Fachwelt beschäftigt.
Bei genauerem Hinsehen wird allerdings deutlich, dass die Regierungskoalition auf eine gesundheitliche Entwicklung reagieren musste, die es vor 20 Jahren noch nicht gab: Rund 2 Drittel der Männer und 53% der Frauen in Deutschland gelten als zu dick. Es sind aber auch schon 15 % der 3 bis 17 Jahre alten Kinder übergewichtig, 6,3 % sogar fettleibig. Im Vergleich mit den Jahren 1985 bis 1999 hat der Anteil der übergewichtigen Kinder und Jugendlichen laut einer Studie des Robert Koch Instituts aus dem Jahre 2006 um die Hälfte zugenommen. Bei Fettleibigkeit registrierte man sogar eine Verdoppelung. (Vgl. JOURNAL MED, 2007)
Da mit dieser rasanten Entwicklung jährlich viele Milliarden Euro an Kosten verbunden sind, muss nun ein Nationaler Aktionsplan her, mit dem die Bundesregierung bis zum Jahr 2020 das Übergewicht der Deutschen bekämpfen will. Denn man ist vor allem zu der Erkenntnis gelangt, dass „in unserer Gesellschaft zu wenig Bewegung im Alltag stattfindet“ (SZ, 2007b). (Vgl. SZ, 2007b)
Verbraucherminister Seehofer und Gesundheitsministerin Schmidt schlagen vor, neben einem Schulfach Ernährung eine Mindestanzahl von 3 Sportstunden an Schulen festzulegen. Für Ganztagsschulen ist mittelfristiges Ziel sogar die tägliche Sportstunde. Außerdem sollen finanziell schlechter gestellte Familien bei der Deckung von Vereinskosten staatliche Unterstützung erhalten.
Bedauerlicherweise handelt es sich bei diesem Programm nicht um gesetzlich verankerte Maßnahmen, sondern lediglich um Vorschläge. (Vgl. TAGESSCHAU, 2007b)
Auf dem Hintergrund dieser aktuellen politischen Vorgänge dürfte es also lohnenswert sein, sich eingehend mit der Frage zu befassen:
Welche Möglichkeiten und welche Grenzen hat Sport bei Adipositas?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Ausprägungsformen überdurchschnittlich hohen Gewichts
- 2.1 Methoden zur Bestimmung des Körperfettanteils
- 2.1.1 Direkte Messmethoden
- 2.1.2 Indirekte Messmethoden
- 2.1.2.1 Body-Mass-Index
- 3 Epidemiologie und Prävalenz von Übergewicht und Adipositas
- 4 Ätiologie der Adipositas
- 4.1 Ernährung und Adipositas (Alimentäre Adipositas)
- 4.1.1 Der Energieverbrauch
- 4.1.1.1 Grundumsatz
- 4.1.1.2 Nahrungsbedingte Thermogenese
- 4.1.1.3 Aktivitätsbedingte Thermogenese
- 4.1.2 Regulation von Appetit und Sättigung
- 4.1.3 Verzehrhäufigkeit und -menge einzelner Lebensmittel
- 4.1.4 Portionsgrößen
- 4.1.5 Wandel der Mahlzeitentradition und die Folgen
- 4.2 Psychosoziale Ursachen
- 4.2.1 Familie
- 4.2.2 Freizeitgestaltung und Medienkonsum
- 4.3 Körperliche Aktivität
- 4.3.1 Bewegungsmangel
- 5 Persistenz von Adipositas
- 6 Folgen der Adipositas
- 6.1 Physische Folgekrankheiten
- 6.1.1 Metabolisches Syndrom
- 6.1.2 Diabetes Mellitus Typ 2
- 6.1.3 Kardiovaskuläre Folgen
- 6.1.4 Gastrointestinale Erkrankungen
- 6.1.5 Respiratorische Veränderungen
- 6.1.6 Orthopädische Folgen
- 6.1.7 Fettstoffwechselstörungen
- 6.2 Psychosoziale Folgen und Lebensqualität
- 6.3 Kosten
- 7 Therapie der Adipositas
- 7.1 Therapieziele
- 7.2 Konventionelle Therapiemöglichkeiten
- 7.2.1 Verhaltenstherapie
- 7.2.2 Ernährungstherapie
- 7.2.2.1 Die optimierte Mischkost
- 7.2.2.2 Diätetische Maßnahmen
- 8 Körperliche Aktivität in der Adipositastherapie
- 8.1 Bewegungstherapie – Sporttherapie
- 8.2 Begriffsbestimmungen: Sport und Körperliche Aktivität
- 8.3 Voraussetzungen für bewegungstherapeutische Maßnahmen
- 8.4 Ziele und Möglichkeiten gesteigerter körperlicher Aktivität bei Adipositas
- 8.4.1 Physiologische Ziele
- 8.4.2 Psychosoziale Ziele
- 8.4.3 Lebensstil
- 8.5 Motivation zum Beginn einer Bewegungstherapie
- 8.6 Aufgaben des Bewegungstherapeuten
- 9 Körperliches Training bei Adipositas
- 9.1 Komponenten der Trainingsplanung
- 9.2 Ausgewählte Förderbereiche und Inhalte der Bewegungstherapie
- 9.2.1 Ausdauer
- 9.2.2 Kraft
- 9.2.3 Verbesserung der Koordination und Beweglichkeit
- 9.2.4 Mannschafts- und Rückschlagspiele, Kampfsportarten
- 9.2.5 Körperwahrnehmung
- 10 Körperliche Aktivitäten und ihre Eignung für die Therapie
- 10.1 Aktivitäten im Alltag
- 10.2 Sportliche Aktivitäten
- 10.2.1 Aktivitäten im Wasser
- 10.2.2 Walking
- 10.2.3 Radfahren
- 11 Risiken des Sports und körperlicher Aktivität bei Adipositas
- 11.1 Bewegungsapparat
- 11.2 Thermoregulation
- 11.3 Belastungsasthma
- 11.4 Kardiovaskuläre Risiken
- 12 Physische Adaptationen durch körperliche Aktivität bei Adipositas
- 12.1 Änderung der Körperzusammensetzung und Gewichtserhalt
- 12.2 Verbesserung des Stoffwechsels
- 12.3 Verbesserungen des Herz-Kreislaufsystems
- 12.4 Verbesserung der Leistungsfähigkeit
- 12.5 Einflüsse auf psychosoziale Faktoren
- 13 Schulsport und Sportlehrer als Interventionsmöglichkeit?
- 14 Das Projekt Fit für Pisa: Eine statistische Auswertung
- 14.1 Projektbeschreibung: Fit für Pisa
- 14.2 Teilnehmende Grundschulen und Sportangebot
- 14.3 Testungen
- 14.3.1 Sporttests
- 14.4 Ergebnisse
- 14.5 Veränderungen des BMI
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen von Sport bei der Behandlung von Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. Sie analysiert die aktuelle Situation der Adipositas in Deutschland und beleuchtet die verschiedenen Ursachen, sowohl im Bereich Ernährung als auch im psychosozialen Umfeld und bezüglich körperlicher Aktivität.
- Definition und Bestimmung von Übergewicht und Adipositas
- Epidemiologische Daten und Prävalenz von Adipositas bei Kindern und Jugendlichen
- Ursachenforschung: Ernährung, psychosoziale Faktoren und Bewegungsmangel
- Konventionelle Therapiemöglichkeiten: Verhaltenstherapie, Ernährungstherapie und Bewegungstherapie
- Auswirkungen von Sport und körperlicher Aktivität auf die Gesundheit und das Wohlbefinden
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit beginnt mit der Darstellung der wachsenden Adipositasproblematik in Deutschland und leitet die zentrale Forschungsfrage nach den Möglichkeiten und Grenzen des Sports bei Adipositas ein. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und ihre Fokussierung auf Kinder und Jugendliche.
2 Ausprägungsformen überdurchschnittlich hohen Gewichts: Dieses Kapitel differenziert zwischen Übergewicht und Adipositas, wobei letzteres auf einen Überschuss an Fettgewebe zurückzuführen ist. Es werden Methoden zur Bestimmung des Körperfettanteils (direkte und indirekte Verfahren, detailliert der Body-Mass-Index) erläutert und die verschiedenen Fettverteilungsformen (abdominell und peripher) beschrieben.
3 Epidemiologie und Prävalenz von Übergewicht und Adipositas: Dieses Kapitel präsentiert die globale und nationale Verbreitung von Übergewicht und Adipositas, mit besonderem Fokus auf den Anstieg der Prävalenz bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Es werden sozioökonomische Faktoren im Zusammenhang mit Adipositas diskutiert.
4 Ätiologie der Adipositas: Das Kapitel beleuchtet die multifaktoriellen Ursachen von Adipositas. Es konzentriert sich auf beeinflussbare Faktoren wie Ernährung (Energiebilanz, Appetitregulation, Ernährungsgewohnheiten, Portionsgrößen und Veränderungen der Mahlzeiten-Tradition), psychosoziale Aspekte (Einfluss der Familie, Freizeitgestaltung und Medienkonsum) und Bewegungsmangel.
5 Persistenz von Adipositas: Dieses Kapitel befasst sich mit der anhaltenden Wahrscheinlichkeit, dass Adipositas im Kindes- und Jugendalter auch im Erwachsenenalter bestehen bleibt. Es werden Studien zur Persistenzraten vorgestellt.
6 Folgen der Adipositas: Hier werden die vielfältigen Folgen von Adipositas aufgelistet, sowohl die physischen (metabolisches Syndrom, Diabetes Mellitus Typ 2, kardiovaskuläre Erkrankungen, gastrointestinale, respiratorische und orthopädische Probleme, Fettstoffwechselstörungen) als auch die psychosozialen Folgen und die hohen Kosten für das Gesundheitssystem.
7 Therapie der Adipositas: Dieses Kapitel beschreibt die Notwendigkeit und Ziele einer interdisziplinären Adipositastherapie bei Kindern und Jugendlichen. Es werden konventionelle Therapiemöglichkeiten wie Verhaltenstherapie und Ernährungstherapie (optimierte Mischkost) erläutert, wobei die Rolle der körperlichen Aktivität hervorgehoben wird.
8 Körperliche Aktivität in der Adipositastherapie: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Bedeutung von Bewegung in der Adipositastherapie. Es erläutert die Begriffe Bewegungstherapie und Sporttherapie, die Voraussetzungen für bewegungstherapeutische Maßnahmen und deren Ziele (physiologisch, psychosozial und Lebensstiländerung). Die Motivation der Patienten und die Rolle des Bewegungstherapeuten werden detailliert beschrieben.
9 Körperliches Training bei Adipositas: Das Kapitel beschreibt die Planung von Trainingsprogrammen für Adipöse. Es behandelt die Komponenten der Trainingsplanung (Intensität, Dauer, Dichte, Umfang, Frequenz, Art und Methode) und die wichtigsten Förderbereiche: Ausdauertraining, Krafttraining und die Verbesserung von Koordination und Beweglichkeit. Mannschaftsspiele und Kampfsportarten werden ebenfalls als Therapieoptionen diskutiert. Die Bedeutung der Körperwahrnehmung wird hervorgehoben.
10 Körperliche Aktivitäten und ihre Eignung für die Therapie: Hier werden Alltagsaktivitäten und sportliche Aktivitäten als Möglichkeiten zur Steigerung der körperlichen Aktivität vorgestellt und deren jeweilige Eignung in der Adipositastherapie bewertet. Schwimmen, Walking und Radfahren werden als besonders geeignet hervorgehoben.
11 Risiken des Sports und körperlicher Aktivität bei Adipositas: Dieses Kapitel thematisiert die Risiken von Sport und körperlicher Aktivität bei adipösen Kindern und Jugendlichen, insbesondere Belastungen des Bewegungsapparats, Probleme der Thermoregulation, Belastungsasthma und kardiovaskuläre Risiken.
12 Physische Adaptationen durch körperliche Aktivität bei Adipositas: Hier werden die positiven Auswirkungen von regelmäßiger körperlicher Aktivität auf die Körperzusammensetzung (Gewichtserhaltung, Muskelaufbau), den Stoffwechsel (Insulinsensitivität, Glukosetoleranz, Lipidprofil), das Herz-Kreislauf-System und die psychosoziale Entwicklung beleuchtet.
13 Schulsport und Sportlehrer als Interventionsmöglichkeit?: Dieses Kapitel diskutiert das Potenzial des Schulsports zur Prävention und Intervention bei Adipositas. Es betont die Bedeutung einer ausreichenden Stundenzahl, qualifizierter Sportlehrer und einer auf Gesundheit und Freude an Bewegung ausgerichteten Gestaltung des Unterrichts. Ein Berliner Projekt zur Schulsportqualität wird kurz vorgestellt.
14 Das Projekt Fit für Pisa: Eine statistische Auswertung: Das Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer statistischen Auswertung des Projekts "Fit für Pisa", welches den Einfluss einer täglichen Sportstunde auf die Gesundheit und Fitness von Grundschulkindern untersucht. Die Ergebnisse werden kritisch diskutiert und mögliche Ursachen für unerwartete Ergebnisse werden analysiert.
Schlüsselwörter
Adipositas, Übergewicht, Kinder, Jugendliche, Epidemiologie, Prävalenz, Ätiologie, Ernährung, Bewegungsmangel, psychosoziale Faktoren, Therapie, Verhaltenstherapie, Ernährungstherapie, Bewegungstherapie, Sport, Ausdauer, Kraft, Koordination, Beweglichkeit, Metabolisches Syndrom, Diabetes Mellitus Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lebensqualität, Prävention, Schulsport, Projekt Fit für Pisa.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Auswirkungen von Sport auf Adipositas bei Kindern und Jugendlichen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung, eine Zusammenfassung der Kapitel, sowie Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf den Möglichkeiten und Grenzen von Sport in der Adipositastherapie.
Welche Aspekte von Adipositas werden behandelt?
Das Dokument behandelt verschiedene Aspekte von Adipositas, darunter Definition und Bestimmung von Übergewicht und Adipositas, epidemiologische Daten und Prävalenz, Ätiologie (Ernährung, psychosoziale Faktoren, Bewegungsmangel), Persistenz, Folgen (physische und psychosoziale Folgen, Kosten), Therapie (Verhaltenstherapie, Ernährungstherapie, Bewegungstherapie), körperliches Training bei Adipositas, Risiken des Sports bei Adipositas, physische Anpassungen durch körperliche Aktivität, und die Rolle von Schulsport und Sportlehrern.
Wie wird Übergewicht und Adipositas definiert und bestimmt?
Das Dokument unterscheidet zwischen Übergewicht und Adipositas. Adipositas wird als ein Überschuss an Fettgewebe definiert. Es werden verschiedene Methoden zur Bestimmung des Körperfettanteils erläutert, darunter direkte und indirekte Messmethoden wie der Body-Mass-Index (BMI).
Welche epidemiologischen Daten werden präsentiert?
Das Dokument präsentiert Daten zur globalen und nationalen Verbreitung von Übergewicht und Adipositas, mit besonderem Fokus auf den Anstieg der Prävalenz bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Sozioökonomische Faktoren im Zusammenhang mit Adipositas werden ebenfalls diskutiert.
Welche Ursachen von Adipositas werden untersucht?
Die multifaktoriellen Ursachen von Adipositas werden beleuchtet, inklusive beeinflussbarer Faktoren wie Ernährung (Energiebilanz, Appetitregulation, Ernährungsgewohnheiten, Portionsgrößen, Veränderungen der Mahlzeiten-Tradition), psychosoziale Aspekte (Einfluss der Familie, Freizeitgestaltung und Medienkonsum) und Bewegungsmangel.
Welche Therapiemöglichkeiten werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt konventionelle Therapiemöglichkeiten wie Verhaltenstherapie und Ernährungstherapie (optimierte Mischkost). Die Bedeutung der körperlichen Aktivität und Bewegungstherapie wird hervorgehoben. Es werden verschiedene Aspekte des körperlichen Trainings (Ausdauer, Kraft, Koordination, Beweglichkeit) und geeignete Sportarten diskutiert.
Welche Risiken des Sports bei Adipositas werden genannt?
Das Dokument thematisiert die Risiken von Sport und körperlicher Aktivität bei adipösen Kindern und Jugendlichen, einschließlich Belastungen des Bewegungsapparats, Probleme der Thermoregulation, Belastungsasthma und kardiovaskuläre Risiken.
Welche positiven Auswirkungen von Sport werden beschrieben?
Die positiven Auswirkungen von regelmäßiger körperlicher Aktivität auf die Körperzusammensetzung (Gewichtserhaltung, Muskelaufbau), den Stoffwechsel (Insulinsensitivität, Glukosetoleranz, Lipidprofil), das Herz-Kreislauf-System und die psychosoziale Entwicklung werden erläutert.
Welche Rolle spielt der Schulsport?
Das Dokument diskutiert das Potenzial des Schulsports zur Prävention und Intervention bei Adipositas und betont die Bedeutung einer ausreichenden Stundenzahl, qualifizierter Sportlehrer und einer gesundheitsorientierten Gestaltung des Unterrichts.
Welche Studie wird vorgestellt?
Die Ergebnisse des Projekts "Fit für Pisa", welches den Einfluss einer täglichen Sportstunde auf die Gesundheit und Fitness von Grundschulkindern untersucht, werden präsentiert und kritisch diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter umfassen: Adipositas, Übergewicht, Kinder, Jugendliche, Epidemiologie, Prävalenz, Ätiologie, Ernährung, Bewegungsmangel, psychosoziale Faktoren, Therapie, Verhaltenstherapie, Ernährungstherapie, Bewegungstherapie, Sport, Ausdauer, Kraft, Koordination, Beweglichkeit, Metabolisches Syndrom, Diabetes Mellitus Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lebensqualität, Prävention, Schulsport, Projekt Fit für Pisa.
- Citation du texte
- Nico Scheibelhut (Auteur), 2007, Möglichkeiten und Grenzen des Sports bei Adipositas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86970