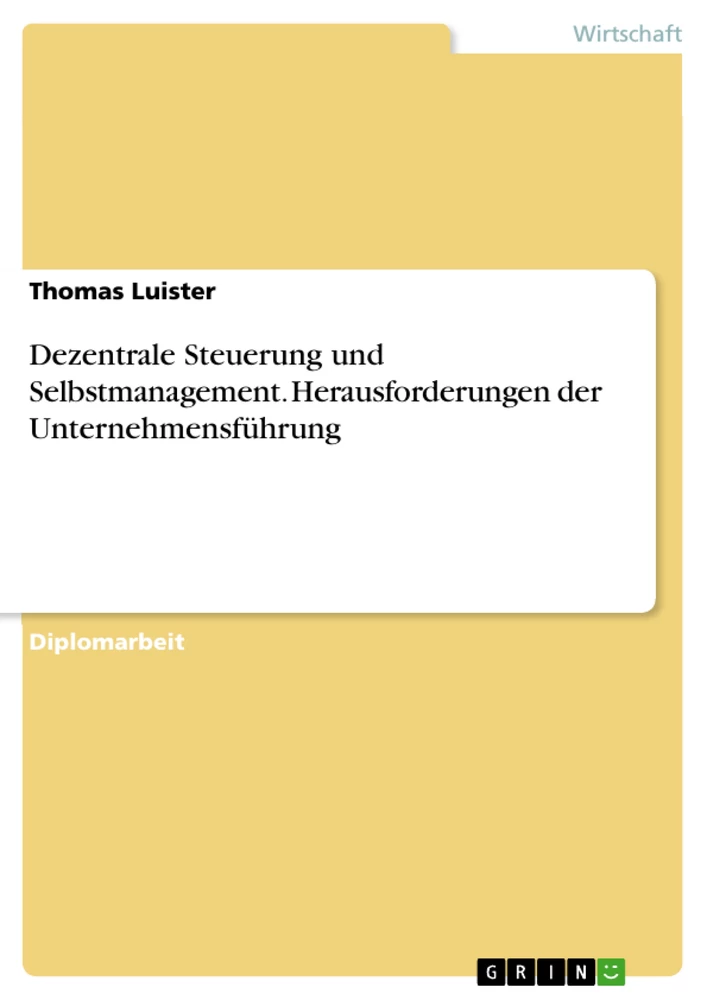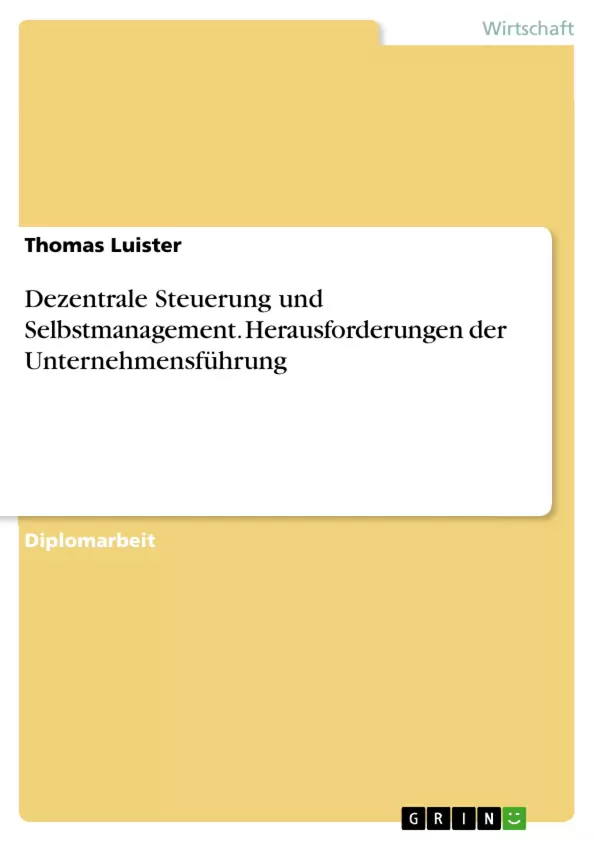In den letzten Jahrzehnten kam es in der Wirtschaft sowie auch der Gesellschaft durch die fortschreitende Dynamisierung, Flexibilisierung und Globalisierung zu einschneidenden Veränderungen. Die Komplexität von Arbeitstechniken/-systemen erhöhte sich und die Entwicklung von neuen Informations- und Kommunikationstechniken ermöglichte andere Formen der Steuerung und Kontrolle. All diese und weitere Veränderungen beeinflussten das Verständnis von Arbeit und tun dies immer noch. Arbeit als Phänomen bleibt dabei zwar das Gleiche, jedoch verändern sich die Anforderungen an den Einzelnen sowie die Bedingungen unter denen gearbeitet wird. Als Folge veränderte sich das, was unter dem Begriff Arbeit verstanden wird.
Innerhalb des Themenkomplexes der ‘Entwicklungsperspektiven von Arbeit’ wird sich im ersten, theoretischen Teil dieser Arbeit mit dieser Veränderung des Verständnisses von Arbeit auseinandergesetzt und vor allem betrachtet, was diese Veränderungen für den Einzelnen für Folgen haben. Dabei wird der Taylorismus beziehungsweise Fordismus vorgestellt und erläutert, inwiefern es dabei zu Diskrepanzen zwischen den Bedingungen dieser Theorien und den Anforderungen der Gegenwart gekommen ist. Des Weiteren wird erörtert, inwiefern die Lösung der Diskrepanzen in der (Re-)Subjektivierung der Arbeit (vor allem auch von qualifizierter Arbeit) gesucht wurde, aber ebenfalls, und das wird ein Schwerpunkt des ersten Teils sein, wie diese Subjektivierung nur scheinbar diese ist, da sie in großem Maße wiederum objektiviert wurde. Dieser Prozess der Objektivierung subjektivierter Arbeit, findet unter dem Deckmantel der Humanisierung (Subjektivierung) großen Anklang, da er in Konformität zu unserer wissenschaftlichen, rational denkenden Gesellschaft steht. Ebenso aber führt er zu neuen großen Konfliktfeldern, welche darzulegen versucht werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Subjektivierung der Arbeit
- Die Krise des Fordismus
- Krise des Kommandosystems
- Indirekte Steuerung
- Selbstorganisation
- Subjektivierung
- Die Ambivalenz der neuen Freiheit
- Der richtige Umgang mit der Paradoxie
- Objektivierung subjektivierter Arbeit
- Objektivierendes Handeln
- Selbststeuerung nach objektiver Maßgabe
- Entwicklung von Informations- und Steuerungssystemen
- Steuerung über Kennzahlen
- Neue Formen der Kontrolle und Macht
- Handlungsspielräume als Äquivalent zu Befehl und Gehorsam
- Ersetzen der Kontrolle durch Kontrollierbarkeit
- Verwissenschaftlichung handlungsleitender subjektiver Orientierungen
- Grenzen der Objektivierbarkeit
- Wo bzw. wie existiert Autonomie?
- Vom Einfachen zum Komplexen
- Funktionaler vs. Struktureller Freiraum
- Handlungs- und Entscheidungsfreiraum
- Der Einfluss der Führung
- Das grundsätzliche Kontrollproblem
- Steuerungsmechanismen der Autonomie – Formen der Objektivierung
- Bring- und Holschuld der Autonomie
- Standardisierung von Prozessen
- Festlegung von Rahmenbedingungen
- Zielvereinbarungen
- Aufbau und Bedeutung Zielvereinbarung
- Individualität
- Entgeltwirksamkeit
- Umgang mit Risiko – wenn Ziele nicht erreicht werden
- Bedeutung von qualitativen Zielen
- Dokumentationspflichten
- Transparenz durch Dokumentation
- Weniger ist mehr?
- Entwicklung von Dokumentationssystemen
- Projektmanagement
- Dokumentation im Projektmanagement
- Freiräume in der Projektarbeit
- Kennzahlen
- Abhängigkeit des Steuerungspotentials
- Wie viel Rechnen ist notwendig?
- Die andere Seite der Kennzahlen
- Schatten der Objektivierung
- Akzeptanz Nicht-Objektivierbarer Anteile des Handelns
- Forderung nach dem Mensch als Subjekt
- Erfahrungswissen und Kooperation
- Abbild oder Transformation des Objektiven
- Messbarkeit von Zielen
- Quantifizierung über Abgleich des Selbst- und Fremdbildes
- Erzeugung von Schein-Objektivität
- Mehraugen-Objektivität
- Mehr Druck durch mehr Freiheit
- Ausprägungen von Druck
- Mehr Freiheit durch mehr Druck?
- Freiheit und Innovation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit den Herausforderungen an das Management, die durch die zunehmende Dezentralisierung von Steuerung und die Förderung von Selbstmanagement in Unternehmen entstehen. Die Arbeit untersucht den Wandel vom traditionellen tayloristischen/fordistischen Arbeitssystem hin zu einem Ansatz, der die Subjektivierung von Arbeit in den Vordergrund stellt.
- Die Herausforderungen, die die Subjektivierung von Arbeit für Unternehmen mit sich bringt
- Die Ambivalenz der neuen Freiheit und die damit verbundenen Paradoxien
- Die Objektivierung subjektivierter Arbeit und die Mechanismen der Steuerung
- Die Grenzen der Objektivierbarkeit und die Frage nach der Existenz von Autonomie
- Der Einfluss von neuen Formen der Kontrolle und Macht auf die Arbeitswelt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der veränderten Arbeitswelt und die Herausforderungen für das Management in den Kontext. Sie erläutert, warum es zu einem Wandel vom Taylorismus/Fordismus zu einem Ansatz gekommen ist, der die Subjektivierung von Arbeit betont.
Das erste Kapitel befasst sich mit der Subjektivierung der Arbeit und analysiert die Krise des Fordismus und des Kommandosystems. Es werden verschiedene Konzepte wie indirekte Steuerung, Selbstorganisation und Subjektivierung erläutert und die Ambivalenz der neuen Freiheit dargestellt.
Das zweite Kapitel analysiert die Objektivierung subjektivierter Arbeit. Es beleuchtet verschiedene Mechanismen der Steuerung wie Informations- und Steuerungssysteme, Kennzahlen, neue Formen der Kontrolle und Macht sowie Handlungsspielräume als Äquivalent zu Befehl und Gehorsam.
Das dritte Kapitel untersucht die Grenzen der Objektivierbarkeit und beleuchtet die Frage nach der Existenz von Autonomie in der Arbeitswelt. Es analysiert verschiedene Facetten wie funktionaler vs. struktureller Freiraum, Handlungs- und Entscheidungsfreiraum sowie den Einfluss der Führung.
Das vierte Kapitel behandelt verschiedene Steuerungsmechanismen der Autonomie, die eine Objektivierung des Handelns gewährleisten sollen. Es stellt verschiedene Mechanismen wie Standardisierung von Prozessen, Festlegung von Rahmenbedingungen, Zielvereinbarungen, Dokumentationspflichten, Projektmanagement und Kennzahlen-Steuerung vor.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die Subjektivierung und Objektivierung von Arbeit, der Wandel des Managements im Kontext von Dezentralisierung und Selbstmanagement, sowie die Auswirkungen neuer Formen der Kontrolle und Macht auf die Arbeitswelt. Die Arbeit befasst sich mit Konzepten wie Taylorismus, Fordismus, indirekte Steuerung, Selbstorganisation, Autonomie, Zielvereinbarungen, Dokumentationspflichten, Projektmanagement und Kennzahlen-Steuerung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Subjektivierung von Arbeit"?
Subjektivierung meint, dass Arbeitnehmer vermehrt eigene Fähigkeiten, Erfahrungen und Selbstmanagement einbringen sollen, anstatt nur starre Befehle auszuführen.
Warum geriet der Taylorismus/Fordismus in die Krise?
Starre Hierarchien und zerstückelte Arbeitsprozesse konnten den Anforderungen einer dynamischen, globalisierten Wirtschaft an Flexibilität und Innovation nicht mehr gerecht werden.
Welche Rolle spielen Zielvereinbarungen beim Selbstmanagement?
Zielvereinbarungen dienen als Steuerungsmechanismus, der Autonomie gewährt, aber gleichzeitig durch messbare Ergebnisse eine indirekte Kontrolle ermöglicht.
Gibt es eine "Ambivalenz der Freiheit" am Arbeitsplatz?
Ja, die neue Freiheit führt oft zu erhöhtem Selbst-Druck, da die Verantwortung für das Erreichen der Ziele nun vollständig beim Einzelnen liegt.
Wie wird subjektive Arbeit wieder "objektiviert"?
Dies geschieht durch Kennzahlen, Dokumentationspflichten und standardisierte Prozesse, die das menschliche Handeln wieder messbar und kontrollierbar machen.
- Quote paper
- Thomas Luister (Author), 2007, Dezentrale Steuerung und Selbstmanagement. Herausforderungen der Unternehmensführung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87252