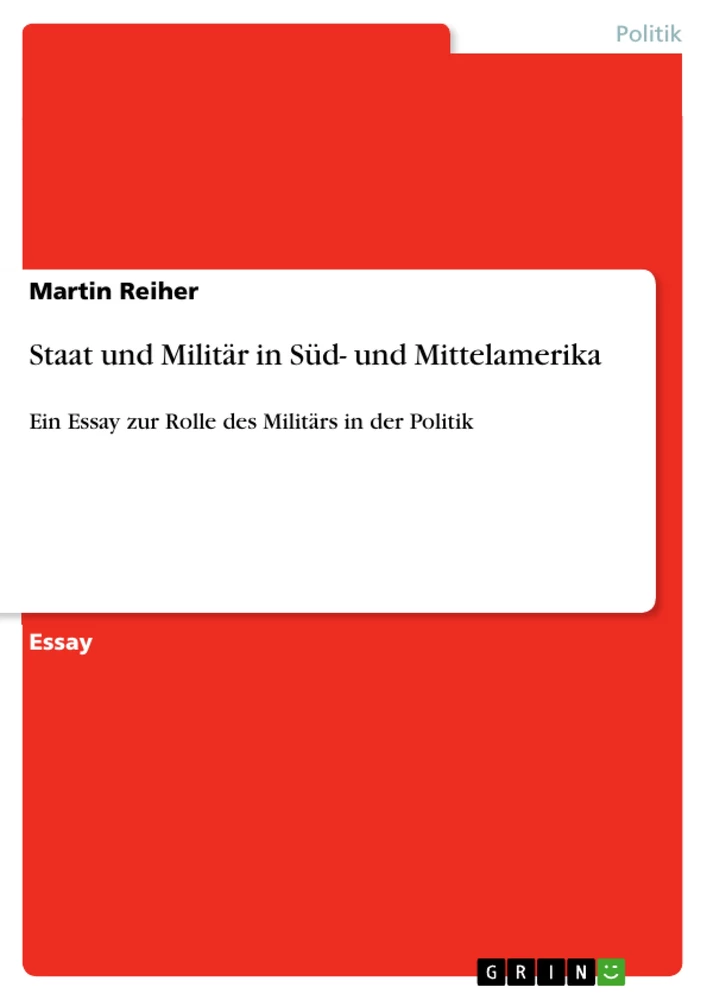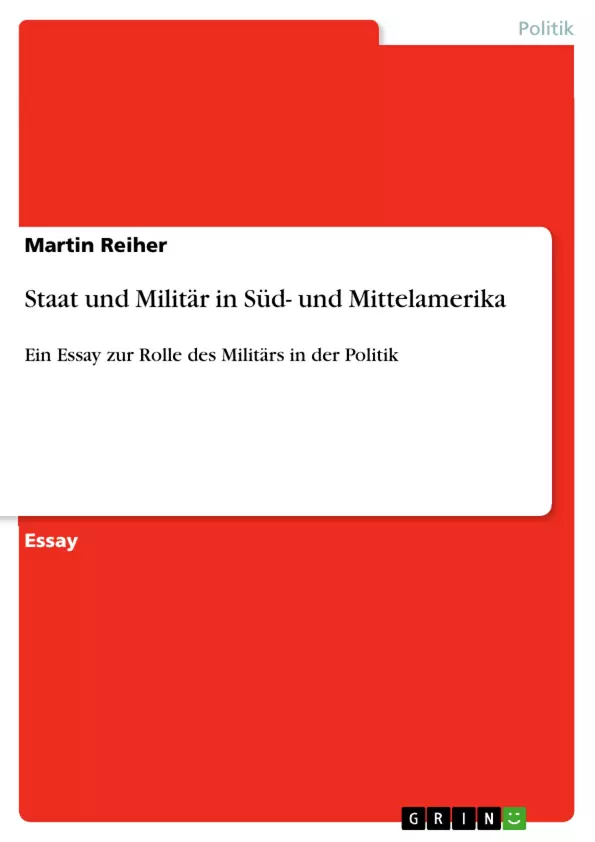Das Essay dient als Einführung in die Beziehung von Staat und Militär in Süd- und Mittelamerika. Neben theoretischen Konzepten wird in einem kurzes Abriss die Entstehung von Staatlichkeit und die Formierung professioneller Streitkräfte vorgestellt. Weiterhin wird der Frage nachgegangen, wie es zu Eingriffen des Militärs in die Politik kommen kann.
Inhalt
Einleitung
Militär und Politik in der Politischen Philosophie
„Exkurs über Militärs in der Politik“ bei Juan Linz
Historische Entwicklung von Staat und Militär in Süd- und Mittelamerika
Militär in der Politik des 20. Jahrhunderts
Fazit
Literaturverzeichnis
Einleitung
Versucht man eine Definition für den Begriff „Militär“ zu finden, stößt man schnell auf Schwierigkeiten: Wie grenzt man zu Söldnern ab, wie zu Milizen und Paramilitärs? Wo liegt der Unterscheid zu Landsknechten, Bürgerwehren, Garden und Guerillas? Alle haben mit Waffen, mit Gewalt oder Tod zu tun und werden als Mittel politischer Macht eingesetzt, einige verstehen sich gar selbst als politische Macht.
Militär und Politik in der Politischen Philosophie
Eine Form sich dem Begriff „Militär“ und dem Verhältnis von Militär zur Politik zu nähern, führt über die klassischen Staatstheorien: Die Gestaltung politischer Gemeinwesen und ihre Selbstorganisation in gefestigten Herrschaftsstrukturen gehört zu den Kernelementen der Politischen Theorie.
Niccolò Machiavelli bezieht in sein Konzept des „Fürstenstaates“ das Militär als Werkzeug politischer Macht ein. Es soll Mittel zum Zeck sein, die Fürstenherrschaft zu stabilisieren und die “unumschränkte Gewalt“ zu sichern. Ist der Fürst gleichzeitig auch Feldherr, kann er das Militär am Besten als Instrument seiner Macht, die sich durchaus durch Grausamkeiten auszeichnen soll, nutzen. Das Militär ist für ihn Basis erfolgreicher Politik und dem Herrscher untergeordnet. Mit seinem Konzept des Fürstenstaates, der mit aller Gewalt erhalten werden muss, schafft Machiavelli nicht nur eine neue Form der Legitimation militärischer Gewalt sondern gilt als einer der Begründer der Idee der Staatsräson.
Thomas Hobbes schafft neben dem Gleichheitsbegriff aller Menschen mit seinem Leviathan die Idee eines Staates als Gesellschaftsvertrag. Dieser Vertrag soll zur Überwindung jenes Naturzustandes, den er als Krieg „eines jeden gegen jeden“ (Hoerster, S. 113) beschreibt, beitragen. In dem das Individuum seine individuelle Macht an eine Staatsfigur abgibt, wird im Gegenzug vom Leviathan Sicherheit und Schutz gewährt. Jegliche Form der Gewalt und damit vor allem die militärische ist in seinem Konzept beim Staat konzentriert. Diese Idee wird fortgeführt im Verständnis des modernen Staatswesens nach Weber. Zu seinem Konzept gehört als Merkmal neben dem Staatsgebiet und dem Staatsvolk auch die Konzentration aller physischen Gewalt beim Staat: das staatliche Gewaltmonopol. Nur allein der Staat und seine Institutionen haben die Legitimation, physische Gewalt auszuüben oder zu legitimieren. In diesem sicherlich idealtypischen Konzept habe alle Akteure die Möglichkeit zur Partizipation, müssen aber bei der Durchsetzung ihrer individuellen Ziele und Interessen auf physische Gewalt verzichten.
Krämer und Kuhn schließlich beziehen das Militär in die Idee des Weberschen Gewaltmonopols ein, in dem sie es als bürokratische Institution betrachten, die das Gewaltmonopol nach außen sichert, wie es die Polizei nach innen tut.
„Exkurs über Militärs in der Politik“ bei Juan Linz
Juan Linz führt unterschiedliche Faktoren auf, die zu Eingriffen des Militärs in die Politik führen können. So gibt es einige südamerikanischen Verfassungen, die dem Militär eine moderierende Macht in Krisensituationen einräumen und so militärische Interventionen legitimieren. Die Zivilisten selbst sind es dann, die das Militär um Unterstützung beim Putsch oder bei der Verteidigung ihrer Regierung bitten. Weiterhin ist es in schweren Krisen eher wahrscheinlich, dass staatliche Sicherheitsorgane wie das Militär eine wichtige politische Rolle übernehmen und zur Überwindung der Krise beitragen. Auch die institutionellen Kontrollmechanismen eines Staatswesens sind entscheidend: In den verschiedenen politischen Systemen gibt es durchaus unterschiedliche Qualitäten der Unterordnung des Militärs unter die zivile Kontrolle. Linz ergänzt seine Ausführungen mit zwei Modellen von Alfred Stepan, die eine hohe Wahrscheinlichkeit militärischer Intervention aufweisen- dem „moderierenden Muster zivil-militärischer Beziehungen“ und dem „neuen Professionalismus“. Beide sind für Linz eine „institutionalisierte Antwort, die dann erfolgreich ist, wenn unter der Führungsschicht der Streitkräfte ein breiter Konsens darüber entsteht, daß die Umstände ihre Intervention legitimieren“ (Linz, S.180). Er ergänzt diese beiden Muster um ein drittes, die „abwartende Haltung“. Das Militär bleibt dabei als neutrale Macht dem politischen Prozess außen vor und unterhöhlt damit das demokratische Regime, so dass es zu dessen Zusammenbruch und die Übernahme der Macht durch das Militär kommen kann. Für Linz kann ein liberales Modell, das auf objektiver und ziviler Kontrolle des Militärs beruht nur ermöglicht werden, wenn alle zivilen Gruppen akzeptieren, dass ein politisch neutrales Offizierkorps besteht und sie nicht versuchen „ihre Macht im militärischen Bereich bzw. mittels des Militärs zu maximieren“ (Krämer/Kuhn, S.18).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wie sah Machiavelli das Verhältnis von Militär und Politik?
Für Machiavelli war das Militär ein reines Werkzeug des Fürsten zur Machtsicherung. Er sah das Militär als Basis erfolgreicher Politik und betonte die Notwendigkeit der Unterordnung unter den Herrscher.
Was bedeutet das "staatliche Gewaltmonopol" nach Max Weber?
Das Gewaltmonopol besagt, dass nur der Staat und seine Institutionen (Militär, Polizei) die Legitimation haben, physische Gewalt auszuüben. Alle anderen Akteure müssen darauf verzichten.
Warum greift das Militär in Südamerika oft in die Politik ein?
Juan Linz nennt Gründe wie Krisensituationen, Verfassungen, die dem Militär eine "moderierende Macht" einräumen, oder das Scheitern ziviler Institutionen, die das Militär zur Intervention einladen.
Was ist das "moderierende Muster" zivil-militärischer Beziehungen?
Es beschreibt eine Situation, in der das Militär als Schiedsrichter auftritt, um politische Krisen durch Intervention zu beenden, oft mit Zustimmung oder auf Wunsch ziviler Akteure.
Wie unterscheidet sich Militär von Milizen oder Paramilitärs?
Das Militär ist eine bürokratisierte, staatliche Institution mit offiziellem Auftrag zur Außenverteidigung, während Milizen oder Paramilitärs oft außerhalb staatlicher Kontrolle oder in rechtlichen Grauzonen agieren.
- Citation du texte
- Martin Reiher (Auteur), 2008, Staat und Militär in Süd- und Mittelamerika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87336