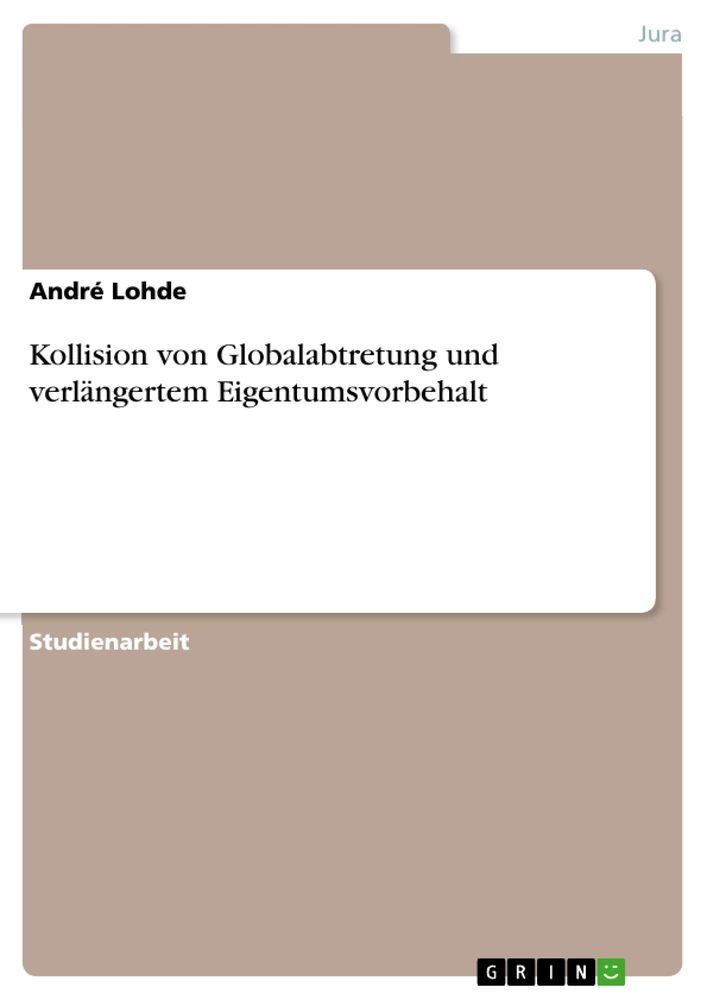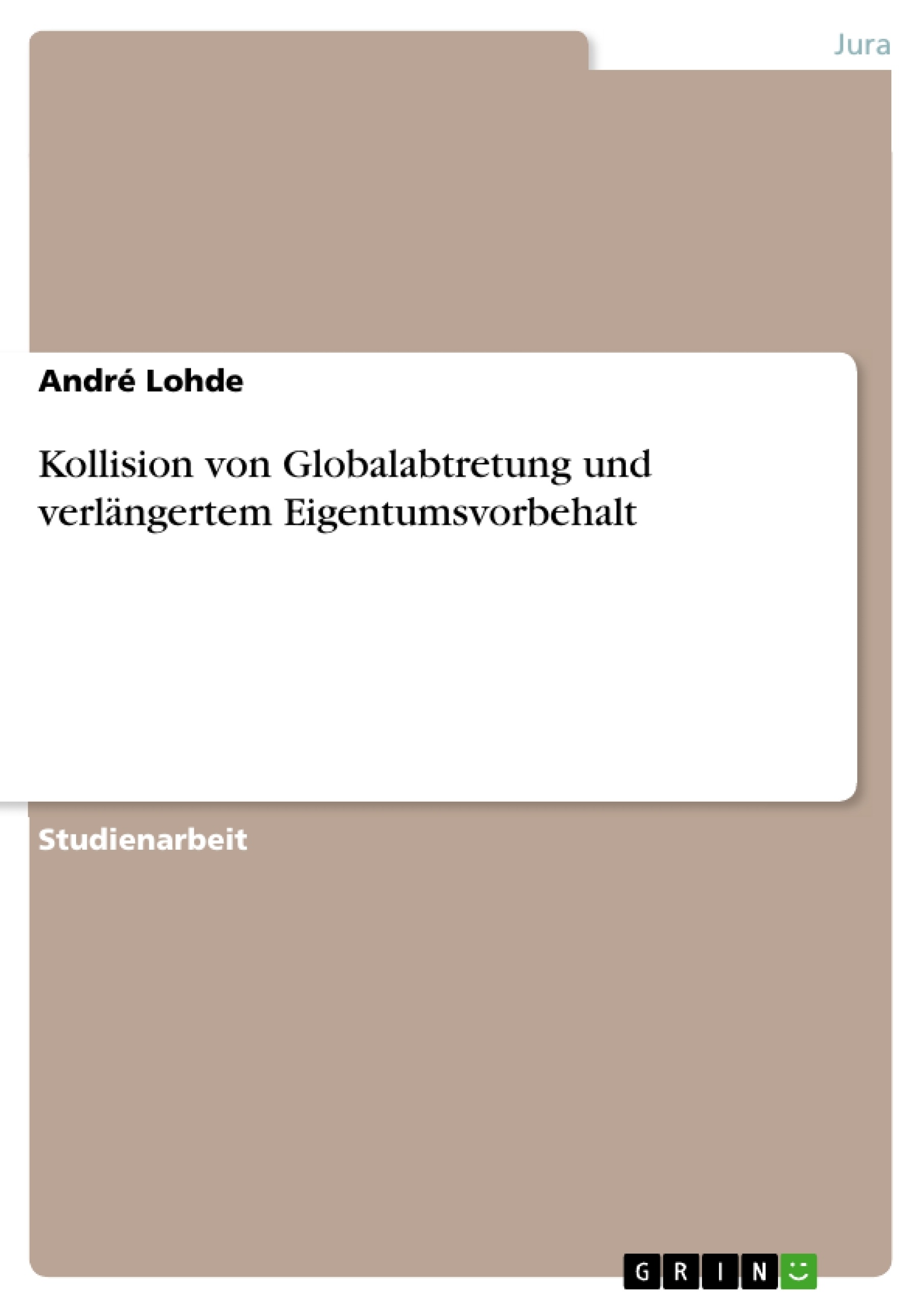Nach Jahren der wirtschaftlichen Stagnation, hoher Arbeitslosenzahlen und grassierender Pleitewelle, befindet sich die Bundesrepublik Deutschland nunmehr in einem konjunkturellen Aufschwung. Eine verbesserte Auftragslage, aber auch lange aufgeschobene Investitionen aus den 1990igern, erfordern die Anschaffung neuer Produktionsmittel bzw. die Erweiterung be-reits vorhandener Kapazitäten. Zur Finanzierung der Investitionen nimmt der Unternehmer i. d. R. sowohl Waren- als auch Geldkredit in Anspruch. Im Gegenzug zum gewährten Kredit lassen sich die Sicherungsgeber häufig Forderungen zur Sicherung abtreten, stellen diese doch oftmals einen beträchtlichen Teil des Aktivvermögens des Unternehmens dar.
Der Kreditgeber kommt dabei im Insolvenzfall in den Genuss der abgesonderten Befriedigung, §§ 50 i. V. m. 51 Nr. 1 InsO. Trotzdem können auch die gesicherten Gläubiger nicht mit voller Befriedigung rechnen, so liegt der Wertverfall bei Forderungen bei etwa 60 %. Ferner wurde auf Grundlage einer Umfrage ermittelt, dass die Sicherheiten von Kreditinstituten ihre Forderungen zu ca. 79 % abdeckten, bei Warenlieferanten und sonstigen Gläubigern ergab sich eine Quote von 62,5 %.
Die Zahlen illustrieren das Interesse der Kreditgeber an Realisierung der ihnen bestellten Sicherheiten. Durch die gleichzeitige Inanspruchnahme von Waren- und Geldkredit durch den Unternehmer, ist im Krisenfall des Schuldners eine Konkurrenz der Sicherungsgeber bereits vorgezeichnet.
Dieser hier problematisierte Konflikt beschäftigte bereits das RG und sorgt auch noch in heutiger Zeit für einen wissenschaftlichen Disput zwischen Judikatur und Schrifttum. In der Vergangenheit heftig umstritten, teils als „wissenschaftliche Materialschlacht“ , andernorts als „täglicher Grabenkrieg“ bezeichnet, hat sich die Diskussion heute beruhigt.
Ziel der vorliegenden Arbeit soll es dabei nicht sein, möglichst viele Theorien zur Konfliktlösung vorzustellen, vielmehr soll dem geneigten Leser ein ausgewogener Blick auf Rechtsprechung, Literatur und Praxis gleichermaßen gewährt werden.
Im Hauptteil dieser Bearbeitung erfolgt zunächst eine auf das Wesentliche reduzierte Darstellung der Grundlagen zum verlängerten Eigentumsvorbehalt und der Globalzession, um den versierten Leser den Einstieg in die Problematik zu erleichtern, ohne aber näher auf die umfangreiche Kasuistik zu beiden Rechtsinstituten eingehen zu wollen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Hauptteil
- I. Allgemeine Grundlagen
- 1. Sicherungsabtretung
- a) Allgemeines zur Sicherungszession
- b) Vorauszession
- aa) Generelle Zulässigkeit der Abtretung künftiger Forderungen
- bb) Individualisierung der künftigen Forderung
- c) Sonderformen der Sicherungsabtretung
- aa) Globalzession
- bb) Verlängerter Eigentumsvorbehalt
- 2. Interessenlage
- a) Interesse des Sicherungsgebers
- b) Interesse der Warenkreditgeber
- c) Interesse der Geldkreditgeber
- 3. Kollisionslage
- 1. Sicherungsabtretung
- II. Die höchstrichterliche Rechtsprechung im Wandel der Zeit
- 1. Exkurs: Die mangelnde Akzeptanz des verlängerten Eigentumsvorbehalts in den 1930ern
- 2. Rechtsprechung des RG
- 3. Rechtsprechung des BGH
- a) BGH-Urteil vom 25.10.1952
- b) BGH-Urteil vom 30.04.1959
- aa) Prioritätsgrundsatz
- (1) Dogmatische Herleitung des Prioritätsgrundsatzes
- (a) „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“
- (b) Sonstige Erklärungsalternativen
- (2) Sperrwirkung der Globalzession
- (1) Dogmatische Herleitung des Prioritätsgrundsatzes
- bb) Vertragsbruchtheorie
- (1) Verleitung zum Vertragsbruch
- (2) Zusammenfassung
- (3) Konkretisierung der Vertragsbruchtheorie durch nachfolgende BGH-Urteile
- aa) Prioritätsgrundsatz
- c) Reaktionen der Banken
- aa) Verpflichtungsklausel
- bb) Dingliche (Teil-) Verzichtsklausel
- cc) Schuldrechtliche Teilverzichtsklausel
- dd) Zahlstellenklausel
- 4. Kritische Zusammenfassung der BGH-Rspr.
- III. Lösungsmodelle in Literatur & Praxis
- 1. Meinungsspektrum in der Literatur
- a) Näheprinzip & Surrogationstheorie
- b) Teilungstheorien
- aa) Ausgangspunkt: Teilungstheorie von Erman
- bb) Teilung nach Wertquoten
- cc) Zwangsteilung nach Kredithöhe
- 2. Poolvereinbarungen
- 1. Meinungsspektrum in der Literatur
- I. Allgemeine Grundlagen
- C. Schlussgedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Konflikt zwischen Globalabtretung und verlängertem Eigentumsvorbehalt im Kontext der Kreditfinanzierung. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die Rechtsprechung, Literatur und Praxis zu diesem Thema zu geben und verschiedene Lösungsansätze zu präsentieren, ohne sich auf eine einzige Theorie zu konzentrieren.
- Konflikt zwischen Globalabtretung und verlängertem Eigentumsvorbehalt
- Rechtsprechung des Reichsgerichts (RG) und des Bundesgerichtshofs (BGH)
- Verschiedene Lösungsmodelle in der Literatur und Praxis (z.B. Teilungstheorien, Poolvereinbarungen)
- Interessenlage der beteiligten Parteien (Sicherungsgeber, Warenkreditgeber, Geldkreditgeber)
- Entwicklung der Rechtsprechung im Zeitverlauf
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den aktuellen wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland und den damit verbundenen erhöhten Bedarf an Kreditfinanzierungen für Investitionen. Sie hebt den daraus resultierenden Konflikt zwischen Sicherungsgebern (durch Globalabtretung und verlängerten Eigentumsvorbehalt) hervor und benennt das Ziel der Arbeit: eine ausgewogene Darstellung der Rechtsprechung, Literatur und Praxis zu diesem Thema.
B. Hauptteil I. Allgemeine Grundlagen: Dieser Abschnitt legt die Grundlagen für die Auseinandersetzung mit dem Konflikt. Er definiert die Sicherungsabtretung, insbesondere die Globalzession und den verlängerten Eigentumsvorbehalt, und erläutert die Interessenlage der verschiedenen beteiligten Parteien (Sicherungsgeber, Warenkreditgeber, Geldkreditgeber). Die Kollisionslage, also der eigentliche Konflikt, wird ebenfalls eingeführt.
B. Hauptteil II. Die höchstrichterliche Rechtsprechung im Wandel der Zeit: Dieser Teil befasst sich ausführlich mit der Entwicklung der Rechtsprechung zum Konflikt, beginnend mit einem Exkurs zur mangelnden Akzeptanz des verlängerten Eigentumsvorbehalts in den 1930er Jahren. Es werden die Urteile des Reichsgerichts und insbesondere des Bundesgerichtshofs analysiert, insbesondere die Entwicklung vom Prioritätsgrundsatz zur Vertragsbruchtheorie. Die Reaktionen der Banken auf die Rechtsprechung (Verpflichtungsklauseln, dingliche und schuldrechtliche Teilverzichtsklauseln, Zahlstellenklauseln) werden ebenfalls beleuchtet. Der Abschnitt schließt mit einer kritischen Zusammenfassung der BGH-Rechtsprechung.
B. Hauptteil III. Lösungsmodelle in Literatur & Praxis: Dieser Kapitelteil untersucht verschiedene Lösungsansätze für den Konflikt, die in der Literatur und Praxis diskutiert werden. Hierzu gehören verschiedene Teilungstheorien und das Konzept der Poolvereinbarungen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der unterschiedlichen Meinungen und Ansätze zur Konfliktlösung.
Schlüsselwörter
Globalabtretung, verlängerter Eigentumsvorbehalt, Sicherungszession, Kreditfinanzierung, Rechtsprechung, BGH, RG, Prioritätsgrundsatz, Vertragsbruchtheorie, Teilungstheorien, Poolvereinbarungen, Interessenlage, Kollision, Lösungsmodelle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Konflikts zwischen Globalabtretung und verlängertem Eigentumsvorbehalt
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert den Konflikt zwischen Globalabtretung und verlängertem Eigentumsvorbehalt im Kontext der Kreditfinanzierung. Sie bietet einen umfassenden Überblick über die Rechtsprechung, Literatur und Praxis zu diesem Thema und präsentiert verschiedene Lösungsansätze.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt den Konflikt zwischen Globalabtretung und verlängertem Eigentumsvorbehalt, die Rechtsprechung des Reichsgerichts (RG) und des Bundesgerichtshofs (BGH), verschiedene Lösungsmodelle in Literatur und Praxis (z.B. Teilungstheorien, Poolvereinbarungen), die Interessenlage der beteiligten Parteien (Sicherungsgeber, Warenkreditgeber, Geldkreditgeber) und die Entwicklung der Rechtsprechung im Zeitverlauf.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung (A), einen Hauptteil (B) mit drei Unterabschnitten (I. Allgemeine Grundlagen, II. Die höchstrichterliche Rechtsprechung im Wandel der Zeit, III. Lösungsmodelle in Literatur & Praxis) und Schlussgedanken (C). Der Hauptteil analysiert den Konflikt systematisch, beginnend mit grundlegenden Definitionen und der Interessenlage der Beteiligten, über die historische Entwicklung der Rechtsprechung bis hin zu aktuellen Lösungsansätzen.
Welche Rechtsprechung wird untersucht?
Die Arbeit untersucht ausführlich die Rechtsprechung des Reichsgerichts (RG) und des Bundesgerichtshofs (BGH). Besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung der Rechtsprechung vom Prioritätsgrundsatz zur Vertragsbruchtheorie und den Reaktionen der Banken darauf (Verpflichtungsklauseln, dingliche und schuldrechtliche Teilverzichtsklauseln, Zahlstellenklauseln).
Welche Lösungsmodelle werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Lösungsmodelle aus Literatur und Praxis, darunter verschiedene Teilungstheorien (z.B. nach Wertquoten oder Kredithöhe) und das Konzept der Poolvereinbarungen. Die unterschiedlichen Meinungen und Ansätze zur Konfliktlösung werden dargestellt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Globalabtretung, verlängerter Eigentumsvorbehalt, Sicherungszession, Kreditfinanzierung, Rechtsprechung, BGH, RG, Prioritätsgrundsatz, Vertragsbruchtheorie, Teilungstheorien, Poolvereinbarungen, Interessenlage, Kollision und Lösungsmodelle.
Welche Interessenlagen werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die Interessenlagen des Sicherungsgebers, der Warenkreditgeber und der Geldkreditgeber. Die unterschiedlichen Perspektiven und Interessenkonflikte werden analysiert.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, einen umfassenden und ausgewogenen Überblick über die Rechtsprechung, Literatur und Praxis zum Konflikt zwischen Globalabtretung und verlängertem Eigentumsvorbehalt zu geben und verschiedene Lösungsansätze zu präsentieren, ohne sich auf eine einzige Theorie zu konzentrieren.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Juristen, Wissenschaftler, Studierende und alle, die sich mit den Themen Kreditfinanzierung, Sicherungsrechte und Konfliktlösung im Wirtschaftsrecht auseinandersetzen.
- Quote paper
- André Lohde (Author), 2007, Kollision von Globalabtretung und verlängertem Eigentumsvorbehalt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87366