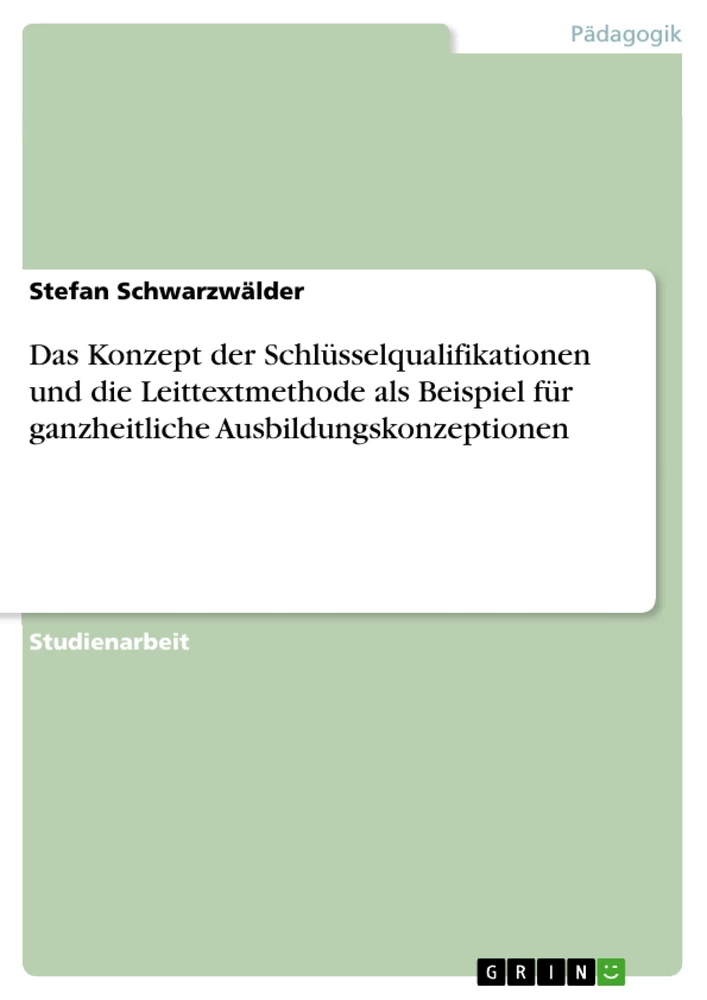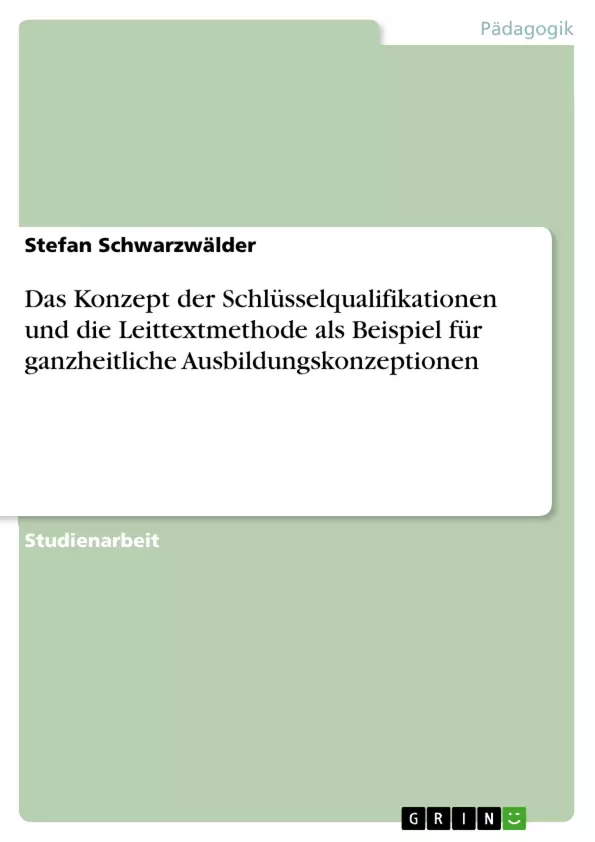Durch immer kürzere Innovationszyklen der Informations- und Kommunikationstechniken vollzog und vollzieht sich in den Bereichen Maschinenbau und Elektrotechnik ein stetig fortschreitender Strukturwandel. Zeichnete sich das tradierte Bild des Facharbeiters dadurch aus, dass er als ausführender Mitarbeiter seine Arbeitsaufträge erledigte, so wird zukünftig der kreativ - denkende und selbständig handelnde „Mitdenker“ auf allen Ebenen des Betriebs gefordert sein.
Die Ausbildung muss sich dieser Entwicklung öffnen, will sie mit ihrer Ausbildung dem Anforderungs- beziehungsweise Kompetenzprofil des Facharbeiters von „morgen“ verantwortungsvoll gerecht werden. Unterweisung darf sich daher nicht (mehr) auf die reine Wissensvermittlung isolierter fachlicher Inhalte beschränken. Lernprozesse müssen ganzheitlich angelegt sein, sollen sie berufliches Handeln nach- und abbilden. Das rasante Veränderungstempo von Lerninhalten und die geänderten Qualifikationsprofile fordern zwangsläufig geänderte Unterrichtsmethoden ein.
Dazu ist es erforderlich, zuerst auf die Qualifikations- und Lernanforderungen einzugehen, mit denen sich Mitarbeiter in modernen Arbeitsstrukturen auseinandersetzen müssen. Die Betrachtung bezieht sich dabei vor allem auf Untersuchungen von Tätigkeiten in der industriellen Produktion, da die Entwicklungen dort besonders gut dokumentiert sind (vergleiche Sonntag, 1989, 1996; Schaper, 1995). Die Trends der Anforderungsentwicklung und ihre Konsequenzen für die Gestaltung beruflichen Lernens lassen sich folgendermaßen charakterisieren:
- Komplexität und Informationsvielfalt ist ein wesentliches Bestimmungsmerkmal beruflicher Aufgaben in modernen Arbeitsstrukturen. Die Art der Aufgabenkomplexität und der dabei zu verarbeitenden Information ist aber situativ geprägt und sehr unterschiedlich. Lösungsansätze beziehungsweise - strategien können daher nicht algorithmisiert werden, sondern erfordern die Förderung eines selbständigen, situativ angepassten problemlösenden Handelns und Wissens.
- Komplexe Arbeitsaufgaben in modernen Produktionssystemen stellen außerdem hohe Anforderungen an Wissens- und Expertiseleistungen der Mitarbeiter. Berufsanfänger können diese nur partiell bewältigen und benötigen lange Lern - beziehungsweise Erfahrungsprozesse, um ein entsprechendes Expertenwissen und - können aufzubauen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Schlüsselqualifikationen
- 2.1 Zum Begriff der Qualifikation
- 2.2 Zu Schlüsselqualifikationen
- 2.2.1 Zum Begriff der Schlüsselqualifikationen
- 2.2.2 Zur Entstehung des Begriffes Schlüsselqualifikationen
- 2.3 Zur Begründung der Notwendigkeit von Schlüsselqualifikationen
- 2.4 Schlüsselqualifikationen und ihre Umsetzung in der Praxis
- 2.4.1 In der Schule
- 2.4.1.1 Schlüsselqualifikationen in der Schule
- 2.4.1.2 Vermittlung von Schlüsselqualifikationen in der Schule
- 2.4.1.4 Handlungskompetenz und Handlungsorientierter Unterricht im Kontext der Schlüsselqualifikationen
- 2.4.2 In der Wirtschaft
- 2.5 Schlüsselqualifikationen im Kontext der gesetzlichen Bestimmungen
- 2.6 Beispiele für Schlüsselqualifikationen
- 2.7 Schlüsselqualifikationskonzept nach REFA
- 2.8 Schlüsselqualifikationskonzept nach Siemens
- 2.9 Kritik am Konzept der Schlüsselqualifikationen
- 3. Methoden der betrieblichen Unterweisung
- 3.1 Methoden der Ausbildung
- 3.1.1 Verschiedene Ansätze der Industrie
- 3.1.2 Auflistung der verschiedenen Methoden
- 3.2 Die Leittextmethode
- 3.3 Der Leittext
- 3.3.1 Bestandteile des Leittextes
- 3.3.2 Erstellung eines Leittextes
- 3.3.3 Beispiel zum Erstellen eines Leittextes anhand einer Verdrahtungsübung
- 3.4 Ablaufsplan der Leittextmethode
- 3.5 Beispiel einer Leittextaufgabe
- 3.6 Fazit zur Leittextmethode
- 4. Nachwort
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Konzept der Schlüsselqualifikationen und die Leittextmethode als Beispiele für ganzheitliche Ausbildungskonzeptionen. Ziel ist es, die Bedeutung von Schlüsselqualifikationen im Kontext des sich verändernden Arbeitsmarktes zu beleuchten und die Leittextmethode als eine geeignete Methode zur Vermittlung dieser Qualifikationen zu analysieren.
- Bedeutung von Schlüsselqualifikationen für die berufliche Ausbildung
- Die Leittextmethode als Instrument zur ganzheitlichen Ausbildung
- Analyse der Umsetzung von Schlüsselqualifikationen in Schule und Wirtschaft
- Kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der Schlüsselqualifikationen
- Vergleich verschiedener Methoden der betrieblichen Unterweisung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Strukturwandel im Maschinenbau und der Elektrotechnik aufgrund schneller Innovationszyklen in der Informations- und Kommunikationstechnik. Sie argumentiert, dass die Ausbildung zukünftige Anforderungen an kreativ denkende und selbständig handelnde Mitarbeiter berücksichtigen muss und ganzheitliche Lernprozesse fördern sollte. Der Fokus liegt auf den sich verändernden Qualifikationsprofilen und den daraus resultierenden Anforderungen an die Unterrichtsmethoden, insbesondere im Kontext der industriellen Produktion.
2. Schlüsselqualifikationen: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit dem Begriff der Schlüsselqualifikationen. Es analysiert den Begriff "Qualifikation" an sich, um dann den spezifischen Begriff "Schlüsselqualifikationen" zu definieren und dessen Entstehung zu beleuchten. Darauf folgt eine Begründung der Notwendigkeit von Schlüsselqualifikationen und eine detaillierte Betrachtung ihrer Umsetzung in Schule und Wirtschaft, einschliesslich einer kritischen Auseinandersetzung mit bestehenden Konzepten (REFA, Siemens) und deren Grenzen. Der Kontext gesetzlicher Bestimmungen wird ebenso beleuchtet.
3. Methoden der betrieblichen Unterweisung: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über verschiedene Methoden der betrieblichen Ausbildung, mit einem Schwerpunkt auf der Leittextmethode. Es beschreibt den Aufbau und die Erstellung von Leittexten, detailliert den Ablauf der Methode und gibt ein Beispiel für eine Leittextaufgabe. Der Abschnitt bewertet die Leittextmethode kritisch und fasst ihre Vor- und Nachteile zusammen. Es werden verschiedene Ansätze aus der Industrie vorgestellt und verglichen.
Schlüsselwörter
Schlüsselqualifikationen, Leittextmethode, ganzheitliche Ausbildung, berufliche Bildung, Kompetenzentwicklung, industrielle Produktion, Strukturwandel, Unterrichtsmethoden, Handlungskompetenz, Qualitätszirkel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Schlüsselqualifikationen und die Leittextmethode
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das Konzept der Schlüsselqualifikationen und die Leittextmethode als Beispiele für ganzheitliche Ausbildungskonzeptionen. Sie beleuchtet die Bedeutung von Schlüsselqualifikationen im Kontext des sich verändernden Arbeitsmarktes und analysiert die Leittextmethode als geeignetes Werkzeug zur Vermittlung dieser Qualifikationen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Bedeutung von Schlüsselqualifikationen für die berufliche Ausbildung, die Leittextmethode als Instrument der ganzheitlichen Ausbildung, die Umsetzung von Schlüsselqualifikationen in Schule und Wirtschaft, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der Schlüsselqualifikationen und einen Vergleich verschiedener Methoden der betrieblichen Unterweisung.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu Schlüsselqualifikationen (inkl. Definition, Entstehung, Notwendigkeit, Umsetzung in Schule und Wirtschaft, kritische Betrachtung bestehender Konzepte und gesetzliche Bestimmungen), ein Kapitel zu Methoden der betrieblichen Unterweisung mit Fokus auf die Leittextmethode (inkl. Aufbau, Erstellung, Ablauf und Beispiel), ein Nachwort und ein Literaturverzeichnis. Zusätzlich beinhaltet sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was sind Schlüsselqualifikationen und warum sind sie wichtig?
Die Seminararbeit definiert und analysiert den Begriff "Schlüsselqualifikationen" detailliert. Sie betont deren Notwendigkeit im Kontext des sich verändernden Arbeitsmarktes, insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen an kreativ denkende und selbständig handelnde Mitarbeiter in der industriellen Produktion. Die Bedeutung von Schlüsselqualifikationen für die berufliche Ausbildung wird ausführlich diskutiert.
Was ist die Leittextmethode und wie funktioniert sie?
Die Arbeit beschreibt die Leittextmethode als eine Methode der betrieblichen Unterweisung. Sie erklärt den Aufbau und die Erstellung von Leittexten, den Ablauf der Methode und liefert ein Beispiel für eine Leittextaufgabe. Die Vor- und Nachteile der Methode werden kritisch bewertet und im Vergleich zu anderen Methoden aus der Industrie betrachtet.
Welche Methoden der betrieblichen Unterweisung werden verglichen?
Die Seminararbeit gibt einen Überblick über verschiedene Methoden der betrieblichen Ausbildung und vergleicht diese mit der Leittextmethode. Dabei werden insbesondere verschiedene Ansätze aus der Industrie vorgestellt und deren Stärken und Schwächen analysiert. Ein besonderer Fokus liegt auf der ganzheitlichen Ausbildung.
Welche kritischen Aspekte werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit enthält eine kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der Schlüsselqualifikationen, den bestehenden Konzepten (z.B. REFA, Siemens) und deren Grenzen. Auch die Leittextmethode wird kritisch bewertet und ihre Vor- und Nachteile werden abgewogen.
Welche Quellen werden in der Seminararbeit verwendet?
Die Seminararbeit enthält ein Literaturverzeichnis mit den verwendeten Quellen. Die genaue Auflistung der Quellen ist im Kapitel "Literaturverzeichnis" zu finden.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Seminararbeit ist relevant für alle, die sich mit beruflicher Bildung, Kompetenzentwicklung, industrieller Produktion und ganzheitlichen Ausbildungskonzepten beschäftigen. Sie richtet sich insbesondere an Ausbilder, Pädagogen und Personen, die sich für die Weiterentwicklung von Unterrichtsmethoden interessieren.
- Quote paper
- Dipl.-Ing. Stefan Schwarzwälder (Author), 2001, Das Konzept der Schlüsselqualifikationen und die Leittextmethode als Beispiel für ganzheitliche Ausbildungskonzeptionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87375