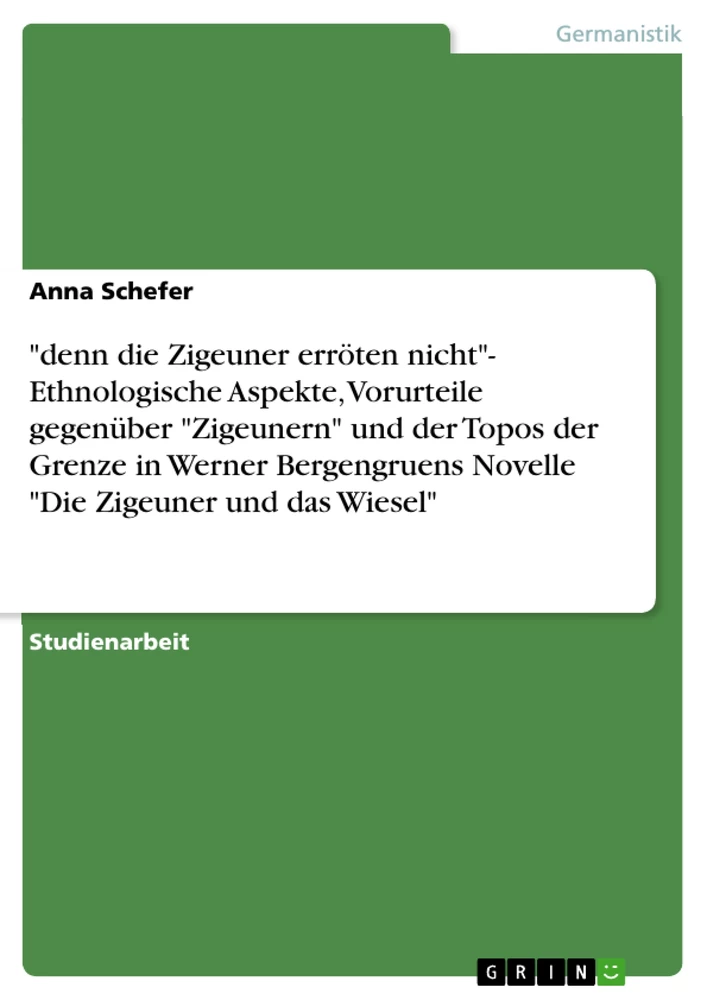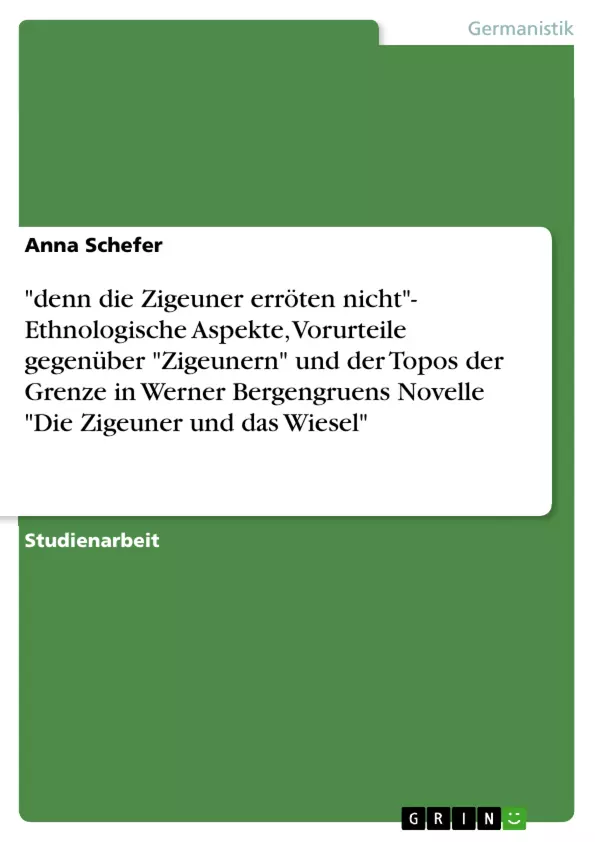Die Süddeutsche Zeitung schreibt am 4./5. August 2007 in einem Artikel mit der Überschrift »Der unbekannte Holocaust«:
Erst seit 2001 gibt es im Stammlager Auschwitz eine Dauerausstellung über den Genozid an den Sinti und Roma. Wladyslaw Bartoszewski sagte bei der Eröffnung der Ausstellung: »Niemand, der bei gesundem Verstand ist, stellt heute den Holocaust am jüdischen Volke in Abrede. Dieses Bewusstsein hat sich in Bezug auf die Sinti und Roma leider noch nicht allgemein durchgesetzt.«
Dass diese Tradition der Verdrängung bzw. des Nicht-Reflektierens über den Genozid an den Sinti und Roma schon früh generiert wurde, zeigt die Novelle »Die Zigeuner und das Wiesel« des 1892 in Riga geborenen Autors Werner Bergengruen. Die Novelle wurde 1927 als fünftes Stück des »Buch Rodenstein« veröffentlicht. Im Jahr 1942 wurde das »Buch Rodenstein« um sieben Stücke erweitert und 1950 das Werk unverändert neu aufgelegt. Bemerkenswert ist an dieser Neuauflage, dass die Art und Weise der Darstellung der Protagonisten, »die Zigeuner«, in der Novelle keine Veränderung erfährt. Dies ist insofern denkwürdig, als dass das Buch nur wenige Jahre nach dem Völkermord an den Sinti und Roma, dem allein in Deutschland ungefähr 15 000 Sinti und Roma zum Opfer fielen, wieder aufgelegt wurde. Eine Reflektion über Themen, Inhalte und Darstellungsweise »die Zigeuner« betreffend, scheint weder beim Autor noch bei den Verlegern stattgefunden zu haben.
Werner Bergengruen bezog die Informationen über Lebens- und Verhaltensweisen »der Zigeuner« aus dem Buch »Historischer Versuch über die Zigeuner betreffend die Lebensart und Verfassung, Sitten und Schicksale dieses Volks seit seiner Erscheinung in Europa, und dessen Ursprung« des Historikers Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann. Bergengruen entnimmt dem Buch Grellmanns »ethnologische Fakten« über die »Zigeuner«. Er suggeriert dem Leser durch diese in der Novelle erscheinenden »ethnologischen Fakten« eine hohe Wissensautorität und schildert scheinbar »typische« Lebens- und Verhaltensweisen der Protagonisten.
Die vorliegende Arbeit untersucht die in der Novelle erscheinenden ethnologischen »Informationen« und vergleicht diese mit den Ergebnissen der »ethnographischen Untersuchung« Grellmanns. Eine Untersuchung der Charakterisierung der Protagonisten ist dafür unerlässlich, denn auch die Beschreibung derselben beinhaltet Passagen »ethnologischer« Aspekte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ethnologische Aspekte in der Novelle »Die Zigeuner und das Wiesel«
- Darstellungen der Protagonisten
- Ethnologisches »Wissen« Grellmanns
- Vorurteile und Stereotypisierung
- Ursprünge und Wirkungen von Vorurteilen
- Vorurteile in »Die Zigeuner und das Wiesel«
- Das Eigene und das Fremde
- Exklusion und Integration
- Grenze und Grenzüberschreitung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Novelle »Die Zigeuner und das Wiesel« von Werner Bergengruen, die 1927 als Teil des »Buch Rodenstein« veröffentlicht wurde. Die Arbeit untersucht die in der Novelle erscheinenden ethnologischen »Informationen« und vergleicht diese mit den Ergebnissen der »ethnographischen Untersuchung« des Historikers Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann. Sie analysiert auch die Darstellung der Protagonisten, die in der Novelle vorherrschenden Vorurteile und Stereotypisierungen sowie das Verhältnis zwischen dem Eigenen und dem Fremden. Die Arbeit untersucht, wie diese Aspekte zur Konstruktion von »Zigeunerbildern« beitragen.
- Ethnologische Aspekte in der Novelle
- Vorurteile und Stereotypisierungen gegenüber Sinti und Roma
- Der Topos der Grenze und die Darstellung der »Zigeuner« als Grenzgänger
- Konstruktion von Identität und Alterität
- Reproduktion von Vorurteilen und die Beständigkeit von »Zigeunerbildern«
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den historischen Kontext und die Relevanz der Novelle im Hinblick auf den Genozid an den Sinti und Roma. Sie erläutert die Quellenbasis der Arbeit, insbesondere das Werk von Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann, das Bergengruen als Grundlage für seine Darstellung der »Zigeuner« verwendete.
Kapitel 2 untersucht die in der Novelle erscheinenden ethnologischen »Informationen« und vergleicht diese mit den Ergebnissen der »ethnographischen Untersuchung« Grellmanns. Es analysiert die Darstellung der Protagonisten und zeigt, wie Bergengruen durch die Verwendung von kategorisierenden Begriffen eine Homogenisierung der »Zigeuner« und eine einheitliche »Zigeuneridentität« konstruiert.
Kapitel 3 befasst sich mit den Vorurteilen und stereotypisierten Darstellungen in der Novelle. Es untersucht die Ursprünge und Wirkungen von Vorurteilen und beleuchtet, wie diese in Bergengruens Werk zum Ausdruck kommen.
Kapitel 4 analysiert das Verhältnis zwischen dem Eigenen und dem Fremden in der Novelle. Es untersucht die Themen der Exklusion und Integration sowie der Grenze und Grenzüberschreitung und zeigt, wie diese in der Seiltanzsequenz am Ende der Novelle zum Ausdruck kommen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Vorurteile, Stereotypisierung, ethnologisches Wissen, Sinti und Roma, Grenzgänger, Identität, Alterität, Exklusion, Integration und der Novelle »Die Zigeuner und das Wiesel« von Werner Bergengruen. Sie untersucht, wie diese Aspekte in der literarischen Darstellung der »Zigeuner« zum Ausdruck kommen und welche Auswirkungen sie auf die Konstruktion von »Zigeunerbildern« haben.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Werner Bergengruens Novelle "Die Zigeuner und das Wiesel"?
Die Novelle thematisiert die Darstellung von Sinti und Roma anhand literarischer Motive und befasst sich mit Vorurteilen und ethnologischen Zuschreibungen der 1920er Jahre.
Welche Rolle spielt das Werk von Heinrich Grellmann für die Novelle?
Bergengruen nutzte Grellmanns historisches Buch als Quelle für vermeintlich "ethnologische Fakten", die jedoch heute als stereotyp und vorurteilsbehaftet gelten.
Was ist der "Topos der Grenze" in dieser Arbeit?
Er beschreibt die literarische Darstellung der Protagonisten als Grenzgänger zwischen dem Eigenen und dem Fremden sowie ihre soziale Exklusion.
Warum ist die Neuauflage von 1950 kritisch zu betrachten?
Die Arbeit kritisiert, dass das Buch kurz nach dem Genozid an den Sinti und Roma ohne Reflexion der diskriminierenden Darstellungen neu aufgelegt wurde.
Was bedeutet "Identität und Alterität" im Kontext der Novelle?
Es beschreibt die Konstruktion des "Anderen" (Alterität) zur Abgrenzung und Definition der eigenen gesellschaftlichen Identität durch Stereotypisierung.
- Quote paper
- Anna Schefer (Author), 2007, "denn die Zigeuner erröten nicht"- Ethnologische Aspekte, Vorurteile gegenüber "Zigeunern" und der Topos der Grenze in Werner Bergengruens Novelle "Die Zigeuner und das Wiesel", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87471