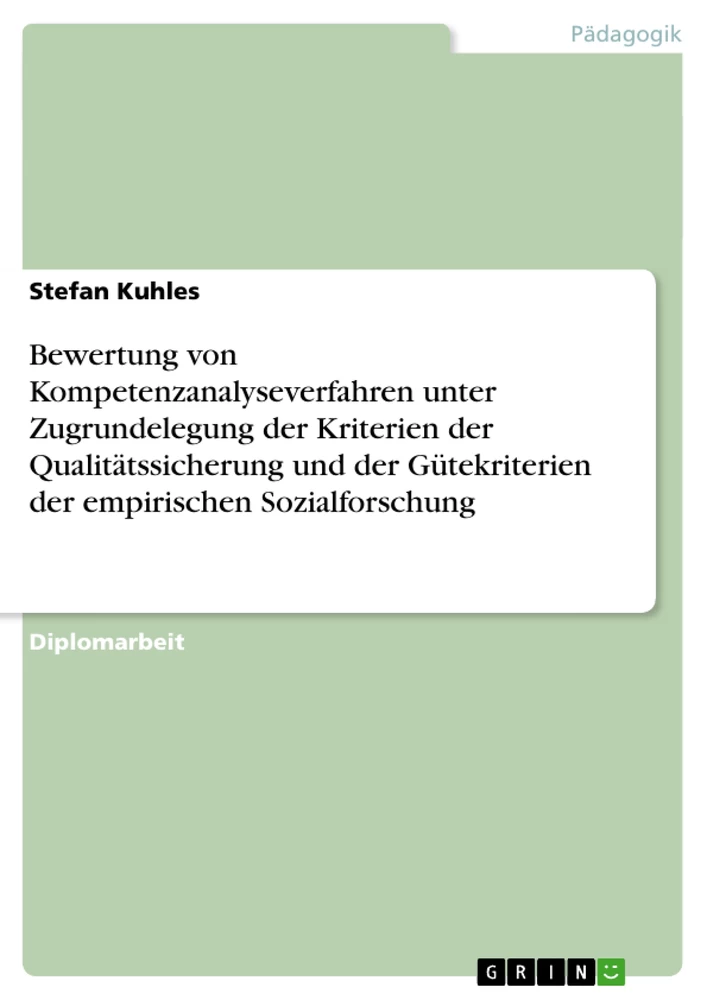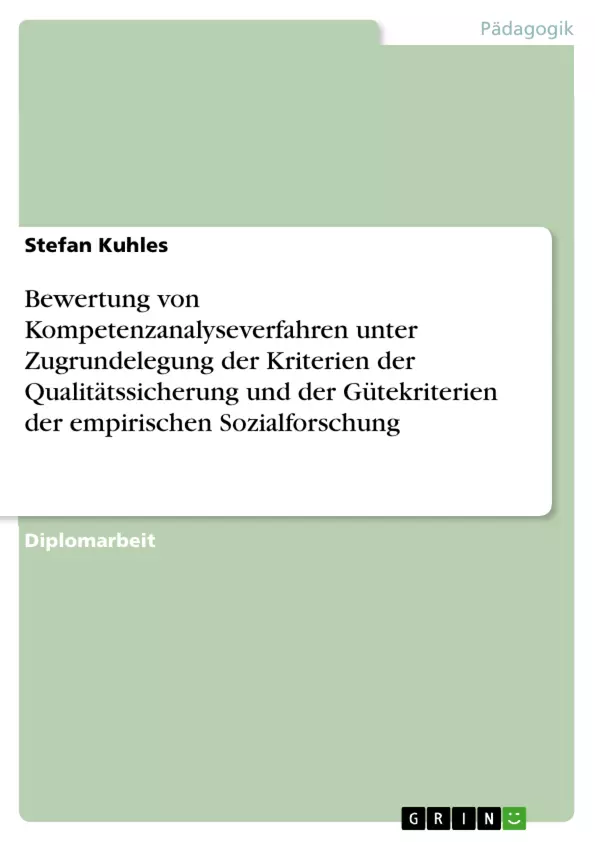Die Rahmenbedingungen für Betriebe und ihre Angestellten unterliegen heute einem epochalen Wandel, der es notwendig macht, sich ständig selbst zu hinterfragen und sich weiterzuentwickeln. Die fortschreitenden Veränderungen in der Technologie und in der Gesellschaft haben die Bedingungen für beruflichen Erfolg sowie für den Erhalt der Employability komplexer werden lassen. Als Antwort darauf wurde die Diskussion in der Wissenschaft wesentlich von den Begriffen Kompetenz und Kompetenzentwicklung geprägt. So hat sich der Begriff der Kompetenz bis heute weitgehend in der deutschen Bildungslandschaft, in den Lehrplänen und in wissenschaftlichen Aufsätzen durchgesetzt. Dazu kommt, dass die Kompetenzentwicklung von vielen verschiedenen Seiten stark gefordert wird. Es geht beispielsweise um den Erwerb von interkultureller, von Selbstorganisations- oder auch von Medienkompetenz.
Das Individuum muss sich kontinuierlich mit der Analyse und der Weiterentwicklung seiner Kompetenzen auseinandersetzen, um sein Potenzial so weiterzubilden, dass seine Beschäftigungsfähigkeit erhalten bleibt und es beruflich erfolgreich agieren kann. Da Arbeit und Privatleben immer enger miteinander verbunden sind, werden sowohl beruflich als auch privat erworbene Kompetenzen für die persönliche berufliche Entwicklung relevant. So gewinnen neben formalisierten Bildungsprozessen immer mehr auch informell erworbene Kompetenzen an Bedeutung. Daraus resultiert, dass bisherige Prüfungsformen und Diagnoseverfahren zunehmend ungeeignet sind, die Ergebnisse dieser Prozesse zu identifizieren.
Das Angebot an Kompetenzanalysen wächst und wird zunehmend komplexer. Problematisch ist, dass es bisher an allgemein anerkannten Kriterien fehlt, anhand derer man Kompetenzanalyseverfahren einschätzen und bewerten kann. Daraus ergeben sich verschiedene Fragen: Sind die einschlägigen Kompetenzanalyseverfahren auch wirklich für die Praxis anwendbar? Könnte man zu ihrer Einschätzung die einschlägigen Qualitätsstandards verwenden? Erfassen sie wirklich das, was sie erfassen sollen, die Kompetenzen? Schließlich stellt sich die Frage, inwieweit Kompetenzanalyseverfahren auch den Merkmalen einer modernen betrieblichen Bildungsarbeit entsprechen und die Kompetenzentwicklung fördern können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Betrieblicher Wandel und seine Auswirkungen auf die betriebliche Bildungsarbeit
- 2.1 Einflussfaktoren und Entwicklungstrends
- 2.2 Begriffsbestimmungen
- 2.3 Das Ziel betrieblicher Bildungsarbeit
- 2.4 Zusammenfassung
- 3. Kategorien zur Einschätzung von Kompetenzanalyseverfahren
- 3.1 Die Kriterien der Qualitätssicherung
- 3.2 Die Gütekriterien der empirischen Sozialforschung
- 3.3 Zusammenfassung
- 4. Kompetenzanalysen zur persönlichen Entwicklung
- 4.1 Funktion und Anwendung von Kompetenzanalysen
- 4.2 Bedeutung für die betriebliche Bildungsarbeit
- 4.3 Exemplarische Verfahren der Kompetenzanalyse
- 4.4 Probleme des Profilings
- 4.5 Zusammenfassung
- 5. Beurteilung der Kriterien
- 5.1 Anwendung der Gütekriterien
- 5.2 Anwendung der Kriterien der Qualitätssicherung
- 5.3 Zusammenfassung der Kriterien und Bewertung der Verfahren
- 5.4 Einschätzung der Kriterien
- 5.5 Zusammenfassung
- 6. Fazit und Desiderate
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eignung von Gütekriterien der empirischen Sozialforschung und Kriterien der Qualitätssicherung zur Bewertung von Kompetenzanalyseverfahren im Hinblick auf die individuelle Kompetenzentwicklung. Sie zielt darauf ab, wissenschaftlich fundierte Kriterien für die Beurteilung solcher Verfahren zu entwickeln und der Praxis zur Verfügung zu stellen.
- Einfluss des betrieblichen Wandels auf die betriebliche Bildungsarbeit
- Definition und Bedeutung von Kompetenz und Kompetenzentwicklung
- Kriterien zur Bewertung von Kompetenzanalyseverfahren
- Anwendung der Gütekriterien und Qualitätskriterien auf ausgewählte Verfahren
- Entwicklung von Kriterien für eine wissenschaftlich fundierte Beurteilung von Kompetenzanalyseverfahren
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den epochalen Wandel in Betrieben und die damit verbundene Notwendigkeit der Kompetenzentwicklung. Sie führt den Begriff der Kompetenz und die Bedeutung informellen Lernens ein und stellt die zentrale Forschungsfrage: Ob die Gütekriterien der empirischen Sozialforschung und die Kriterien der Qualitätssicherung zur Bewertung von Kompetenzanalyseverfahren geeignet sind. Die Arbeit untersucht, ob diese Kriterien zur Beurteilung der Ausrichtung der Verfahren auf die individuelle Kompetenzentwicklung verwendet werden können und welche Kriterien am effektivsten sind. Die Einleitung legt den Grundstein für die gesamte Arbeit und formuliert die Forschungsfragen, die in den folgenden Kapiteln bearbeitet werden.
2. Betrieblicher Wandel und seine Auswirkungen auf die betriebliche Bildungsarbeit: Dieses Kapitel skizziert die grundlegenden Einflussfaktoren auf die betriebliche Bildungsarbeit, die zur Entwicklung einer Vielzahl von Kompetenzanalyseverfahren geführt haben. Es beleuchtet den Einfluss von technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen auf den beruflichen Erfolg und die Employability. Die Begriffe Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Qualifikation und Kompetenz werden definiert und abgegrenzt. Der Fokus liegt auf der Bedeutung informellen Lernens und der Notwendigkeit, auch informell erworbene Kompetenzen in der Bewertung zu berücksichtigen. Das Kapitel betont die Rolle der betrieblichen Bildungsarbeit bei der Förderung der Kompetenzentwicklung und die Unzulänglichkeit herkömmlicher Prüfungs- und Diagnoseverfahren.
3. Kategorien zur Einschätzung von Kompetenzanalyseverfahren: Dieses Kapitel stellt die Kriterien der Qualitätssicherung und die Gütekriterien der empirischen Sozialforschung vor, die als Grundlage für die Bewertung der Kompetenzanalyseverfahren dienen. Es beschreibt sowohl quantitative als auch qualitative Gütekriterien und analysiert ihre Anwendbarkeit auf den Kontext der Kompetenzanalyse. Der Abschnitt zeigt, wie diese Kriterien helfen können, die Qualität und die Validität der Verfahren zu beurteilen und deren Eignung für die Praxis zu überprüfen. Es dient als methodisches Fundament für die spätere Bewertung der Verfahren in Kapitel 5.
4. Kompetenzanalysen zur persönlichen Entwicklung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Funktion und Anwendung von Kompetenzanalysen für die persönliche Entwicklung im beruflichen Kontext. Es werden exemplarische Verfahren, wie der Kompetenzreflektor und der Talentkompass NRW, vorgestellt und analysiert. Die Bedeutung von Kompetenzanalysen für die betriebliche Bildungsarbeit wird herausgearbeitet. Zusätzlich werden Probleme des Profilings und mögliche Herausforderungen bei der Anwendung von Kompetenzanalysen diskutiert. Das Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den praktischen Aspekten der Kompetenzanalyse und ihren Anwendungsmöglichkeiten.
5. Beurteilung der Kriterien: In diesem Kapitel werden die in Kapitel 3 vorgestellten Kriterien auf die in Kapitel 4 beschriebenen Kompetenzanalyseverfahren angewendet. Eine detaillierte Bewertung der Verfahren auf Basis der Gütekriterien und Kriterien der Qualitätssicherung wird vorgenommen. Die Ergebnisse werden zusammengefasst und diskutiert, um Schlussfolgerungen über die Eignung der Kriterien und die Qualität der Verfahren zu ziehen. Der Schwerpunkt liegt auf der systematischen Anwendung der Kriterien und der Interpretation der Ergebnisse für die Praxis.
Schlüsselwörter
Kompetenz, Kompetenzentwicklung, Kompetenzanalyseverfahren, Gütekriterien, Qualitätssicherung, Betriebliche Bildungsarbeit, Informelles Lernen, Employability, Profiling, individuelle Kompetenzentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bewertung von Kompetenzanalyseverfahren im Hinblick auf die individuelle Kompetenzentwicklung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Eignung von Gütekriterien der empirischen Sozialforschung und Kriterien der Qualitätssicherung zur Bewertung von Kompetenzanalyseverfahren für die individuelle Kompetenzentwicklung. Ziel ist die Entwicklung und Bereitstellung wissenschaftlich fundierter Kriterien für die Beurteilung solcher Verfahren in der Praxis.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss des betrieblichen Wandels auf die betriebliche Bildungsarbeit, die Definition und Bedeutung von Kompetenz und Kompetenzentwicklung, Kriterien zur Bewertung von Kompetenzanalyseverfahren, die Anwendung von Gütekriterien und Qualitätskriterien auf ausgewählte Verfahren sowie die Entwicklung von Kriterien für eine wissenschaftlich fundierte Beurteilung von Kompetenzanalyseverfahren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Betrieblicher Wandel und seine Auswirkungen auf die betriebliche Bildungsarbeit, Kategorien zur Einschätzung von Kompetenzanalyseverfahren, Kompetenzanalysen zur persönlichen Entwicklung, Beurteilung der Kriterien und Fazit und Desiderate. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel ausführlich beschrieben.
Welche Verfahren werden exemplarisch betrachtet?
Die Arbeit betrachtet exemplarisch Verfahren wie den Kompetenzreflektor und den Talentkompass NRW, um die Anwendung der Gütekriterien und Qualitätskriterien zu veranschaulichen. Die Auswahl ist jedoch nicht erschöpfend.
Welche Kriterien werden zur Bewertung herangezogen?
Die Arbeit nutzt Gütekriterien der empirischen Sozialforschung und Kriterien der Qualitätssicherung zur Bewertung der Kompetenzanalyseverfahren. Diese Kriterien werden detailliert in Kapitel 3 vorgestellt und in Kapitel 5 angewendet.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit und die Desiderate (Kapitel 6) fassen die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und benennen offene Fragen und Forschungsbedarf. Eine konkrete Zusammenfassung des Fazits wird in diesem FAQ nicht gegeben, da es sich um eine zentrale Erkenntnis der Arbeit handelt, welche im Volltext nachgelesen werden sollte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter, die die Arbeit beschreiben, sind: Kompetenz, Kompetenzentwicklung, Kompetenzanalyseverfahren, Gütekriterien, Qualitätssicherung, Betriebliche Bildungsarbeit, Informelles Lernen, Employability, Profiling, individuelle Kompetenzentwicklung.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln finden Sie in der Zusammenfassung der Kapitel, die einen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels bietet.
Wofür ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit Kompetenzentwicklung, betrieblicher Bildungsarbeit und der Bewertung von Kompetenzanalyseverfahren beschäftigen, insbesondere für Wissenschaftler, Praktiker in der Personalentwicklung und Weiterbildung, sowie für Studierende in den entsprechenden Fachbereichen.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Sind die Gütekriterien der empirischen Sozialforschung und die Kriterien der Qualitätssicherung geeignet, um Kompetenzanalyseverfahren im Hinblick auf ihre Ausrichtung auf die individuelle Kompetenzentwicklung zu bewerten?
- Citation du texte
- Stefan Kuhles (Auteur), 2007, Bewertung von Kompetenzanalyseverfahren unter Zugrundelegung der Kriterien der Qualitätssicherung und der Gütekriterien der empirischen Sozialforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87496