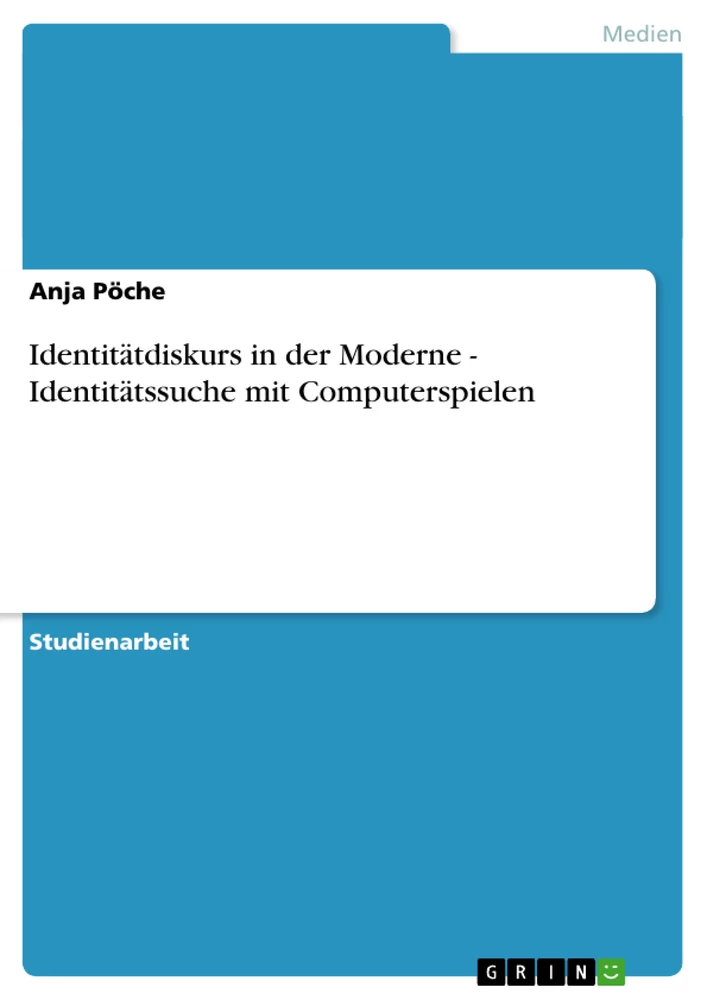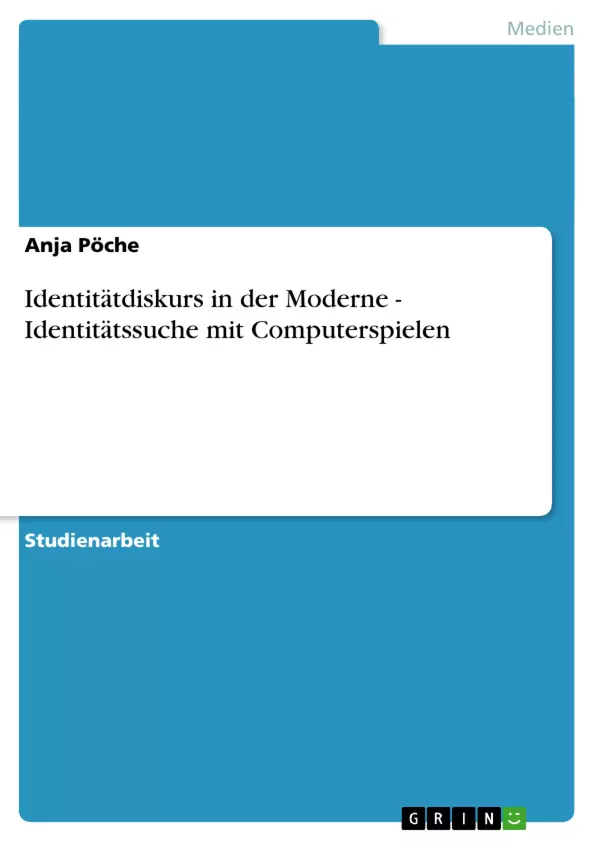Durch Edmund Runggaldier wird die Frage aufgestellt, ob es überhaupt möglich ist, dass es Identität durch die Zeit ( diachrone Identität ) gibt. Wäre es zum Beispiel sinnvoll anzunehmen, dass das auf dem Foto abgebildete Baby derselbe Mensch ist der er heute ist? Feststellbar ist, dass die Unterschiede enorm sind. Wie soll mit Menschen umgegangen werden, die ihren Charakter, ihre Überzeugungen und Einstellungen im Laufe der Zeit verändert haben durch die Einwirkung einer Sekte oder einer fremden Kultur zum Beispiel? Ist es noch möglich zu behaupten, dass diese Personen noch dieselben sind?
Wie schwierig es ist sich mit dem Begriff der Identität auseinanderzusetzen wird schon anhand dieser kurzen Aussage ersichtlich. Aus diesem Grund möchte ich zuerst eine Definition zum Identitätsbegriff anführen. Das lateinische Demonstrativpronomen „indem“ liegt dem benutzten Begriff „Identität“ zugrunde. Dieses bedeutet soviel wie „eben der“ oder „ein und derselbe“. Der Gesellschaft ist es mit Hilfe des Begriffs „Identität“ möglich, die Unterscheidung von Personen über die aktuelle Wahrnehmung hinaus vorzunehmen und diese Person in einem Zeitkontinuum von der Vergangenheit bis in die Zukunft hinein zu verankern. Aber auch mit dieser Aussage stößt man auf Widersprüchlichkeiten in Bezug zu der oben angeführten Aussage.
Nach Anthony Giddens ist die Identität die Narration des Selbst über sich. Wobei die Narration als ein fortlaufender Prozess der reflexiven Deutung des Selbst verstanden werden muss. Solche Überlegungen sind gewiss nicht neu. Ihre spezifische Bedeutungsdimension haben sie jedoch erst in der Spät – bzw. Postmoderne entfaltet. Die reflexiven Anstrengungen des oder der Einzelnen bei der Identitätsartikulation haben mit der Ausdifferenzierung verschiedener Lebensstile und –formen beziehungsweise der damit verbundenen Entstandardisierung von Lebensläufen zugenommen.
Zwar ist der Ausdruck „Postmodern“ erstmals schon vor einhundert Jahren begegnet, jedoch ist er zum Leitbegriff einer Debatte erst 1959/ 60 in den USA geworden. Ihren Ausgang nahm dort die weltweite Debatte um Moderne und Postmoderne.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Vorwort - Auseinandersetzung mit der Identität
- 1. Einführung in die Identitätsproblematik von Computerspielen
- 2. Reale Welt versus virtuelle Welt
- 3. Allgemeine Beschaffenheit von Computerspielen
- 3.1. Erster Blickkontakt
- 3.2. Wesen der Computerspiele
- 4. Die unterschiedlichen Dispositionen von Computerspielen
- 4.1. Denkspiele
- 4.2. Actionspiele
- 4.3. Spielgeschichten
- 5. Gründe für die Zuwendung zu Computerspielen
- 6. Wirkung von Computerspielen
- 6.1. Transferprozesse beim Computerspiel
- 6.1.1. Mögliche Formen des Transfers
- 6.1.2. Spielfigur als Marionette
- 6.2. Analysebeispiel des Computerspiels „Legacy of Time“
- 6.2.1. Warum es geht
- 6.2.2. Äußere Merkmale des Spiels
- 6.2.3. Spielqualität
- 6.2.4. Wirkung des Spiels
- 6.1. Transferprozesse beim Computerspiel
- 7. Schlussgedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und wie Computerspiele zur Entwicklung und Gestaltung der Identität beitragen können. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Transferprozessen, die beim Spielen von Computerspielen stattfinden, und deren Auswirkungen auf die Spieler.
- Der Einfluss von Computerspielen auf die Identität
- Transferprozesse zwischen Spielwelt und realer Welt
- Das Verhältnis von virtueller Identität und realer Identität
- Die Rolle von Computerspielen als Identitätsfindungsmedium
- Die Bedeutung von Computerspielen in der Postmoderne
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort beleuchtet die Problematik des Identitätsbegriffs und führt in die Thematik ein. In Kapitel 1 wird die Identitätsproblematik im Kontext von Computerspielen betrachtet. Kapitel 2 setzt sich mit der Frage auseinander, wie sich die reale Welt von der virtuellen Welt unterscheidet. Die allgemeine Beschaffenheit von Computerspielen wird in Kapitel 3 behandelt, wobei sowohl der erste Blickkontakt als auch das Wesen von Computerspielen beleuchtet werden. Kapitel 4 widmet sich den verschiedenen Spieltypen und deren Auswirkungen auf die Spieler. In Kapitel 5 werden Gründe für die Zuwendung zu Computerspielen analysiert. Kapitel 6 befasst sich mit der Wirkung von Computerspielen, wobei Transferprozesse und deren Formen, die Spielfigur als Marionette und das Analysebeispiel des Computerspiels „Legacy of Time“ im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Computerspiele, Identität, Medienidentität, virtuelle Welt, reale Welt, Transferprozesse, Spielfigur, „Legacy of Time“, Postmoderne.
Häufig gestellte Fragen
Was ist diachrone Identität?
Diachrone Identität bezeichnet die Beständigkeit einer Person über die Zeit hinweg, trotz körperlicher oder charakterlicher Veränderungen.
Wie beeinflussen Computerspiele die Identitätsbildung?
Durch Transferprozesse zwischen der virtuellen und realen Welt können Spieler verschiedene Rollen erproben und Aspekte ihrer Identität reflektieren oder verändern.
Was ist der Unterschied zwischen realer und virtueller Identität?
Die virtuelle Identität wird oft durch Avatare oder Spielfiguren (als „Marionetten“) ausgedrückt, während die reale Identität die Narration des Selbst im Alltag beschreibt.
Warum spielen Menschen Computerspiele in der Postmoderne?
In einer Welt mit entstandardisierten Lebensläufen bieten Spiele Räume für neue Lebensstile und die reflexive Deutung des Selbst.
Welches Spiel dient als Analysebeispiel?
Die Arbeit untersucht das Spiel „Legacy of Time“ hinsichtlich seiner Wirkung auf die Spieler und seiner Qualität als Identitätsmedium.
- Citation du texte
- Anja Pöche (Auteur), 2006, Identitätdiskurs in der Moderne - Identitätssuche mit Computerspielen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87531