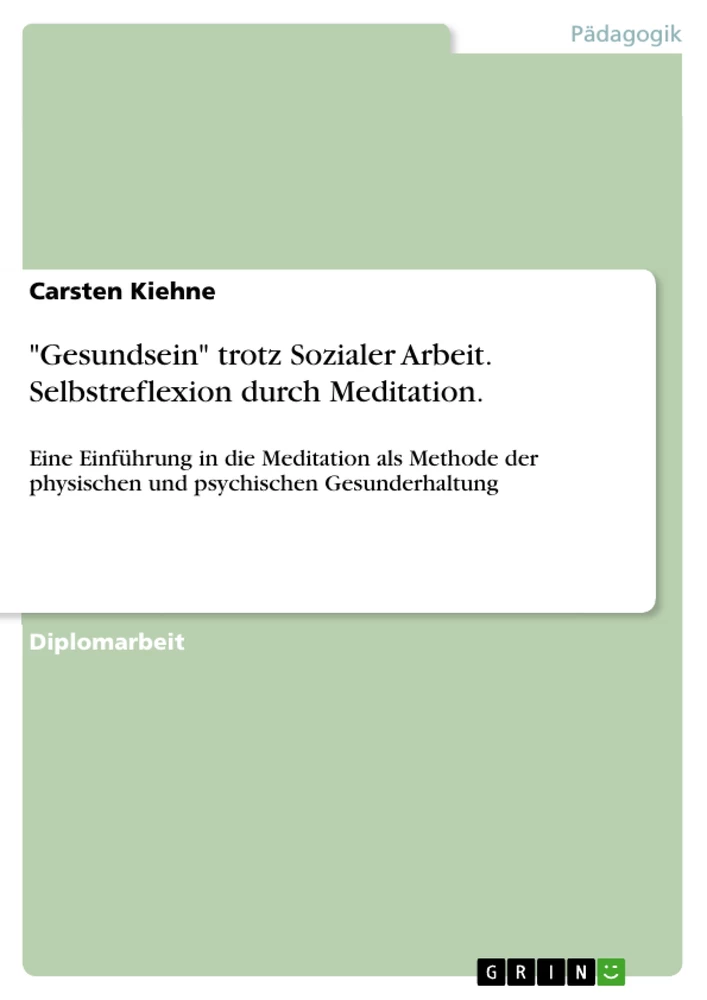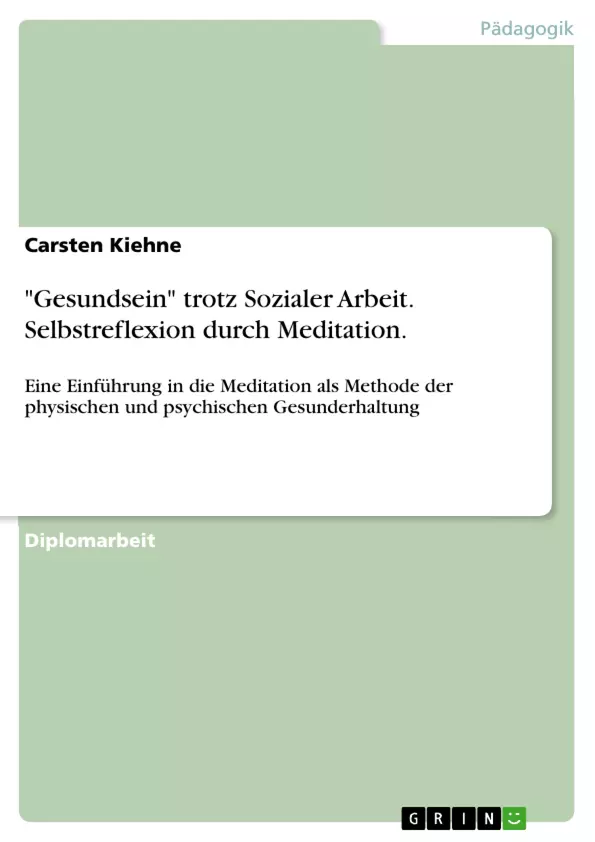„In allen sozialen Berufen ist die eigene Persönlichkeit das wichtigste Instrument; die Grenzen ihrer Belastbarkeit und Flexibilität sind zugleich die Grenzen unseres Handelns.“ (Schmidbauer 2005, S.7)
Aber, wie belastbar und flexibel sind denn die Helfer im Allgemeinen?
In den Einrichtungen, in denen ich bisher tätig war, schienen viele Sozialarbeiter, eben diese Kriterien nicht über einen längeren Zeitraum gewährleisten zu können. Oftmals wirkten sie, nach einem kurzen enthusiastischen und idealistisch motivierten Einstieg, sehr belastet und ließen von ihrem übersprudelnden, kreativen Potential und Tatendrang missmutig ab, um lediglich noch „Dienst nach Vorschrift“ zu verrichten. In Fachkreisen nennt sich dieses Phänomen „Burnout-Syndrom.
Mit meinen Erfahrungen stehe ich „leider“ keineswegs alleine, und zugegebenermaßen erschrocken, da: „Dass es um die seelische Gesundheit bei den Angehörigen der helfenden Berufe nicht sonderlich gut bestellt ist erweisen einige statistische Studien. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in keiner Berufsgruppe (psychische) Störungen so sehr vertuscht und bagatellisiert werden wie in der, die unmittelbar mit der Behandlung dieser Störungen befasst ist.“ (zit. ebd., S.16)
In meiner Diplomarbeit: „Gesundsein“ trotz Sozialer Arbeit – Selbstreflexion durch Meditation, möchte ich mich also mit dem Thema beschäftigen, weshalb gerade die Helfer in Sozialer Arbeit, im Vergleich zu anderen Berufsgruppen überdimensional häufig von seelischen Erkrankungen betroffen sind. In diesem Sinne möchte ich die Frage beantworten, ob eher personelle Schwächen („Helfersyndrom“) oder eher die aufreibende Tätigkeit der Sozialarbeiter für Erkrankungen, wie dem Burnout-Syndrom und der Psychogenen Depression zur Verantwortung zu ziehen sind. Des Weiteren ist es mir ein Anliegen, zu ergründen, welche individuellen Auswege existieren, um diesen Störungen vorzubeugen. Es geht mir in diesem Rahmen also nicht um die Klienten Sozialer Arbeit, sondern um die Helfer selbst. Ferner ist für mich weniger bedeutsam, welche äußeren Arbeitsbedingungen von sozialen Institutionen zur Gesunderhaltung ihrer Beschäftigten verändert werden können. Für mich ist entscheidend, welche Möglichkeiten der Sozialarbeiter im strukturellen Gefüge der Institution hat, für sich selbst Sorge zu tragen, um ungeachtet auch ungünstiger Vorraussetzungen (trotz Sozialer Arbeit), gesund, belastbar und flexibel zu bleiben sowie an Selbsterfahrung zu gewinnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Vorwort
- 1.2. Planung, Durchführung und Evaluation des Fragebogens
- 2. Sind Helfer das einzige Problem in der Sozialen Arbeit?
- 2.1. Was ist soziale Arbeit?
- 2.1.1. Begrifflichkeit und Zielsetzung
- 2.1.2. Spezifische Merkmale
- 2.1.3. Methoden Sozialer Arbeit
- 2.2. Die hilflosen Sozialarbeiter
- 2.2.1. Bedeutung des Helfens
- 2.2.2. Helferpersönlichkeit
- 2.2.3. Handlungskompetenz in der Sozialen Arbeit
- 2.2.4. Helfersyndrom oder „Wie gestört ...? ”
- 2.3. Problemlagen des „, unmöglichen Berufes”
- 2.3.1. Belastungen durch Institution und Arbeitsfeld
- 2.3.2. Belastungen im Team
- 2.3.3. Belastungen durch Klienten
- 2.3.4. Selbstbelastungen
- 2.1. Was ist soziale Arbeit?
- 3. Von Krankheit, Gesundheit und „,Gesundsein”
- 3.1. Bedeutung von Krankheit
- 3.1.1. Begriffsdeutung
- 3.1.2. Abgrenzung von Befindlichkeitsstörungen
- 3.1.3. Macht Krankheit Sinn?
- 3.2. Krankheitsstatus der befragten Sozialarbeiter
- 3.3. Exkurs in typische Störungsbilder der Helfer in Sozialer Arbeit
- 3.3.1. Psychogene Depression
- 3.3.1.1. Abgrenzung
- 3.3.1.2. Begriffsbestimmung „Depression”
- 3.3.1.3. Epidemiologie
- 3.3.1.4. Symptomatik
- 3.3.1.5. Erklärungsansätze
- 3.3.1.5.1. Die psychoanalytische Ansicht
- 3.3.1.5.2. Theorie der erlernten Hilflosigkeit
- 3.3.1.5.3. Kognitive Theorie von Beck
- 3.3.1.5.4. Die Lerntheorie
- 3.3.1.5.5. Humanistische Theorien
- 3.3.1.5.6. Persönlichkeitszentrierte Ansätze
- 3.3.1.5.7. Lebensereignisse als Auslöser
- 3.3.1.5.8. Multifaktorieller Ansatz
- 3.3.1.6. Möglichkeiten der Intervention und Behandlung
- 3.3.1.6.1. Psychotherapie
- 3.3.1.6.2. Pharmakotherapie
- 3.3.1.6.3. Soziotherapie
- 3.3.1.6.4. Physiotherapie
- 3.3.1.6.5. Ergänzende Therapien
- 3.3.2. Burnoutsyndrom
- 3.3.2.1. Begriffsdeutung
- 3.3.2.2. Symptome
- 3.3.2.3. Burnout als Prozess
- 3.3.2.4. Epidemiologie
- 3.3.2.5. Erklärungsansätze
- 3.3.2.5.1. Persönlichkeitszentrierte Ansätze
- 3.3.2.5.2. Sozial-, arbeits- und organisationsbezogene ...
- 3.3.2.5.3. Gegenseitiges Bedingen und das S-O-R-Schema
- 3.3.2.6. Bewältigungsstrategien
- 3.3.2.6.1. Möglichkeiten auf institutioneller Ebene
- 3.3.2.6.2. Möglichkeiten auf personeller Ebene
- 3.3.1. Psychogene Depression
- 3.4. Gesundheit und „,Gesundsein”
- 3.4.1. Bedeutung von Gesundheit
- 3.4.1.1. Subjektive Gesundheitskonzepte
- 3.4.1.2. Wissenschaftliche Gesundheitskonzepte
- 3.4.1.2.1. Gesundheitsbegriff der WHO
- 3.4.1.2.2. Gesundheitsmodell der Salutogenese
- 3.4.2. Gesundheitsarbeit
- 3.4.2.1. Gesundheitsförderung und Prävention
- 3.4.2.2. Auf der Suche nach Faktoren der Resilienz
- 3.4.2.3. Gesundheitsfördernde Maßnahmen in der Sozialen Arbeit
- 3.4.3. „Gesundsein” als Weg und Ziel
- 3.4.1. Bedeutung von Gesundheit
- 3.1. Bedeutung von Krankheit
- 4. Selbstreflexion
- 4.1. Das Selbst und die Reflexion
- 4.1.1. Wahres Selbst und Selbstbild
- 4.1.2. Selbstreflexion
- 4.2. Weshalb selbstreflexives Arbeiten?
- 4.3. Wie kann ich mich selbst reflektieren?
- 4.3.1. Die Arbeit am Gewahrsein oder „Bewusstheit im Alltag”
- 4.3.2. Bewusstseinserweiternde Verfahren und Techniken
- 4.3.2.1. Psychotherapie
- 4.3.2.2. Entspannungstechniken
- 4.3.2.3. Tagebuch und Traumdeutung
- 4.3.2.4. Gebete
- 4.3.2.5. Askese
- 4.1. Das Selbst und die Reflexion
- 5. Meditation
- 5.1. Was ist Meditation?
- 5.1.1. Meditative Stimmungen
- 5.1.2. Meditation als Methode
- 5.2. Die Arbeitsweise in der Meditation
- 5.2.1. Meditationsfördernde Bedingungen
- 5.2.1.1. Äußere Faktoren
- 5.2.1.2. Die richtige Meditationszeit
- 5.2.1.3. Meditationsritual
- 5.2.1.4. Die innere Haltung
- 5.2.1.4.1. Wesenszüge und innere Einstellung
- 5.2.1.4.2. Der ethische Unterbau
- 5.2.1.5. Die äußere Haltung
- 5.2.2. Meditationshemmende Bedingungen
- 5.2.1. Meditationsfördernde Bedingungen
- 5.3. Wirkungsweise der Meditation
- 5.3.1. Meditation und körperlich-geistige Gesundheit
- 5.3.2. Meditation und seelische Gesundheit
- 5.4. Meditationsformen
- 5.4.1. Grundlegende Stile
- 5.4.1.1. Informelle Meditation oder Achtsamkeit
- 5.4.1.2. Formelle Meditation
- 5.4.2. Eine Methode genügt!
- 5.4.3. Ausgewählte Meditationsmethoden des Buddhismus
- 5.4.3.1. Vergegenwärtigung des Atems
- 5.4.3.2. Metta - Meditation
- 5.4.3.3. Vipassana - Meditation
- 5.4.1. Grundlegende Stile
- 5.1. Was ist Meditation?
- 6. Abschluss
- 6.1. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch „,Gesundsein‘ trotz Sozialer Arbeit - Selbstreflexion durch Meditation“ analysiert die Belastungen und Herausforderungen, denen Sozialarbeiter im Berufsalltag begegnen, und stellt die Meditation als effektive Methode der physischen, psychischen und seelischen Gesunderhaltung vor.
- Die besonderen Belastungen und Herausforderungen des Berufsbildes Sozialer Arbeit.
- Die Bedeutung von Gesundheit und „Gesundsein“ für Sozialarbeiter.
- Die Relevanz von Selbstreflexion und Bewusstseinsentwicklung.
- Die Meditation als Methode zur Stressbewältigung und Förderung des Wohlbefindens.
- Verschiedene Meditationsformen und ihre Anwendungsmöglichkeiten.
Zusammenfassung der Kapitel
Das Buch beginnt mit einer Einleitung, die die Motivation und Zielsetzung des Projekts sowie die Methodik der durchgeführten Studie erläutert. Im zweiten Kapitel wird die soziale Arbeit aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, wobei die spezifischen Belastungen und Problemlagen des Berufsfeldes im Mittelpunkt stehen.
Im dritten Kapitel werden die Themen Krankheit, Gesundheit und „Gesundsein“ beleuchtet, wobei die Bedeutung von Krankheit und die Abgrenzung zu Befindlichkeitsstörungen erläutert werden. Zudem werden typische Störungsbilder wie Depression und Burnout im Kontext der Sozialen Arbeit vorgestellt.
Kapitel 4 widmet sich dem Thema Selbstreflexion, wobei die Bedeutung von Selbstreflexion und verschiedene Methoden der Selbstreflexion erläutert werden.
Schließlich widmet sich das Buch im fünften Kapitel der Meditation. Es werden verschiedene Meditationsformen und ihre Wirkung auf die körperlich-geistige und seelische Gesundheit beschrieben.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, Belastungen, Herausforderungen, Helfersyndrom, „Gesundsein“, Krankheit, Gesundheit, Selbstreflexion, Bewusstseinserweiterung, Meditation, Stressbewältigung, Wohlbefinden.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Sozialarbeiter besonders anfällig für Burnout?
Die Arbeit analysiert, ob personelle Schwächen (Helfersyndrom) oder die hohen emotionalen Belastungen durch Institutionen und Klienten für die Erschöpfung verantwortlich sind.
Was ist das "Helfersyndrom"?
Es beschreibt eine Persönlichkeitsstruktur, bei der das eigene Selbstwertgefühl fast ausschließlich aus der Hilfe für andere bezogen wird, was oft zur Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse führt.
Wie kann Meditation Sozialarbeitern helfen?
Meditation dient als Methode der Selbstreflexion und Psychohygiene, um trotz schwieriger Arbeitsbedingungen gesund, belastbar und flexibel zu bleiben.
Welche Meditationsformen werden im Buch empfohlen?
Es werden buddhistische Techniken wie die Vergegenwärtigung des Atems, die Metta-Meditation (Liebende Güte) und die Vipassana-Meditation (Einsicht) vorgestellt.
Was ist der Unterschied zwischen formeller und informeller Meditation?
Formelle Meditation findet in einer festen Sitzhaltung statt, während informelle Meditation Achtsamkeit in alltäglichen Handlungen bedeutet.
- Quote paper
- Dipl. Sozialarbeiter/Sozialpädagoge Carsten Kiehne (Author), 2007, "Gesundsein" trotz Sozialer Arbeit. Selbstreflexion durch Meditation., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87577