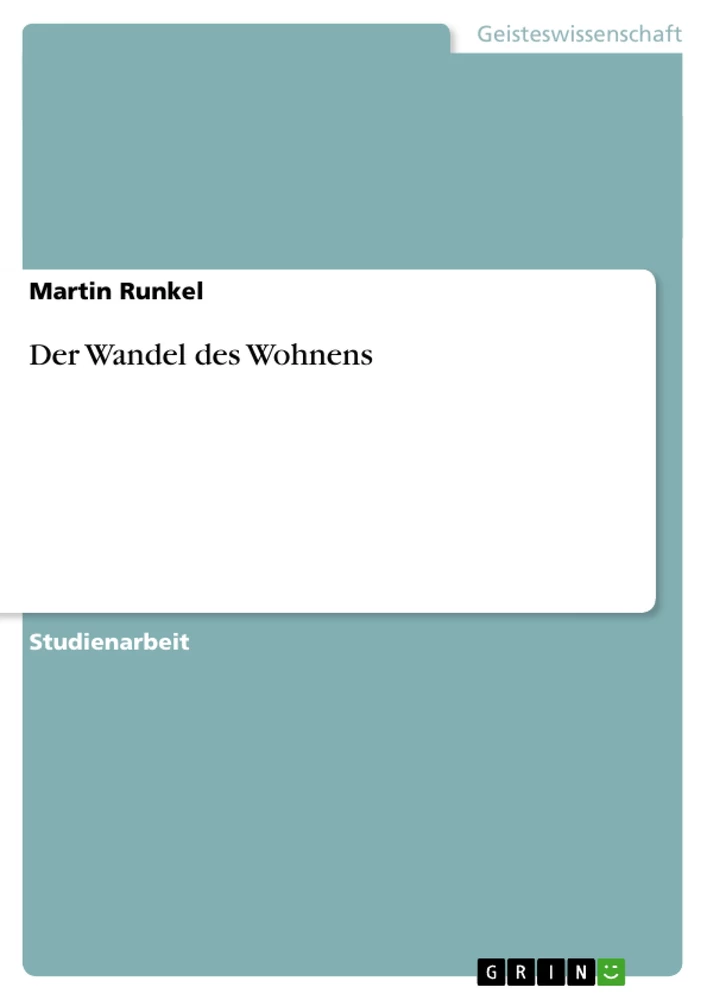,,Zeige mir wie Du wohnst, und ich sage Dir, wer Du bist". Dieses Sprichwort könnte als Motto vor einer rein soziologischen Analyse des Wohnens und der Wohnung stehen, kann doch, im Sinne Norbert Elias′, ,,der Niederschlag einer sozialen Einheit im Raume, der Typus ihrer Raumgestaltung eine handgreifliche, eine - im wörtlichen Sinne - sichtbare Repräsenta-tion ihrer Eigenart" sein. Die Beschreibung des Wohnens der Gesellschaft ließe demnach Rückschlüsse auf die gesellschaftliche Organisation zu, über die Verteilung des Reichtums, über den Grad der Urbanisierung, über familiäre Strukturen und viele andere, ähnlich dispara-te Themenbereiche.
Wohnen ist ein existentielles Grundbedürfnis des Menschen und in einem ständigen Wandel. Als eine mögliche Definition sei folgende angeführt: ,,Wohnen als elementare Erscheinungs- und Ausdrucksform menschlichen Seins umfasst alle die Tätigkeiten und Verhaltensweisen, die regelmäßig an einem bestimmten Ort stattfinden" . Die Wohnung, das "Dach über dem Kopf", hat zunächst sowohl physische, als auch soziale und sozialpsychologische Schutzfunk-tion: vor Witterungseinflüssen, vor Gefahren aller Art, vor Mitmenschen - gleichgültig ob Freund oder Feind, vor neugierigen Blicken usw. Doch gerade dieser Aspekt des Wohnens als Grundbedürfnis kann nicht im Zentrum einer soziologischen Analyse stehen, vermag er doch die historischen, interkulturellen und innergesellschaftlichen Differenzen der Wohnweisen der Menschen eben nicht zu erklären, sondern verweist lediglich darauf, dass alle Menschen wohnen, was banal ist. Eine Analyse, die sich auf neuartige Tendenzen in Wohn- und Le-bensweise bezieht, muss daher die historischen Bedingungen der jeweiligen Gesellschaften notwendig mit einbinden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Herausbildung modernen Wohn- und Lebensweise...
- Das vormoderne „ganze Haus“.
- Das moderne Wohnen.
- 2. Wohnen und Arbeiten.
- 3. Individualisierung im Privaten
- 4. Neue Haustypen.....
- Single und Einpersonenhaushalte
- Nichteheliche Lebensgemeinschaften.
- Alleinerziehende
- Wohngemeinschaften.
- 5. Zwischen Bindungslosigkeit und Differenzierung .
- 6. Politisch-soziologische Konsequenzen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Wandel des Wohnens zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Der Fokus liegt dabei auf der soziologischen Perspektive, wobei auch die ökonomischen und demographischen Bedingungen des Wohnens berücksichtigt werden.
- Historische Entwicklung des Wohnens
- Sozialer, politischer und ökonomischer Wandel der Wohnweisen
- Neue Wohntypen und -weisen
- Politische Konsequenzen aus den aufgezeigten Befunden
- Zusammenhang zwischen Wohnen und der räumlichen Einbindung der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Hausarbeit beginnt mit einer kurzen Beschreibung der historischen Entwicklung des Wohnens, wobei das „ganze Haus“ des vormodernen Zeitalters und das moderne Wohnen im Fokus stehen. Im Anschluss werden die Zusammenhänge zwischen Wohnen und Arbeiten beleuchtet. Es wird die Individualisierung im Privaten und die damit verbundene Entwicklung neuer Haustypen untersucht, darunter Single- und Einpersonenhaushalte, nichteheliche Lebensgemeinschaften, alleinerziehende und Wohngemeinschaften. Das Kapitel 5 befasst sich mit der Entwicklung zwischen Bindungslosigkeit und Differenzierung. Die Arbeit schließt mit einer Analyse der politisch-soziologischen Konsequenzen des Wandels des Wohnens.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Wohnen, Wohnformen, Wohnwandel, Individualisierung, Sozialisation, Stadtentwicklung, demographischer Wandel, ökonomische und politische Bedingungen des Wohnens, Sozialpolitik, Marktversagen und politische Konsequenzen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird „Wohnen“ soziologisch definiert?
Wohnen umfasst alle Tätigkeiten und Verhaltensweisen, die regelmäßig an einem Ort stattfinden, und gilt als sichtbare Repräsentation gesellschaftlicher Organisation.
Was war das vormoderne Konzept des „ganzen Hauses“?
Im vormodernen Zeitalter waren Wohnen und Arbeiten räumlich nicht getrennt; das Haus war eine ökonomische und soziale Einheit für alle Bewohner.
Welche neuen Haustypen sind im 21. Jahrhundert entstanden?
Dazu zählen Single- und Einpersonenhaushalte, nichteheliche Lebensgemeinschaften, Alleinerziehende sowie Wohngemeinschaften (WGs).
Was bedeutet „Individualisierung im Privaten“ für das Wohnen?
Es beschreibt den Trend zu differenzierteren Lebensstilen und Wohnformen, die stärker auf die Bedürfnisse des Einzelnen statt auf traditionelle Familienstrukturen zugeschnitten sind.
Welche politisch-soziologischen Konsequenzen hat der Wandel des Wohnens?
Die Arbeit diskutiert Konsequenzen für die Stadtentwicklung, Sozialpolitik und die Herausforderungen durch Marktversagen im Wohnungssektor.
- Quote paper
- Martin Runkel (Author), 2002, Der Wandel des Wohnens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8767