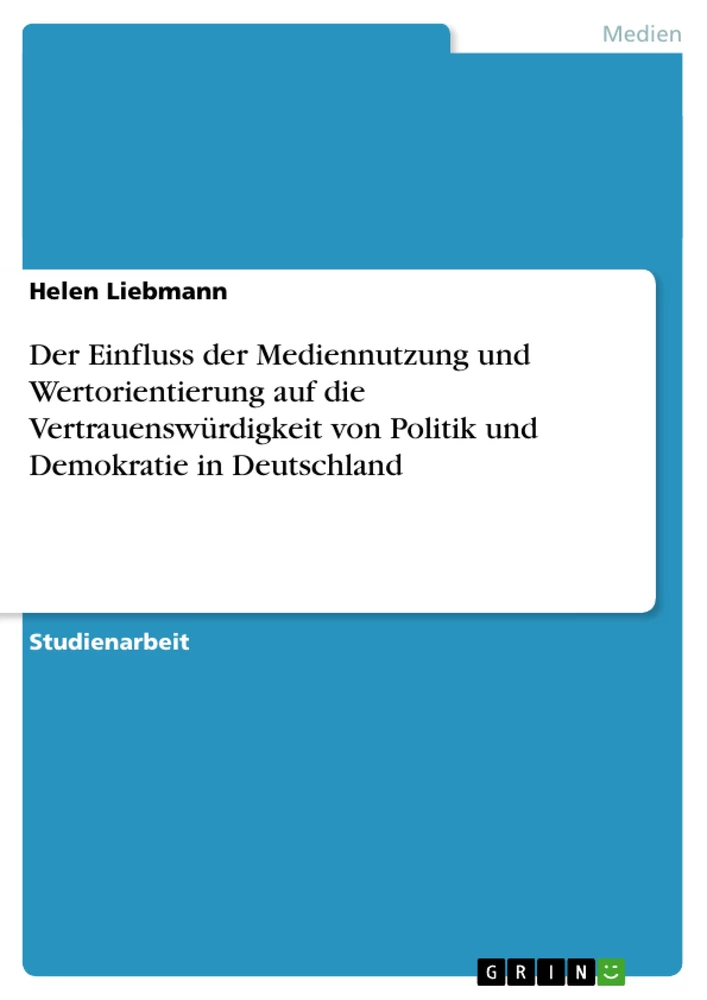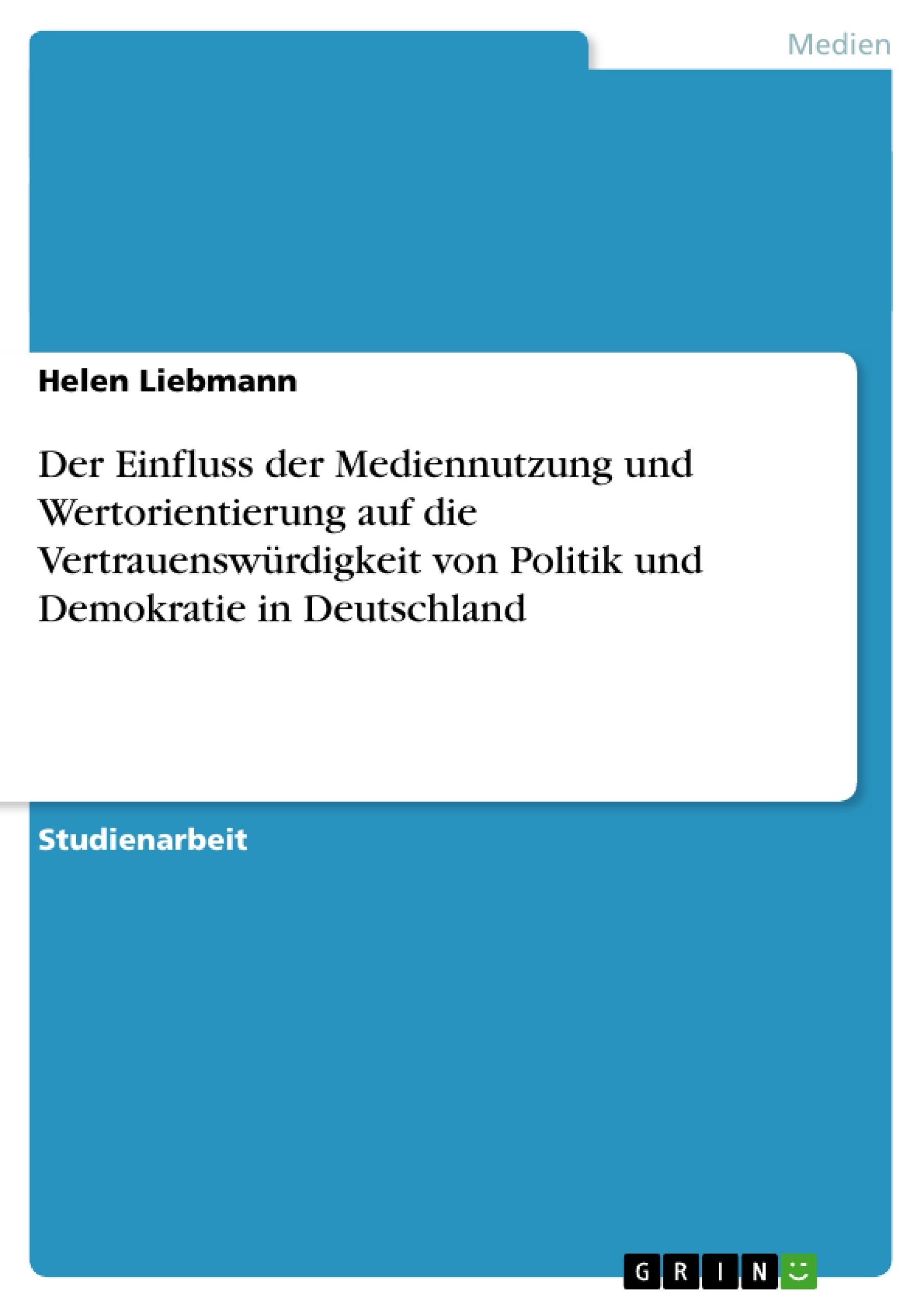Medien bieten „[…] Möglichkeiten der Einflussnahme auf Wissen, Einstellungen, Verhalten und Entscheiden von Menschen durch Kommunikation."
Kommunikation erzeugt Wirkungen beim Individuum (Stimulus-Response-Modell) und hat somit Funktionen für die Gesellschaft. In einer Massendemokratie ist politische Kommunikation zum größten Teil medienvermittelt. Regierung und Parteien verfügen nicht über eigene Medien und kommunizieren selbst mit ihren Mitgliedern zum großen Teil über Massenmedien. Diese wählen einen winzigen Ausschnitt
der Wirklichkeit aus und stellen diesen in spezifischer Weise dar. Somit prägen Massenmedien das Bild, das Politiker und Bürger von der Politik haben. Politik und Medien stehen daher in einem Spannungsverhältnis.
Einerseits benutzt, beobachtet und beeinflusst Politik die Medien andererseits prägen diese wiederum das öffentliche Bild von Politik durch ihre Art der Präsentation. Sie personalisieren, visualisieren und
veranschaulichen politische Entscheidungen, welche in Demokratien der Zustimmung und des Vertrauens der Bürger bedürfen.
Die vorliegende Forschung soll Unterschiede in der Printmediennutzung zur politischen Informationsbeschaffung von Männern und Frauen aufzeigen. Des Weiteren soll herausgefunden werden, ob die Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit von politischen Akteuren mit steigender
Mediennutzung sinkt und ob es einen Zusammenhang zwischen dem Bildungsabschluss eines Menschen und seiner Selbsteinschätzung im Bezug auf Einflussmöglichkeiten die Politik betreffend gibt.
Die Daten der Untersuchung aus einer mehrstufigen Zufallsstichprobe wurden mittels einer Katibefragung und einem dafür angefertigten Fragebogen im Jahr 2003 in der Bundesrepublik Deutschland erhoben. Der
Katifragebogen setzt sich aus drei Teilen zusammen. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Mediennutzung von TV und Print im Allgemeinen sowie im Bezug auf die politische Informationsbeschaffung der Befragten.
Der zweite Teil des Fragebogens beinhaltet Fragen zu Vertrauen und Wertorientierungen gegenüber politischen Institutionen, politischen Akteuren und der Demokratie in Deutschland. Der dritte Teil der Katibefragung untersucht die allgemeine Internetnutzung der Teilnehmer.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung und Hypothesen
- Deskription der Daten
- Kennwerte der Variablen der Hypothese
- Kennwerte der Unterscheidungshypothese (Hypothese 1)
- Kennwerte der Zusammenhangshypothese (Hypothese 2)
- Kennwerte der gerichteten Hypothese (Hypothese 3)
- Ergebnisse zur Wertorientierung
- Ausprägungen der Wertorientierung
- Printmediennutzung der Typen
- Kennwerte der Variablen der Hypothese
- Ergebnisse der Hypothesen
- Ergebnis der Unterscheidungshypothese
- Ergebnis der Zusammenhangshypothese
- Ergebnis der gerichteten Hypothese
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Forschungsbericht analysiert den Einfluss der Mediennutzung und Wertorientierung auf die Vertrauenswürdigkeit von Politik und Demokratie in Deutschland. Dabei stehen insbesondere die Nutzung von Printmedien für politische Informationen, die Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit politischer Akteure und die Rolle von Wertorientierungen im Kontext der Mediennutzung im Fokus.
- Untersuchung der Unterschiede in der Printmediennutzung für politische Informationen zwischen Männern und Frauen.
- Beurteilung der Hypothese, ob die Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit politischer Akteure mit steigender Mediennutzung sinkt.
- Analyse des Zusammenhangs zwischen Bildungsabschluss und Selbsteinschätzung im Bezug auf Einflussmöglichkeiten in der Politik.
- Bedeutung der Mediennutzung für Demokratie und Politik im Kontext funktionalistischer Systemtheorien.
- Analyse der Rolle der Medien in der politischen Kommunikation und die Herausforderungen, die sich aus dem Spannungsverhältnis zwischen Politik und Medien ergeben.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Mediennutzung für Demokratie und Politik, indem sie die Funktion der Medien als Leistungssysteme der Öffentlichkeit und die Spannungen zwischen Politik und Medien diskutiert. Kapitel 2 präsentiert die Fragestellung der Forschung und formuliert die Hypothesen, die im Verlauf der Untersuchung geprüft werden sollen. Kapitel 3 beschreibt die verwendeten Daten, analysiert die Kennwerte der Variablen und beleuchtet die Ergebnisse zur Wertorientierung und Printmediennutzung. Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Hypothesen, indem es die Ergebnisse der Unterscheidungshypothese, der Zusammenhangshypothese und der gerichteten Hypothese diskutiert.
Schlüsselwörter
Mediennutzung, politische Informationsbeschaffung, Wertorientierung, Vertrauenswürdigkeit, Demokratie, Politik, Printmedien, Tageszeitung, Geschlecht, Bildungsabschluss, politische Entfremdung, Videomalaise-Theorie, politische Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Mediennutzung das Vertrauen in die Politik?
Die Forschung untersucht, ob die Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit politischer Akteure mit steigender Mediennutzung sinkt, da Medien oft ein kritisches oder personalisiertes Bild vermitteln.
Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei der Mediennutzung?
Ja, die Untersuchung zeigt spezifische Unterschiede in der Nutzung von Printmedien zur politischen Informationsbeschaffung zwischen den Geschlechtern auf.
Was besagt die „Videomalaise-Theorie“?
Die Theorie postuliert, dass ein hoher Konsum von Fernsehnachrichten zu politischer Entfremdung, Zynismus und einem sinkenden Vertrauen in demokratische Institutionen führen kann.
Welchen Einfluss hat der Bildungsabschluss auf das politische Selbstverständnis?
Die Studie analysiert den Zusammenhang zwischen Bildung und der Selbsteinschätzung der Bürger bezüglich ihrer eigenen Einflussmöglichkeiten auf politische Entscheidungen.
Wie stehen Politik und Medien in einem Spannungsverhältnis?
Politik versucht Medien zu beeinflussen, während Medien durch Personalisierung und Visualisierung das öffentliche Bild von Politik prägen, was die Zustimmung der Bürger beeinflusst.
- Quote paper
- Helen Liebmann (Author), 2005, Der Einfluss der Mediennutzung und Wertorientierung auf die Vertrauenswürdigkeit von Politik und Demokratie in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87691