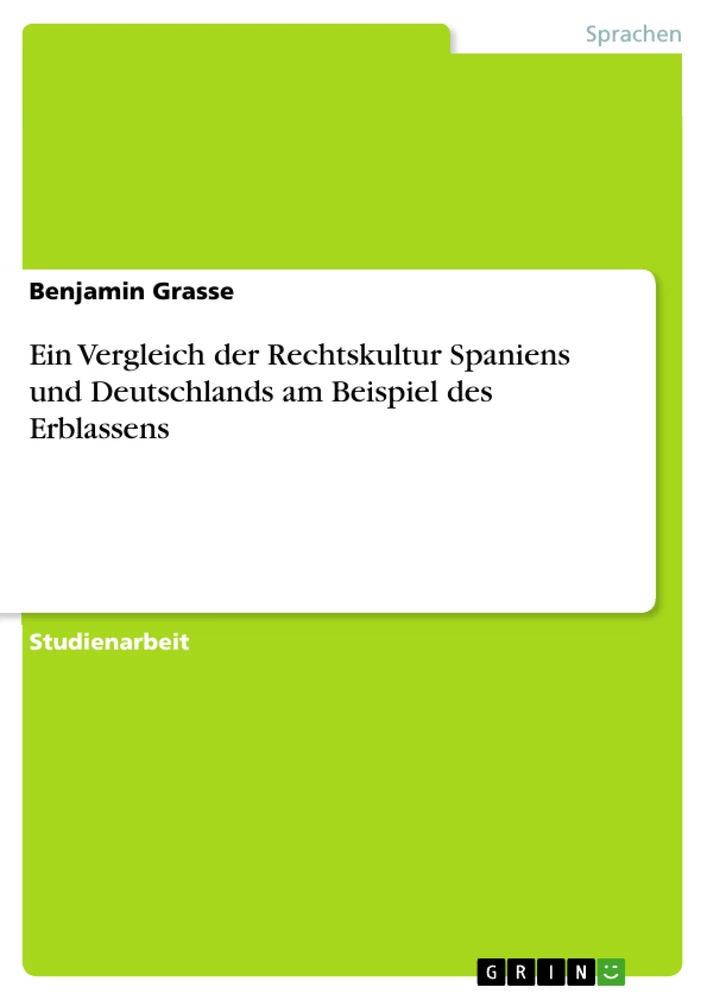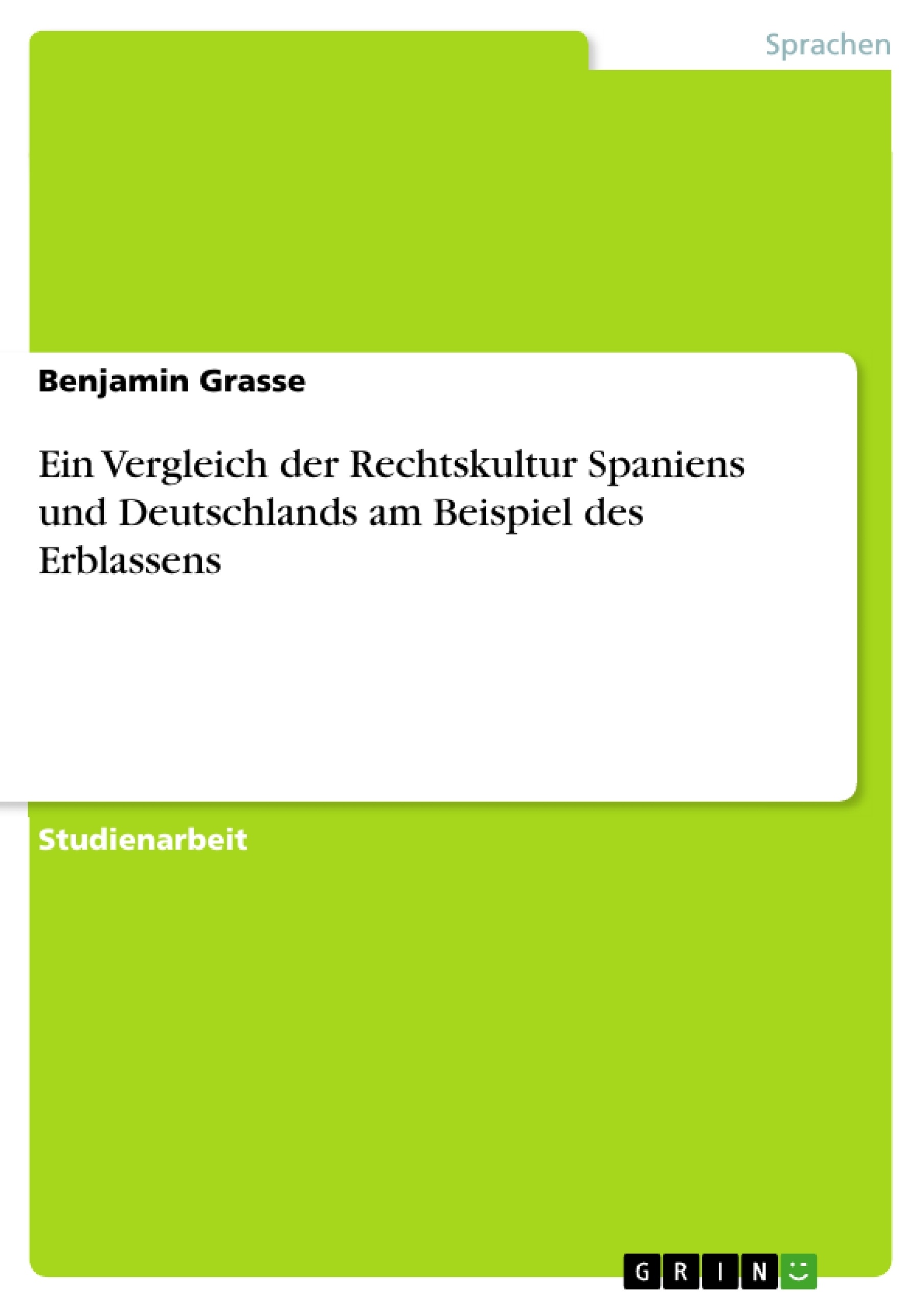Versucht man Unterschiede in der Rechtsprache zweier Kulturkreise zu definieren, muss man sich zuerst klar machen, welche signifikanten Aspekte der jeweiligen Rechtskultur vergleichenswert sind. Allein die Zusammensetzung des Substantivs ´Rechtsprache´ eröffnet uns schon zwei Möglichkeiten einer Untersuchung. Dass das Recht an sich, insbesondere die Zivilgesetzbücher, für Spanien der Código Civíl(CC) und das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) für Deutschland, trotz der räumlichen Enge Europas und der Bestrebung die verschiedenen nationalen Rechtssysteme wenn nicht auf europäischen Niveau zu zentralisieren, wenigstens einander anzunähern, teilweise erhebliche Unterschiede aufweist , dürfte niemanden verwundern. Dies ist zum Teil unterschiedlichen Traditionen oder historischen Entwicklungen zur Staatenbildung geschuldet. Während man Spanien seit der Reconquista als mal mehr mal weniger einheitlichen Staatengebilde betrachten kann, wird auf dem deutschen Territorium der durchaus sehr divergierenden dezentralen Rechtssprechung in den Kleinstaaten erst mit der Reichsgründung von 1871 ein Ende gesetzt.
Die heutige Definition der beiden Staaten, die parlamentarische Demokratie in Deutschland und die parlamentarische Monarchie Spaniens, spielen jedoch nur insofern eine Rolle, als dass ein Urteil in Spanien En nombre del rey und in der Bundesrepublik Deutschland Im Namen des Volkes gefällt wird.
Auch dass die Sprache des Recht, die Rechtssprache oder besser wäre hier vom Sprachstil des Rechts zu sprechen, Unterschiede aufweist ist wohl für jeden nachvollziehbar. Natürlich ist auch die juristische Sprach eine Fachsprache, welche eben nicht der verbalen transregionalen und transsozialen Verständigung einer Sprachgemeinschaft dient sondern den Experten sich von den anderen, den Nicht-Eingeweihten abzusetzen. So machen es die Fachsprachen nicht nur Fremdsprachlern sondern auch Nativspeakern schwer, dem Anliegen fachbezogener Texte folgen zu können. Für die Linguistik stellt Günther Grewendorf treffend heraus, was auch auf alle Fachsprachen übertragen lässt: „ Die verbreitete Aversion gegenüber linguistischer Theorie liegt zum einem an Fehlern der Linguistik selbst, die es einerseits nicht immer verstanden hat, ihre abstrakten [...] Theorien für Anwendungsbereiche zu operationalisieren, die sich andererseits aber auch durch pseudotheoretischen und prinzipiell nicht vermittelbarem Wissenschaftsjargon bei angewandten Bereichen in Misskredit gebracht hat.“
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I.I Der Erbfall im BGB und Código Civil
- II. Dokumente
- II.I Der Erbvertrag
- II.II El pacto sucesorio
- III. Vergleichende Analyse der Texte
- III.I Beteiligte Personen
- III.II Wortklassen
- III.II.I Partizipien
- III.II.II Substantive
- III.II.III Adjektive
- III.II.IV Rechtssprachlichkeit der Adverbien
- III.II.V Tempi der Verben
- II. III Phraseologismen
- IV. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Unterschiede in der Rechtskultur Spaniens und Deutschlands, insbesondere im Hinblick auf den Erbfall. Durch einen Vergleich des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und des Código Civil (CC) werden die spezifischen Regelungen beider Rechtssysteme herausgestellt. Die Arbeit untersucht die Sprachunterschiede in der Rechtssprache der beiden Länder, indem sie verschiedene Wortklassen und Phraseologismen analysiert.
- Vergleich der Rechtskultur Deutschlands und Spaniens
- Analyse des Erbfalls im BGB und Código Civil
- Sprachliche Unterschiede in der Rechtssprache
- Untersuchung der Wortklassen und Phraseologismen
- Verständlichkeit und Formalität der Rechtssprache
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Einführung des Themas und stellt die grundlegenden Unterschiede zwischen der Rechtskultur Spaniens und Deutschlands dar. Die Untersuchung des Erbfalls im BGB und Código Civil erfolgt im zweiten Kapitel. Hierbei werden die Unterschiede in den gesetzlichen Erbfolgeregelungen sowie die Besonderheiten der gewillkürten Erbschaft beleuchtet.
Das dritte Kapitel widmet sich der vergleichenden Analyse der Rechtssprache. Es werden die beteiligten Personen, die Wortklassen und Phraseologismen in den beiden Sprachen analysiert. Dabei werden insbesondere die Unterschiede in der Verwendung von Partizipien, Substantiven, Adjektiven, Adverbien und Verben betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen Rechtskultur, Erbfall, BGB, Código Civil, Rechtssprache, Sprachvergleich, Wortklassen, Phraseologismen, Spanien, Deutschland. Die Untersuchung beschäftigt sich insbesondere mit der Analyse der Unterschiede in der Rechtssprache der beiden Länder, wobei der Fokus auf die Verwendung von Partizipien, Substantiven, Adjektiven, Adverbien und Verben liegt.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptunterschiede im Erbrecht zwischen Spanien und Deutschland?
Die Unterschiede ergeben sich aus den jeweiligen Gesetzbüchern, dem Código Civil (Spanien) und dem BGB (Deutschland), sowie unterschiedlichen historischen Entwicklungen zur Staatenbildung.
Wie unterscheidet sich die Urteilsformel in beiden Ländern?
In Spanien wird ein Urteil "En nombre del rey" (Im Namen des Königs) gefällt, während es in Deutschland "Im Namen des Volkes" heißt.
Welche sprachlichen Aspekte werden in der Arbeit verglichen?
Die Arbeit analysiert Wortklassen wie Partizipien, Substantive, Adjektive und Adverbien sowie spezifische Phraseologismen in der spanischen und deutschen Rechtssprache.
Was ist ein "pacto sucesorio"?
Es ist das spanische Äquivalent zum deutschen Erbvertrag, wobei die Arbeit die feinen rechtlichen und sprachlichen Nuancen dieser Dokumente untersucht.
Warum ist Rechtssprache oft schwer verständlich?
Rechtssprache fungiert als Fachsprache, die Experten dazu dient, sich abzugrenzen, was sowohl für Fremdsprachler als auch für Muttersprachler eine Hürde darstellt.
- Quote paper
- Benjamin Grasse (Author), 2007, Ein Vergleich der Rechtskultur Spaniens und Deutschlands am Beispiel des Erblassens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87873