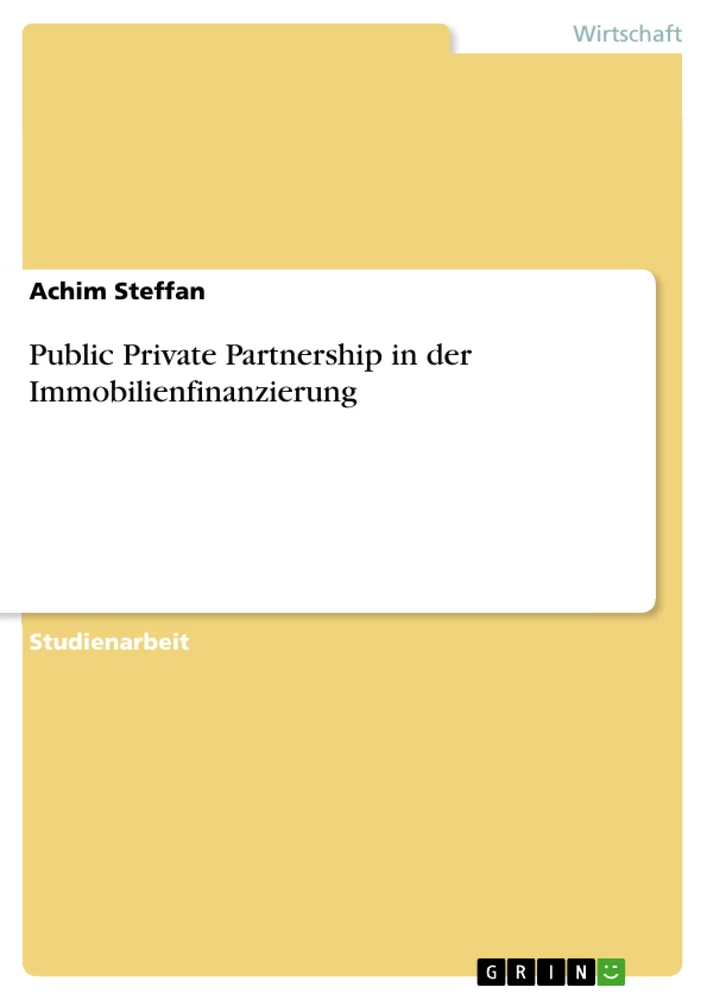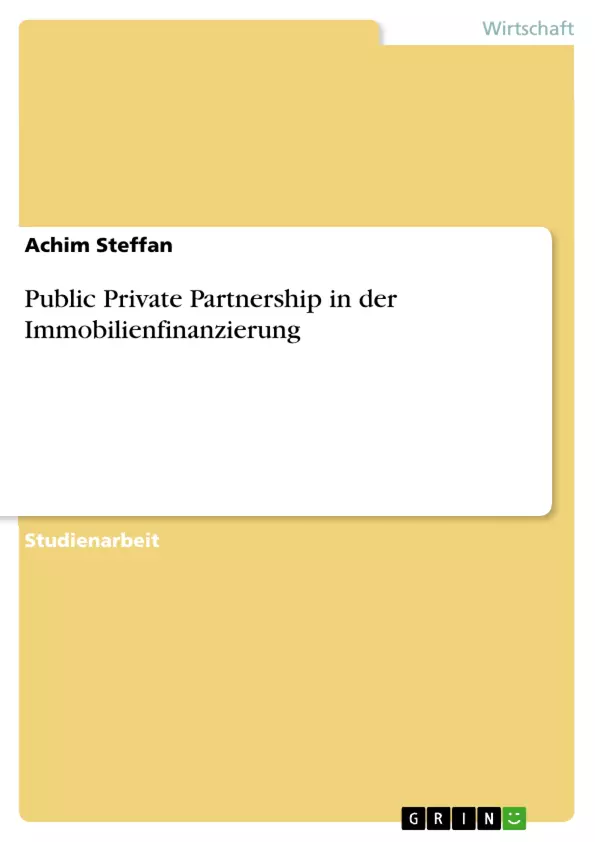Angesichts ihrer angespannten Haushaltslage, gekoppelt mit der schwachen Entwicklung auf der Einnahmeseite, waren die Kommunen in der Vergangenheit dazu gezwungen, notwendige Neu oder Ersatzinvestitionen in öffentlichen Einrichtungen stark zu reduzieren oder aufzuschieben. Mit den herkömmlichen Beschaffungsarten können die öffentlichen Verwaltungen den fortschreitenden Investitionsstau oft nicht mehr bewältigen und suchen daher nach Alternativen.
Eine Lösungsmöglichkeit, um weiter handlungsfähig zu bleiben und dem erheblichen Stau von Investitionen entgegen zu treten, stellt Public Private Partnership (PPP) dar. Viele Kommunen versuchen mit dieser Beschaffungsform private Investoren in die effiziente Erbringung von bisher öffentlichen Aufgaben einzubinden und von deren Fachwissen zu profitieren. PPP findet in Deutschland in den letzten Jahren immer stärkere Verbreitung. Einer aktuellen Studie zur Folge, hat bereits jede sechste befragte Stadt PPP-Projekte durchgeführt, wobei Schulsanierungen und -neubauten im Vordergrund standen. Sowohl die Bundesregierung, einige Länder, als auch die Bauindustrie und Banken gehen davon aus, dass PPP einen nicht unerheblichen Beitrag zur Realisierung und Bereitstellung zusätzlicher Investitionsprojekte leisten kann.
Dem wird in der vorliegenden Arbeit nachgegangen, wobei zu Beginn ein Überblick über Public Private Partnership gegeben wird. Untersuchungsgegenstand sind dabei das Begriffsverständnis und die Anwendungsfelder, die Gründe für den verstärkten Einsatz von PPP sowie die Ziele der öffentlichen Hand und des privaten Partners. Des Weiteren werden die Voraussetzungen für das Zustandekommen von PPPs, die Erfolgsvoraussetzungen zur Realisierung von Effizienzvorteilen sowie die Phasen des PPP-Beschaffungsprozesses thematisiert. Zudem wird den PPP-Vertragsmodellen und den praxisrelevanten Finanzierungsvarianten besonderes Augenmerk geschenkt. Darüber hinaus sind die mit dieser Beschaffungsvariante einhergehenden Chancen und Risiken Gegenstand der Betrachtung. Die Arbeit schließt unter anderem mit einem Ausblick zur zukünftigen Entwicklung von Public Private Partnerships.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen, Motive und Ziele von PPP
- 2.1 Begriffsverständnis und Anwendungsfelder
- 2.2 Gründe für den verstärkten Einsatz
- 2.3 Ziele der öffentlichen Hand und des privaten Partners
- 3 PPP - EINE ALTERNATIVE BESCHAFFUNGSVARIANTE DER ÖFFENTLICHEN HAND
- 3.1 Voraussetzungen für das Zustandekommen von PPPs
- 3.2 Erfolgsvoraussetzungen zur Realisierung von Effizienzvorteilen
- 3.3 Phasen des PPP-Beschaffungsprozesses
- 3.4 PPP-Vertragsmodelle
- 3.5 Praxisrelevante Finanzierungsvarianten
- 4 MÖGLICHKEITEN UND GEFAHREN DES PPP-ANSATZES
- 4.1 Chancen
- 4.2 Risiken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema Public Private Partnership (PPP) im Bereich der Immobilienfinanzierung. Im Fokus stehen dabei die Grundlagen, Motive und Ziele von PPP, sowie die Chancen und Risiken dieser Beschaffungsvariante für die öffentliche Hand. Die Arbeit bietet einen Überblick über das Begriffsverständnis und die Anwendungsfelder von PPP, beleuchtet die Gründe für den verstärkten Einsatz dieser Form der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und privater Wirtschaft und betrachtet die Ziele beider Partner. Darüber hinaus werden die Voraussetzungen für das Zustandekommen von PPPs, die Erfolgsvoraussetzungen für die Realisierung von Effizienzvorteilen und die Phasen des PPP-Beschaffungsprozesses analysiert. Die Arbeit beleuchtet auch die verschiedenen PPP-Vertragsmodelle und praxisrelevanten Finanzierungsvarianten.
- Begriffsverständnis und Anwendungsfelder von PPP
- Gründe für den verstärkten Einsatz von PPP
- Ziele der öffentlichen Hand und des privaten Partners bei PPP
- Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren für PPP
- Chancen und Risiken von PPP
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einleitung zum Thema Public Private Partnership und erläutert die Gründe für den verstärkten Einsatz von PPP durch öffentliche Verwaltungen. Kapitel 2 befasst sich mit dem Begriffsverständnis und den Anwendungsfeldern von PPP, den Motiven für den verstärkten Einsatz sowie den Zielen der öffentlichen Hand und des privaten Partners. Kapitel 3 analysiert die Voraussetzungen für das Zustandekommen von PPPs, die Erfolgsfaktoren für die Realisierung von Effizienzvorteilen sowie die Phasen des PPP-Beschaffungsprozesses. Es werden die PPP-Vertragsmodelle und praxisrelevanten Finanzierungsvarianten behandelt. Kapitel 4 beleuchtet die Chancen und Risiken des PPP-Ansatzes.
Schlüsselwörter
Public Private Partnership, Öffentlich-Private Partnerschaft, ÖPP, Immobilienfinanzierung, Beschaffung, Effizienz, Lebenszyklus, Vertragsmodelle, Finanzierungsvarianten, Chancen, Risiken.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Public Private Partnership (PPP)?
PPP ist eine langfristige Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand und privaten Investoren zur effizienten Erbringung öffentlicher Aufgaben.
Warum nutzen Kommunen verstärkt PPP-Modelle?
Wegen angespannter Haushalte und Investitionsstaus suchen Kommunen nach Wegen, privates Kapital und Fachwissen für Neu- oder Ersatzinvestitionen zu nutzen.
In welchen Bereichen wird PPP häufig eingesetzt?
Besonders häufig findet PPP Anwendung bei Schulsanierungen, Schulneubauten und anderen öffentlichen Infrastrukturprojekten.
Was sind die Chancen von PPP?
Chancen liegen in der Realisierung von Effizienzvorteilen über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie und der schnelleren Umsetzung von Projekten.
Welche Risiken birgt der PPP-Ansatz?
Zu den Risiken gehören die Komplexität der Verträge, langfristige Bindungen und die Gefahr einer fehlerhaften Risikoallokation zwischen den Partnern.
- Citation du texte
- Achim Steffan (Auteur), 2007, Public Private Partnership in der Immobilienfinanzierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88147