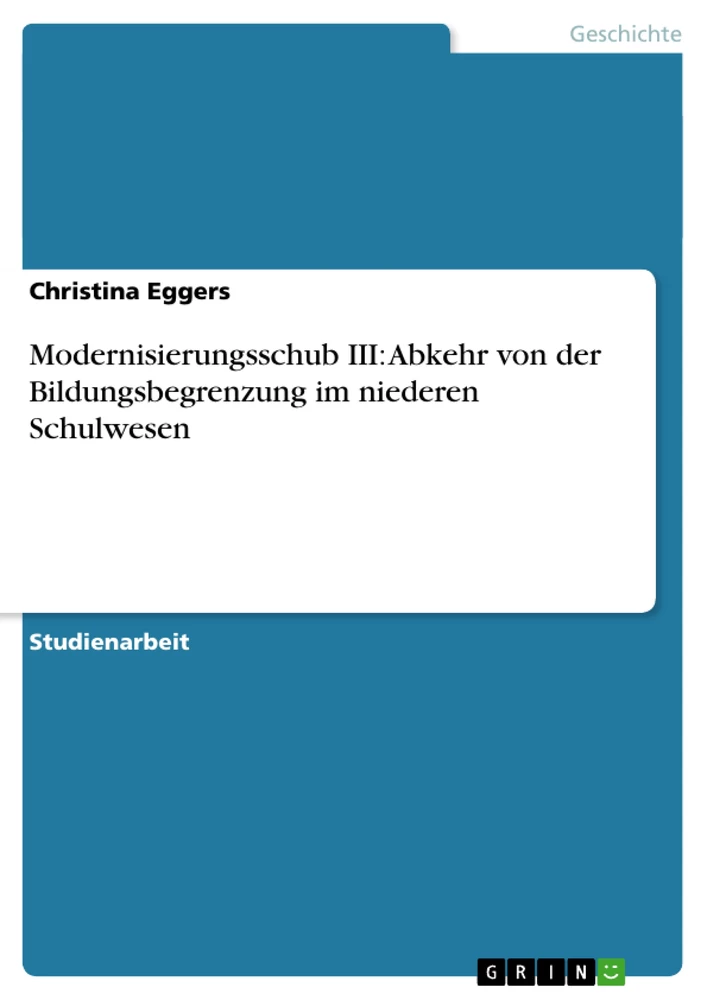Betrachtet man die Zeitspanne, in der sich die Schule als Regelinstanz für den gesamten Nachwuchs herausgebildet hat - das 19. Jahrhundert -, so wird das Implikationsverhältnis von Schule und Gesellschaft deutlich. Es war die Zeit, in der sich eine Agrargesellschaft innerhalb einiger Jahrzehnte in eine verstädterte Industriegesellschaft verwandelte und neue soziale Klassen entstanden.
Im Folgenden werden sich die Ausführungen aber nur auf den Zeitraum von 1872 bis 1911 beziehen und dann auch nur auf den elementaren und mittleren Bildungsbereich. Dieser Zeitrahmen wird üblicherweise als ein Modernisierungsschub bezeichnet, in dem sich das Volksschulwesen der Bildungsbegrenzung abwendete und die Tendenz einer Bildungsverbesserung eingeschlagen wurde. Es soll eine schulpolitische Entwicklung erläutert werden, die aus Integrationsstrategien eines Obrigkeitsstaates hervorgeht. Dabei wäre es irreführend, den Ausbau des modernen Volksschulwesens als einen gleichmäßigen, zwangsläufig fortschreitenden Prozess zu verstehen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- ,,ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN“ VON 1872
- Ausbau des preußischen Volksschulwesens nach den „Allgemeinen Bestimmungen“ von 1872
- Aufbau der Mittelschulen
- Die Bewegung zur Volksschulreform
- DER,,NEUE KURS“
- Die „,Allerhöchste Ordre\" von 1889
- Die allgemeinen Fortbildungsschulen und die wilhelminische Jugendpflege
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
- Quellen
- Sekundär Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Modernisierungsschub III im niederen Schulwesen in Preußen von 1872 bis 1911. Sie analysiert die Abkehr von der Bildungsbegrenzung und die Tendenz zur Bildungsverbesserung während dieser Zeit. Die Arbeit beleuchtet die schulpolitische Entwicklung im Kontext der Integrationsstrategien des Obrigkeitsstaates und untersucht den Ausbau des modernen Volksschulwesens im Spannungsfeld von städtischen und ländlichen Realitäten.
- Die "Allgemeinen Bestimmungen" von 1872 und ihre Auswirkungen auf das preußische Volksschulwesen
- Der Ausbau des Volksschulwesens in Bezug auf Lehrpläne, Unterrichtsfächer und Stundentafeln
- Die Herausforderungen und Grenzen der Bildungsverbesserung im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung
- Die Rolle der staatlichen Bildungspolitik bei der Gestaltung des modernen Volksschulwesens
- Die Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Volksschulen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung der Schule als Regelinstanz im 19. Jahrhundert im Kontext des Wandels von der Agrar- zur Industriegesellschaft dar. Kapitel 2 beleuchtet die "Allgemeinen Bestimmungen" von 1872 und ihre Auswirkungen auf das preußische Volksschulwesen. Es werden die Veränderungen in Lehrplänen, Stundentafeln und der strukturellen Gliederung der Volksschule erläutert. Kapitel 2.1 beschreibt den Ausbau des preußischen Volksschulwesens nach den "Allgemeinen Bestimmungen" von 1872, wobei die Unterschiede zwischen einklassigen, halbtagigen und mehrklassigen Volksschulen beleuchtet werden.
Kapitel 2.2 untersucht den Aufbau der Mittelschulen und die Bedeutung der "Stiehlschen Regulative" von 1854. Kapitel 2.3 befasst sich mit der Bewegung zur Volksschulreform und den damit verbundenen gesellschaftlichen und politischen Veränderungen. Kapitel 3, "Der Neue Kurs", konzentriert sich auf die "Allerhöchste Ordre" von 1889 und ihre Auswirkungen auf das Bildungssystem. Kapitel 3.2 behandelt die allgemeinen Fortbildungsschulen und die wilhelminische Jugendpflege.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Bildungspolitik, Volksschulwesen, Modernisierung, Bildungsbegrenzung, Bildungsverbesserung, Obrigkeitsstaat, Integration, Preußen, "Allgemeine Bestimmungen", "Stiehlschen Regulative", Lehrpläne, Stundentafeln, Volksschuleinrichtungen, städtische und ländliche Volksschulen, Mittelschulen, "Allerhöchste Ordre", Fortbildungsschulen, Jugendpflege.
Häufig gestellte Fragen
Was bewirkten die "Allgemeinen Bestimmungen" von 1872?
Sie leiteten einen Modernisierungsschub im preußischen Volksschulwesen ein, der die Bildungsbegrenzung lockerte und Lehrpläne verbesserte.
Was war der Unterschied zwischen städtischen und ländlichen Volksschulen?
Städtische Schulen waren oft mehrklassig und besser ausgestattet, während auf dem Land einklassige Schulen dominierten, was zu Bildungsunterschieden führte.
Welche Bedeutung hatten die "Stiehlschen Regulative" von 1854?
Sie standen vor 1872 für eine restriktive Bildungspolitik, die das Wissen des einfachen Volkes auf ein Minimum beschränken wollte.
Was veränderte sich unter dem "Neuen Kurs" ab 1889?
Durch die "Allerhöchste Ordre" wurde die Schule verstärkt zur gesellschaftlichen Integration und zur Abwehr sozialistischer Tendenzen instrumentalisiert.
Warum war die Gründung von Mittelschulen wichtig?
Mittelschulen schlossen die Lücke zwischen der einfachen Volksschule und den höheren Schulen und ermöglichten einen sozialen Aufstieg durch Bildung.
- Quote paper
- Christina Eggers (Author), 2008, Modernisierungsschub III: Abkehr von der Bildungsbegrenzung im niederen Schulwesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88200