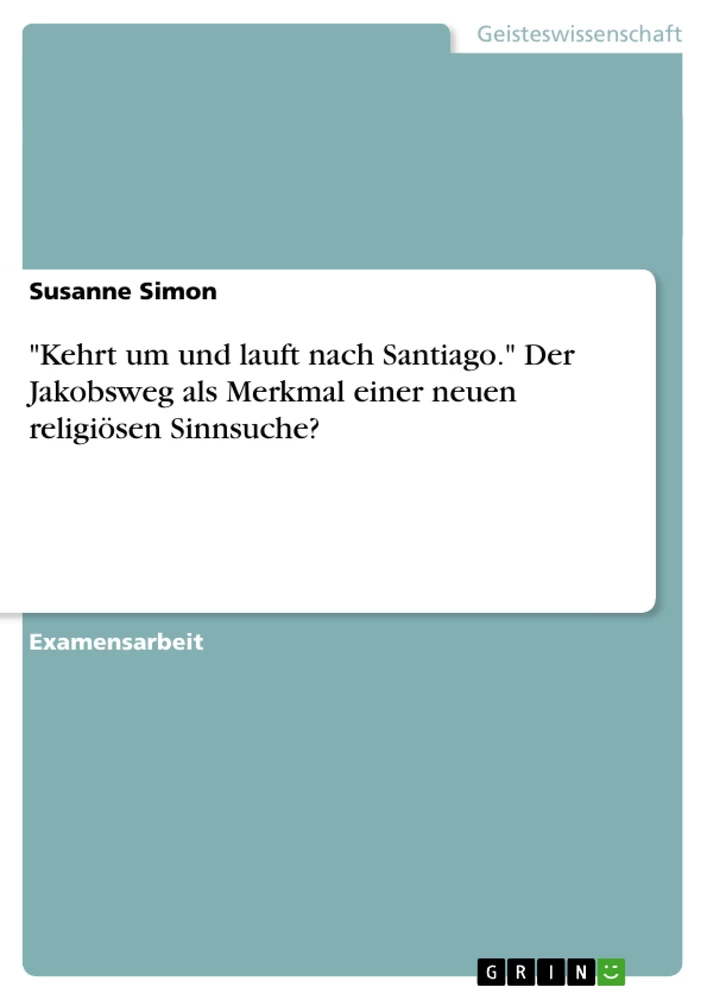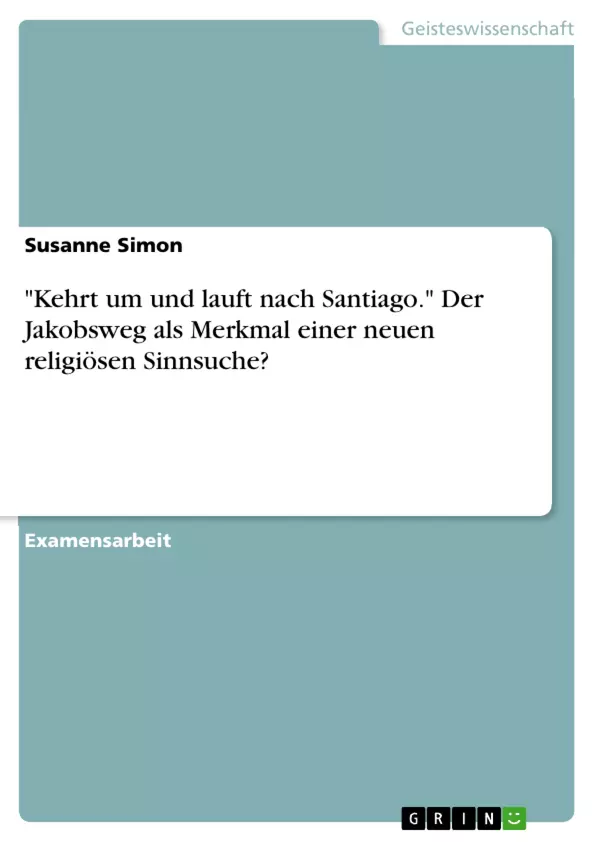Alle Wege führen nach Santiago de Compostela.
So hat es zumindest den Anschein, wenn man sich momentan in Buchhandlungen umschaut oder durch die Fernsehkanäle zappt. Spätestens seit sich Hape Kerkelings Reisetagebuch auf dem ersten Platz der Spiegel-Bestseller-Liste behauptet, ist der
Jakobsweg in aller Munde. Die Deutschen bildeten 2006 mit 8 097 Pilgern die dritthäufigste Nation auf dem Jakobsweg,Tendenz steigend.
Dieser Trend mag zunächst einmal erstaunen handelt es sich doch bei dem mittelalterlichen Pilgerweg um ein ur-christliches Symbol tiefster Frömmigkeit. Seit dem 10. Jahrhundert machten sich Pilger aus ganz Europa auf den Weg ans Ende der damals bekannten Welt, um am Grab des Apostels Jakobus die Vergebung ihrer Sünden zu erlangen. In einem Land, in dem der Begriff der „Frömmigkeit” langsam aber sicher vom Aussterben bedroht ist, mutet es zunächst einmal seltsam an, dass sich neuerdings wieder ganze Heerscharen an Pilgern gen Santiago aufmachen. Die christliche Pilgertradition scheint in einem Gegensatz zu unserer oberflächlich-säkularisierten Gesellschaft zu stehen, in der die Religion, insbesondere in ihrer institutionalisierten Form, immer mehr an Bedeutung verliert. Dieser Umstand macht den gegenwärtigen Pilger-Boom interessant für eine nähere Betrachtung.
Die Frage nach der Bewertung des gegenwärtigen Trends steht in einem engen Zusammenhang mit einer anderen Frage, die seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert wird. Kann man in der modernen, westeuropäischen Gesellschaft von einer Renaissance der Religion sprechen? Oder stellt die fortschreitende Säkularisierung ein unumstößliches Faktum dar? Zweifellos hat in der religiösen Landschaft Deutschlands seit Beginn der Säkularisierung ein komplexer Wandel stattgefunden. Religion verschwand immer mehr aus dem öffentlichen Bewusstsein und wurde zur Privatangelegenheit.
Das Christentum verlor seine Vormachtstellung und wurde zu einem Angebot unter vielen im „Warenlager »letzter« Bedeutungen“ und religiöser Möglichkeiten. Der Begriff der Religion unterlag einem Bedeutungswandel, religiöse Selbstverständlichkeiten lösten sich auf, um einem Pluralismus und Individualismus Platz zu machen, wie wir ihn heute kennen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie das heutige Phänomen des Pilgerns in die religiöse Landschaft einzuordnen ist. Stellt es eine vorübergehende Modeerscheinung dar, oder kann es als Merkmal einer neuen, religiösen Sinnsuche gewertet werden?
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Der Weg und sein Patron: Entstehung und Geschichte des Jakobsweges im Wandel der Jahrhunderte
- 1.1 Die dunklen Anfänge: Entstehung eines Mythos
- 1.1.1 Jakobus, der Donnersohn
- 1.1.2 Missionstätigkeit in Spanien?
- 1.1.3 Problematisierung einer geschichtlichen Darstellung
- 1.1.4 Die politischen und religiösen Hintergründe der Legendenentstehung
- 1.1.5 Der Volkspatron wird zum Mythos
- 1.1.6 Apostelgrab auf europäischem Boden?
- 1.1.7 Wie Jakobus nach Spanien kam: Translationsberichte
- 1.1.8 Jakobus als Maurentöter
- 1.2 Die Entwicklung des Kultes und sein Wandel im Lauf der Jahrhunderte
- 1.2.1 Propaganda für den Apostel
- 1.2.2 Zeugnisse des frühen Pilgertums: Liber Sancti Jacobi und Kathedrale
- 1.2.3 Rahmenbedingungen für den Fortschritt der Pilgerfahrt
- 1.2.4 Der mittelalterliche Reliquienkult
- 1.2.5 Büßer und Trittbrettfahrer: das 15./16. Jahrhundert
- 1.2.6 Luthers Kritik am Pilgertum
- 1.2.7 Niedergang und neuer Aufschwung: Das 16. bis 19. Jahrhundert
- 1.2.8 Der Apostel als nationaler Identitätsstifter während des Francismo
- 1.2.9 Der Jakobsweg als Sinnbild eines einigen Europas
- 1.1 Die dunklen Anfänge: Entstehung eines Mythos
- 2. Traditionelles Pilgern - Unterwegssein zu Gott
- 2.1 Definition und Abgrenzung: Pilgerfahrt – Wallfahrt
- 2.2 Biblische Pilger
- 2.3 Der Weg um des Zieles willen? - Pilgern im Mittelalter
- 2.3.1 Motivationen und Pilgertypen
- 2.3.2 Die Praxis der mittelalterlichen Pilgerfahrt
- 2.3.3 Auf dem Weg und am Ziel
- 2.3.4 „Jakobus hat geholfen” - mittelalterliche Wundergeschichten
- 2.4 Pilgern als globales Phänomen
- 3. Kann man in der heutigen Gesellschaft von einer Renaissance der Religion sprechen?
- 3.1 Einleitende Problematisierung der Fragestellung
- 3.2 Definitionsansätze und Begriffsabgrenzungen
- 3.2.1 Was ist Religion? - Ein Begriff im Wandel der Zeit
- 3.2.2 Religiosität
- 3.2.3 Volksreligiosität
- 3.2.4 Spiritualität und Esoterik
- 3.3 Die Rede von der Renaissance der Religion
- 3.3.1 Wie kann man von Renaissance der Religion sprechen? - Probleme und Grenzen
- 3.3.2 Dimensionen von Religion und ihre Bedeutung für die Diskussion
- 3.3.2.1 „Wir sind Papst“ - Religion im Spektrum der Medienlandschaft
- 3.3.2.2 Imagegewinn der Institutionen?
- 3.3.2.3 Private Religiosität der Bürger
- 3.3.3 Säkularisierung - Mythos oder Fakt?
- 3.3.4 Säkulare, postsäkulare oder immer schon religiöse Gesellschaft?
- 3.3.5 Kirche im Aufschwung? Chancen und Möglichkeiten einer totgeglaubten Institution
- 3.4 Merkmale der "neuen" Religiosität
- 3.4.1 Individualisierte Religion – Die “Ich-AG” des Glaubens
- 3.4.2 Pluralismus und Synkretismus
- 3.4.3 Die Leere von Gott
- 3.4.4 Die Religiosität heutiger Jugendlicher als Beispiel
- 3.5 Die große Suche nach dem Sinn des Lebens
- 3.6 Fazit: Nicht Wiederkehr, sondern Bestätigung
- 4. Der Jakobsweg heute - Modeerscheinung oder religiöse Sinnsuche?
- 4.1 Der Weg ist das Ziel? - Allgemeine Überlegungen zum heutigen Pilgertrend
- 4.1.1 Über die Schwierigkeit, allgemeingültige Aussagen zu treffen
- 4.1.2 Die gegenwärtige Popularität des Jakobsweges in den Medien
- 4.1.3 Pilger und einige ihrer Motivationen heute
- 4.1.4 Beispiele: Pilger erzählen von „ihrem Camino“
- 4.1.4.1 Stefanie Schönborn-Aich
- 4.1.4.2 Felix Bernhard
- 4.2 „Säkulare” Aspekte des Jakobsweges
- 4.2.1 Der Weg als Metapher
- 4.2.2 Entschleunigung - Die Entdeckung der Langsamkeit
- 4.2.3 Das Pilgern als Flow-Erlebnis
- 4.2.4 Das Ende der Erlebnisgesellschaft?
- 4.3 „Religiöse“ Aspekte des Jakobsweges
- 4.3.1 Fragebogen zum Jakobsweg: statistische Eckdaten
- 4.3.2 Selbsterfahrung, Grenzerfahrung, Gotteserfahrung
- 4.3.3 Der Camino als Quelle für Veränderung, Wandel und Umkehr
- 4.3.4 Der Jakobsweg als besonderer Ort von Gemeinschaft und (Nächsten)Liebe
- 4.3.5 Das religiöse Potential des Jakobsweges
- 4.3.6 Ökumene als Thema auf dem Camino
- 4.3.7 Kritische Reflexionen
- 4.4 Fazit Sinnsuche: ja -religiös: vielleicht
- 4.1 Der Weg ist das Ziel? - Allgemeine Überlegungen zum heutigen Pilgertrend
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Jakobsweg als mögliches Merkmal einer neuen religiösen Sinnsuche. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Jakobsweges und des damit verbundenen Kultes, um diese Entwicklung mit dem heutigen Pilgerphänomen in Verbindung zu setzen. Die Arbeit fragt nach der Bedeutung des Jakobsweges im Kontext aktueller gesellschaftlicher und religiöser Veränderungen.
- Historische Entwicklung des Jakobsweges und seines Kultes
- Traditionelles und modernes Pilgern im Vergleich
- Der Wandel religiösen Glaubens und Sinnsuchens in der heutigen Gesellschaft
- Säkulare und religiöse Aspekte des heutigen Jakobsweges
- Der Jakobsweg als Metapher für Sinnsuche
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und umreißt die Forschungsfrage: Ist der Jakobsweg ein Ausdruck einer neuen religiösen Sinnsuche? Sie skizziert den methodischen Ansatz und die Struktur der Arbeit.
1. Der Weg und sein Patron: Entstehung und Geschichte des Jakobsweges im Wandel der Jahrhunderte: Dieses Kapitel erforscht die Entstehung und Entwicklung des Jakobsweges und des Kultes um den Apostel Jakobus. Es beleuchtet die Legendenbildung um Jakobus, die politische und religiöse Bedeutung des Pilgerortes Santiago de Compostela und die Wandlungen des Pilgerwesens über die Jahrhunderte, von den Anfängen bis zum Einfluss des Franquismus und der Idee eines geeinten Europas. Es werden verschiedene Interpretationen der historischen Quellen und unterschiedliche Perspektiven auf die Entwicklung des Kultes präsentiert, um ein umfassendes Bild zu liefern.
2. Traditionelles Pilgern - Unterwegssein zu Gott: Dieses Kapitel definiert und differenziert zwischen Pilgerfahrt und Wallfahrt. Es beleuchtet das Pilgern in biblischer Perspektive, analysiert mittelalterliches Pilgern mit seinen Motivationen und Praktiken, und setzt es in den Kontext globaler Pilgertraditionen. Es wird besonders auf die religiösen Beweggründe und die Rolle von Wundern im mittelalterlichen Pilgertum eingegangen, um einen Kontrast zum modernen Pilgertum zu schaffen.
3. Kann man in der heutigen Gesellschaft von einer Renaissance der Religion sprechen?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage nach einer möglichen Renaissance der Religion in der heutigen Zeit. Es analysiert verschiedene Definitionsansätze von Religion, Religiosität und Spiritualität, und diskutiert den Begriff der Säkularisierung. Im Mittelpunkt steht die Analyse des Wandels religiösen Glaubens und Ausdrucks im 21. Jahrhundert, einschließlich der Individualisierung des Glaubens und des wachsenden Pluralismus. Beispiele aus der gesellschaftlichen und medialen Wahrnehmung von Religion werden eingebunden.
4. Der Jakobsweg heute - Modeerscheinung oder religiöse Sinnsuche?: Dieses Kapitel untersucht den Jakobsweg im Kontext der gegenwärtigen Gesellschaft. Es analysiert die Popularität des Weges, die unterschiedlichen Motivationen heutiger Pilger und unterscheidet zwischen säkularen und religiösen Aspekten des Pilgerns. Ausführliche Beispiele von Pilgerberichten geben einen Einblick in individuelle Erfahrungen. Das Kapitel erörtert die vielschichtigen Beweggründe und die Rolle des Jakobsweges als Ort der Selbsterfahrung, Gemeinschaft und möglicher spiritueller Entwicklung.
Schlüsselwörter
Jakobsweg, Pilgertum, Religiosität, Sinnsuche, Säkularisierung, Mittelalter, Renaissance der Religion, Spiritualität, Volksreligiosität, Individualisierung, Pluralismus, Jakobus, Santiago de Compostela, Medien, Selbsterfahrung, Gemeinschaft.
Häufig gestellte Fragen zum Thema "Der Jakobsweg: Modeerscheinung oder religiöse Sinnsuche?"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht den Jakobsweg als mögliches Zeichen einer neuen religiösen Sinnsuche. Sie verbindet die historische Entwicklung des Jakobsweges und seines Kultes mit dem heutigen Phänomen des Pilgerns. Die Arbeit hinterfragt die Bedeutung des Jakobsweges im Kontext aktueller gesellschaftlicher und religiöser Veränderungen. Sie umfasst eine Einleitung, vier Kapitel mit detaillierten Unterkapiteln und ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, die Zielsetzung und die verwendeten Schlüsselwörter.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die historische Entwicklung des Jakobsweges und des Kultes um den Apostel Jakobus, die Unterschiede zwischen traditionellem und modernem Pilgern, den Wandel des religiösen Glaubens und Sinnsuchens in der heutigen Gesellschaft, säkulare und religiöse Aspekte des heutigen Jakobsweges, und schließlich den Jakobsweg als Metapher für die Sinnsuche.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert. Kapitel 1 behandelt die Entstehung und Entwicklung des Jakobsweges und seines Kultes im Laufe der Jahrhunderte. Kapitel 2 befasst sich mit dem traditionellen Pilgern und dessen religiösen Aspekten. Kapitel 3 diskutiert die Frage nach einer "Renaissance der Religion" in der heutigen Gesellschaft und analysiert den Wandel religiösen Glaubens und Ausdrucks. Kapitel 4 untersucht den Jakobsweg in der Gegenwart, analysiert die Motivationen heutiger Pilger und differenziert zwischen säkularen und religiösen Aspekten des modernen Pilgerns.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet eine kombinierte Forschungsmethode. Sie stützt sich auf historische Quellen, um die Entwicklung des Jakobsweges zu rekonstruieren. Die Analyse moderner Pilger wird durch die Auswertung von Pilgerberichten und möglicherweise durch statistische Daten (Fragebogen) ergänzt. Die Diskussion der "Renaissance der Religion" basiert auf der Analyse relevanter Literatur und der Auseinandersetzung mit soziologischen und religiösen Theorien.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass der Jakobsweg sowohl säkulare als auch religiöse Aspekte vereint. Während die Popularität des Jakobsweges auch durch säkulare Motivationen wie Entschleunigung und Selbsterfahrung getrieben wird, bietet der Weg gleichzeitig ein Potential für religiöse Sinnsuche und spirituelle Entwicklung. Ob es sich um eine "religiöse Renaissance" handelt, wird differenziert diskutiert und hinterfragt. Die Arbeit betont die Vielschichtigkeit der Motivationen und Erfahrungen der heutigen Pilger.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Jakobsweg, Pilgertum, Religiosität, Sinnsuche, Säkularisierung, Mittelalter, Renaissance der Religion, Spiritualität, Volksreligiosität, Individualisierung, Pluralismus, Jakobus, Santiago de Compostela, Medien, Selbsterfahrung, Gemeinschaft.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit Religionssoziologie, Geschichte des Christentums, Tourismus und Pilgerfahrt beschäftigen. Sie ist außerdem interessant für alle, die sich für den Jakobsweg, religiöse Sinnsuche und den Wandel religiösen Glaubens in der heutigen Gesellschaft interessieren.
- Quote paper
- Susanne Simon (Author), 2007, "Kehrt um und lauft nach Santiago." Der Jakobsweg als Merkmal einer neuen religiösen Sinnsuche?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88219