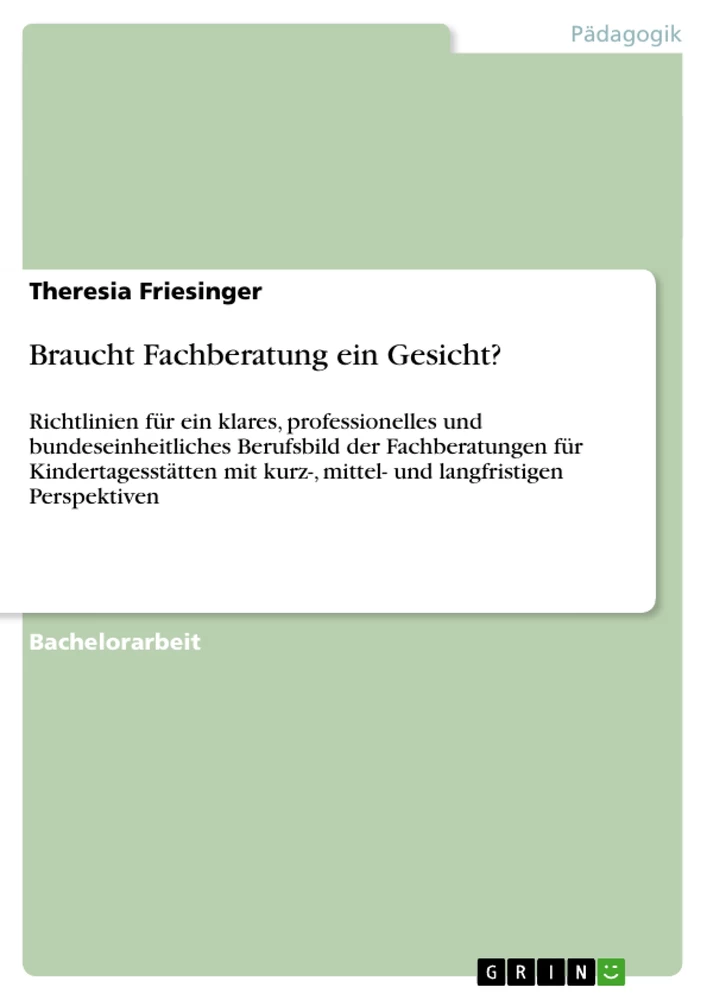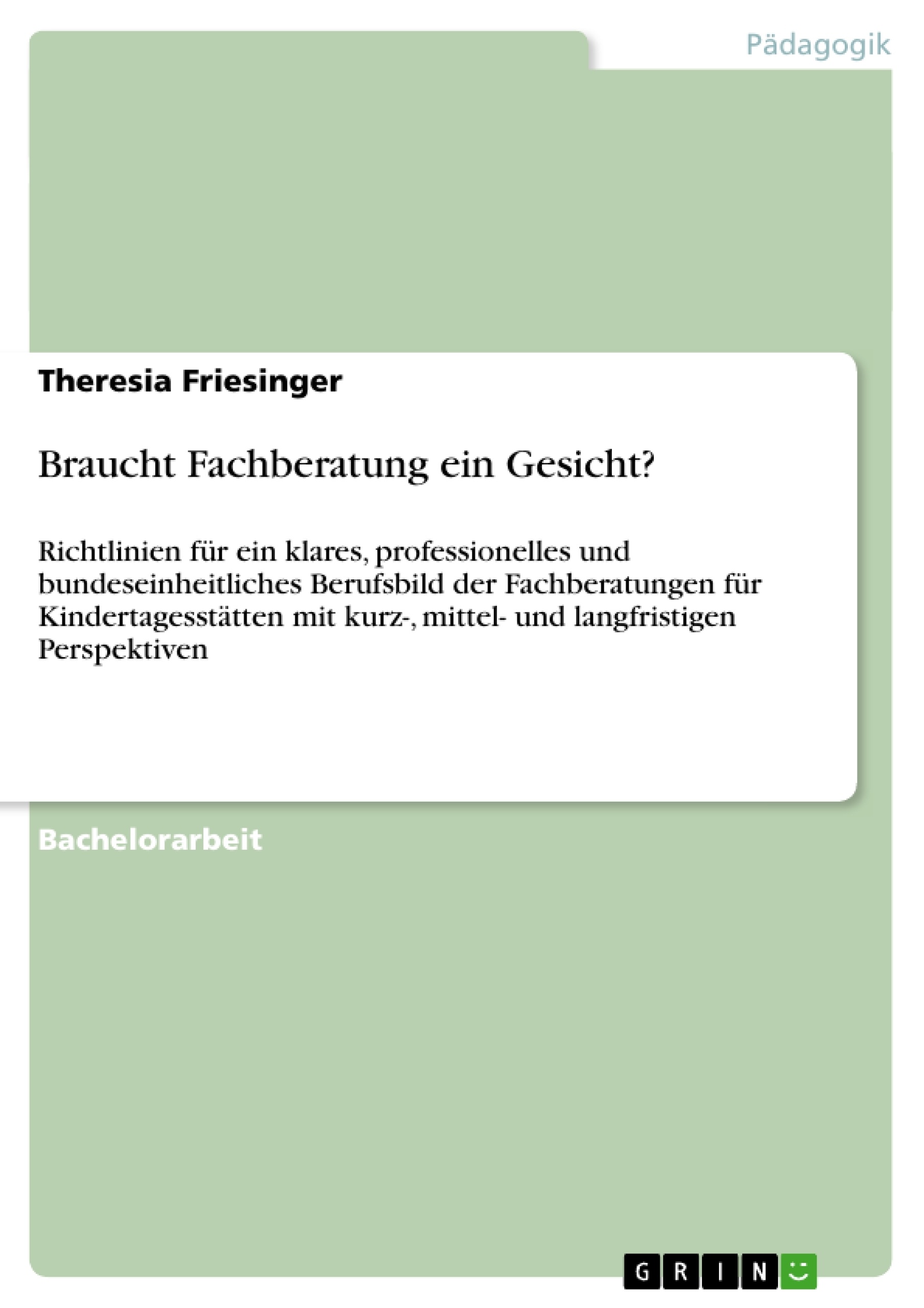In unserer von gesellschaftlichen Umbrüchen gezeichneten Zeit ist eine gute qualifizierte Fachberatung für Kindertagesstätten, besonders in ihrer Scharnierfunktion zwischen Trägersystem und Kindertagesstätten, wichtiger denn je. Kindertagesstätten sind für Kinder in ihrem Alltag wichtige Lebensräume, in denen sie viel und wertvolle Zeit verbringen. Die Beziehungs-, Spiel-, Lebens- und Bildungserfahrungen, die sie dort sammeln, sollten von einer unübertroffenen Qualität sein. „Die Qualität vorhandener Bildungseinrichtungen von der Krippe an ist zu sichern und weiterzuentwickeln, dazu ist ein unterstützendes System von Fachberatung für alle Bildungsstufen zu installieren.“ Immer mehr Hochschulen übernehmen den schwedischen Bildungsslogan: „Die Besten für die Jüngsten! Das sind Anforderungen in einem noch nie gekannten Ausmaß, die das fachliche Herz höher schlagen lassen. Dennoch scheitern allzu oft die hohen fachlichen Ansprüche der Bildungskongresse nicht am Willen der einzelnen Vertreter von politischen Parteien oder Trägern, sondern an der finanziellen Umsetzung. Aber auch auf Grund mangelnder Ressourcen bei der Konzeptualisierung und Konkretisierung des Bildungsauftrages war Deutschland lange Zeit ein „Entwicklungsland“ . Die Basis, d.h. die ErzieherInnen, ist jetzt aufgefordert den Bildungsauftrag in den Einrichtungen zu konkretisieren, das verlorene Bildungsimage zu retten, ohne dass wirkliche Standards für verbesserte Rahmenbedingungen vom Bund, Land oder von den Trägern folgen. Die Stadt Stuttgart hat für die Implementierung des anspruchsvollen innovativen „Infans-Konzeptes“ zwanzig Prozent mehr Stundendeputat vorgesehen. Dafür waren die Laborkindergärten in der Pflicht, aufwändige Hospitationen durchzuführen und Multiplikatoren für andere Kindertagesstätten zu werden. Sind diese ausgedünnten Rahmenbedingungen auf Dauer in der Praxis tragbar? Kommunalisierung, neue Finanzierungssysteme, Personaleinsparungen bei steigender Qualitätsanforderung, die Verschuldung von Städten und Gemeinden zeugen von einem großen Dilemma zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Hemmen rigide und föderalistische Strukturen den fachlichen Motivations- und Entwicklungsdrang? Steckt Fachberatung durch die gestiegenen Anforderungen in der Klemme? Wie muss sie sich zukünftig positionieren? Führt das Stadt-Land-Gefälle in Bezug auf Fachberatung (je ländlicher, desto dünner ist Fachberatung gesät), zu Bildungs- und Chancenungleichheit?
Inhaltsverzeichnis
- Vorspann
- Einleitung
- Geschichte der Fachberatung im pluralen Trägersystem
- Das „Berliner Modell“ im Vergleich mit anderen Fachberatungsmodellen
- Fachberatung in katholischen Kindertagesstätten am Beispiel des Deutschen Caritasverbandes
- Fachberatung in evangelischen Kindertagesstätten am Beispiel des Diakonischen Werkes
- Vorbildliche Zusammenarbeit zweier Bundesverbände
- Fachberatung in der „Klemme“
- Kein objektiv definiertes Berufsbild
- Die eingequetschte Funktion der Fachberatung
- Die unterschiedlichen Strategien des Zwischen-den-Stühlen-Phänomens
- Ziele, Aufgaben und Schlüsselfunktionen von Fachberatung
- Das Dilemma Ziele von Fachberatung ohne ein einheitliches Beratungskonzept zu formulieren
- Definition von Beratung
- Aufgaben der Fachberatung auf sechs verschiedenen Ebenen
- Weitere Kompetenzen von Fachberatung
- Die Methode der qualitativen Sozialforschung
- Vorstellung der Hypothesen
- Kriterien der Fragebögen für die vier Zielgruppen
- Die Auswertungsmethode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Notwendigkeit einer stärkeren Profilierung der Fachberatung für Kindertagesstätten. Ziel ist es, ein umfassendes Stimmungsbild über das Berufsbild der Fachberatung zu erlangen und zu analysieren, ob sich Fachberatungen ein einheitliches Berufsbild und eine stärkere Vernetzung wünschen.
- Diffuse Berufsbild und mangelnde Öffentlichkeitsarbeit
- Der Stellenwert der Fachberatung im politischen Diskurs
- Die Rolle des Föderalismus und die Notwendigkeit von bundeseinheitlichen Standards
- Die Chancenungleichheit zwischen städtischen und ländlichen Regionen
- Die Bedeutung von Qualitätssicherung und -entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einem Überblick über die Geschichte der Fachberatung und beleuchtet dabei das Berliner Modell, sowie die Fachberatung in katholischen und evangelischen Kindertagesstätten. Anschließend werden die Herausforderungen und Schwierigkeiten der Fachberatung, wie das diffuse Berufsbild und die eingequetschte Funktion, näher betrachtet. Die Arbeit erläutert auch die verschiedenen Strategien, die FachberaterInnen entwickeln, um mit dem Zwischen-den-Stühlen-Phänomen umzugehen. Die Kapitel widmen sich außerdem den Zielen und Aufgaben der Fachberatung auf verschiedenen Ebenen sowie der Vorstellung der qualitativen Forschungsmethode.
Im Folgenden werden die Ergebnisse der qualitativen Interviews mit FachberaterInnen, Trägern, ErzieherInnen und PolitikerInnen zusammengefasst. Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass sich eine Mehrheit der befragten Personen ein einheitliches Berufsbild, eine stärkere Vernetzung und eine verbesserte politische Anerkennung der Fachberatung wünschen. Die Arbeit beleuchtet auch die Schwierigkeiten, die mit der Finanzierung von Fachberatung und mit der Umsetzung von Qualitätsstandards verbunden sind.
Schließlich werden kurz-, mittel- und langfristige Perspektiven für die Weiterentwicklung der Fachberatung vorgestellt. Die Arbeit plädiert für die Errichtung von kommunalen und interkommunalen Fachdiensten, die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Fachberatung und die Einrichtung einer intermediären Dienstleistungsstelle „Fachberatung für Fachberatung“.
Schlüsselwörter
Fachberatung, Kindertagesstätten, Berufsbild, Professionalisierung, Vernetzung, Qualitätssicherung, Kommunalisierung, Bildungsgerechtigkeit, Postmoderne, Unterstützungssystem, Sensibilisierung, Politik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Aufgabe der Fachberatung für Kindertagesstätten?
Fachberatung fungiert als Scharnier zwischen Trägersystem und Kita. Sie unterstützt bei der Qualitätsentwicklung, der Umsetzung von Bildungsplänen und berät das pädagogische Personal.
Warum wird das Berufsbild der Fachberatung als „diffus“ beschrieben?
Es fehlt an einem bundesweit einheitlich definierten Berufsbild. Die Aufgaben variieren stark je nach Träger, Bundesland und regionalen Strukturen.
Was ist das „Zwischen-den-Stühlen-Phänomen“?
Fachberater stehen oft im Dilemma zwischen den Interessen des Trägers (Finanzen, Verwaltung) und den fachlichen Ansprüchen der ErzieherInnen (Pädagogik, Qualität).
Gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land bei der Fachberatung?
Ja, es besteht ein Stadt-Land-Gefälle. In ländlichen Regionen ist das Beratungsnetz oft dünner, was zu Ungleichheiten bei der Bildungsqualität führen kann.
Welche Reformen werden für die Fachberatung vorgeschlagen?
Die Arbeit plädiert für kommunale Fachdienste, bessere politische Anerkennung und die Einrichtung einer intermediären Stelle für „Fachberatung für Fachberatung“.
- Citation du texte
- Theresia Friesinger (Auteur), 2008, Braucht Fachberatung ein Gesicht?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88230