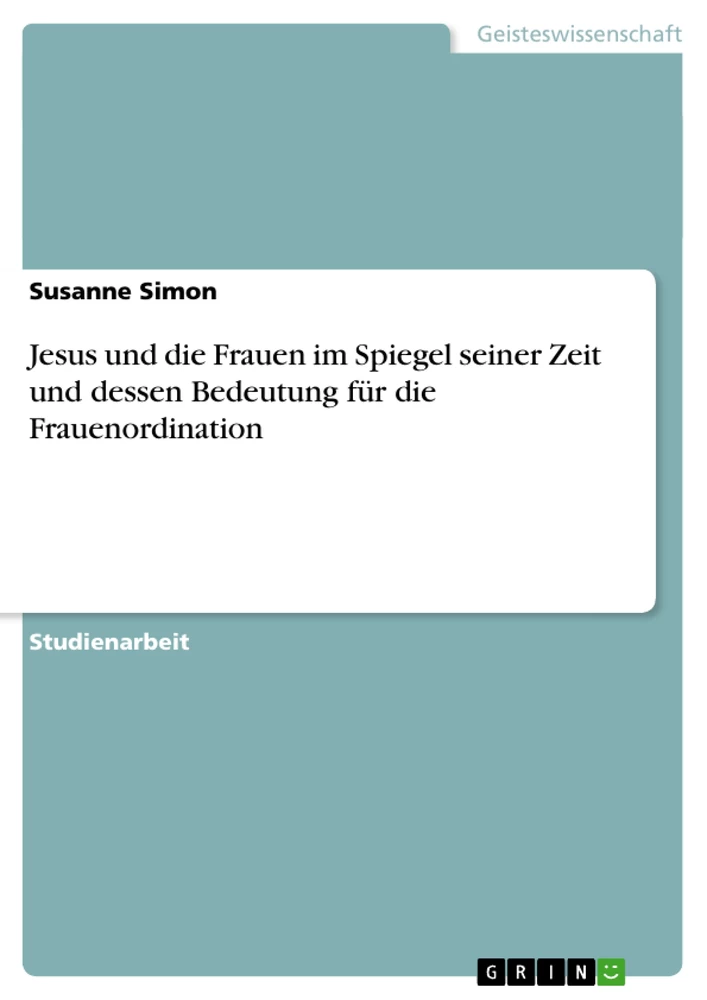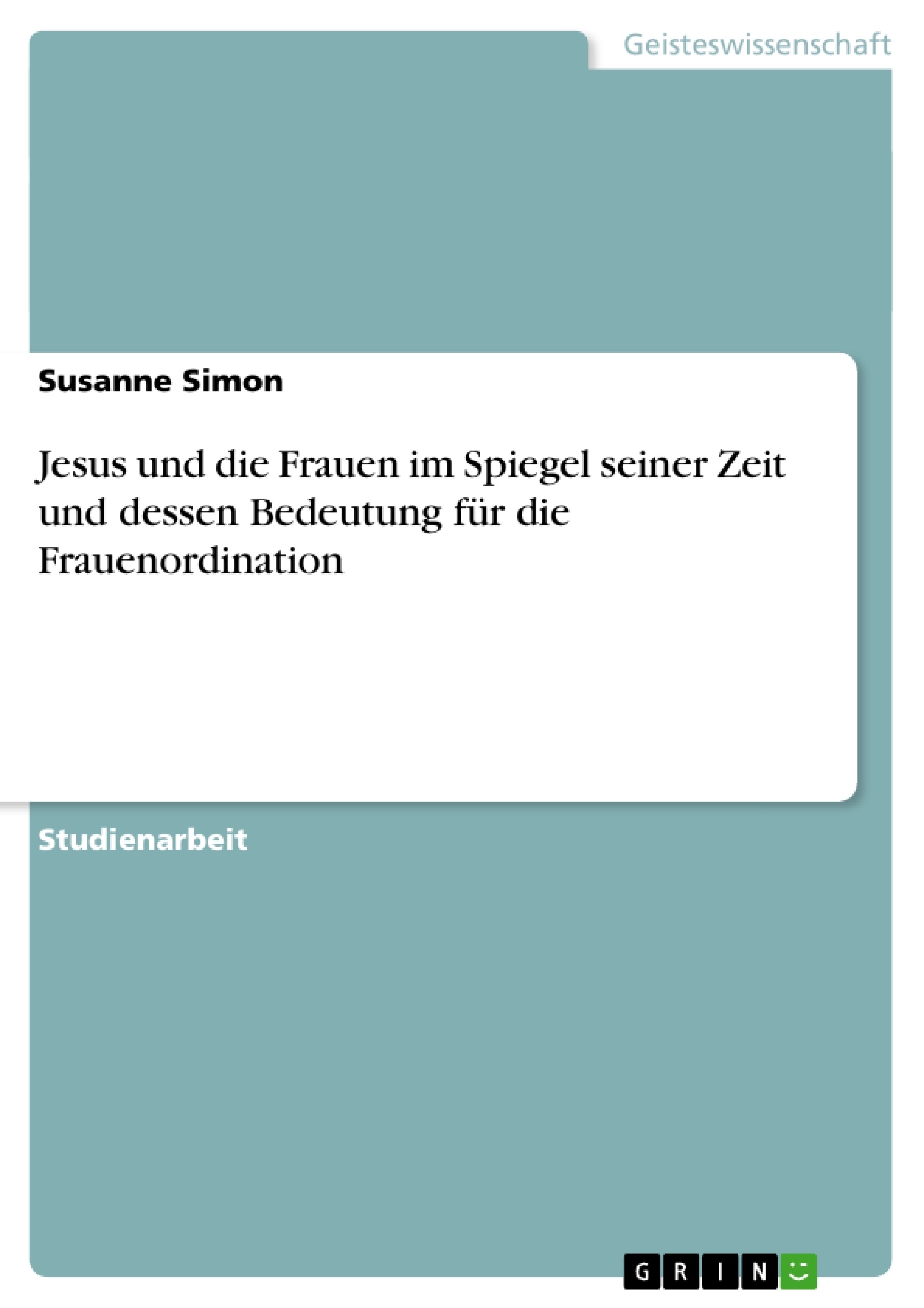Es wird wohl letztendlich immer ein Rätsel bleiben, eines mit mehr oder weniger schwerwiegenden Folgen für die Struktur der Kirche: Das Verhältnis Jesu zu den Frauen.
Nicht ausschließlich, aber vor allem, ist es für die feministische Theologie nach wie vor ein bedeutendes und aktuelles Thema, da es für die Frauen letztendlich um ihr Selbstbild in der Kirche geht und um die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, die ihnen von der katholischen Kirche immer noch verweigert wird. Und auch außerhalb der wissenschaftlichen Literatur ranken sich Legenden um die Rolle der Frauen an der Seite Jesu, ein Indiz dafür, dass die "Frauenfrage" auch unter den Laienchristen, durchaus noch von Interesse ist, gerade angesichts einer Kirche, die diese so weit es geht versucht auszuklammern und zu ignorieren. Weil ihnen von kirchlicher Seite viele Fragen unbeantwortet bleiben, versuchen vor allem Frauen, im Rückbezug auf den historischen Jesus, Antworten in der Bibel zu finden. Dies gestaltet sich insofern schwierig, als von dem historischen Jesus kaum etwas bekannt ist. Das Bild, das in den Evangelien von ihm gezeichnet wird, trägt bereits den ideologischen Pinselstrich des jeweiligen Verfassers und ist dementsprechend verfärbt. Nicht desto trotz möchte ich in der vorliegenden Arbeit das Verhältnis Jesu zu den Frauen, wie es in den drei synoptischen Evangelien dargestellt ist, etwas näher beleuchten. Dazu werde ich es in Bezug setzen, zu den verschiedenen kulturellen Einflüssen, denen die Menschen in Jesu Heimatregion, dem antiken Palästina, wohl ausgesetzt gewesen sind. Ausgehend von der Rolle der Frauen im Judentum, Hellenismus und bei den Römern, möchte ich also Vergleiche ziehen, inwiefern sich die Darstellungen Jesu in den Evangelien aus dem Rahmen ihrer Zeit gelöst haben und inwiefern sie alten Strukturen verhaftet blieben.Zum Schluss meiner Arbeit werde ich auf die aktuelle Diskussion zur Frauenordination eingehen, da für diese das Thema der Frauen in den Evangelien von entscheidender Bedeutung ist. Dabei werde ich zunächst kurz die Argumentation des katholischen Lehramtes gegen eine Frauenordination wiedergeben und diese dann anhand verschiedener Gegenargumentationen in Frage stellen.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Die Frauen zur Zeit Jesu
- 1.1 Problematisierung einer objektiven Analyse
- 1.2 Die Frauen im zeitgenössischen Judentum
- 1.3 Die Frauen in der hellenistischen Welt
- 1.4 Die römischen Frauen
- 2. Jesus und die Frauen in den synoptischen Evangelien
- 2.1 Markus: Frauen als Dienerinnen Jesu oder der Sache Jesu?
- 2.2 Matthäus – Emanzipatorischer oder patriarchaler Judenchrist?
- 2.3 Lukas - Evangelist der Frauen oder berechnender Pragmatiker?
- 3. Jesus Frauenfreund oder Menschenfreund?
- 4. Bedeutung für die Frauenfrage in der katholischen Kirche von heute
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis Jesu zu Frauen im Kontext des antiken Palästinas und dessen Relevanz für die heutige Frauenordination in der katholischen Kirche. Sie analysiert die Darstellung dieses Verhältnisses in den synoptischen Evangelien, berücksichtigt dabei die soziokulturellen Einflüsse des Judentums, des Hellenismus und des römischen Reiches, und hinterfragt die Objektivität der Quellen.
- Die Rolle der Frauen im antiken Palästina
- Die Darstellung des Verhältnisses Jesu zu Frauen in den synoptischen Evangelien
- Die Interpretation von Jesu Haltung gegenüber Frauen
- Der Einfluss kultureller und religiöser Kontexte auf die Darstellung
- Die Relevanz der Evangeliendarstellung für die aktuelle Debatte um die Frauenordination
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung skizziert die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis Jesu zu Frauen und dessen Bedeutung für die feministische Theologie und die Frauenordination in der katholischen Kirche. Sie betont die Schwierigkeiten einer objektiven Analyse aufgrund der ideologischen Färbung der evangeliischen Quellen und kündigt den Vergleich der Evangeliendarstellungen mit den soziokulturellen Kontexten des antiken Palästinas an. Die Arbeit gipfelt in einer Interpretation Jesu als Menschenfreund und einer Auseinandersetzung mit der Debatte um die Frauenordination.
1. Die Frauen zur Zeit Jesu: Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen einer objektiven Analyse der Rolle der Frau zur Zeit Jesu aufgrund der pluralen Gesellschaft Palästinas und der begrenzten, von Männern verfassten Quellen. Es wird auf die androzentrische und patriarchale Natur der historischen Quellen hingewiesen und die Gefahr einer einseitigen Darstellung oder des Ignorierens von Frauen thematisiert. Die Autorin diskutiert kritische Punkte feministisch-theologischer Literatur und die Gefahr des latenten Antijudaismus in manchen Argumentationen.
Schlüsselwörter
Frauenordination, Jesus, synoptische Evangelien, antikes Palästina, Judentum, Hellenismus, Römisches Reich, feministische Theologie, Patriarchat, Quellenkritik, Objektivität.
Häufig gestellte Fragen zu: Jesus und die Frauen - Eine Analyse der synoptischen Evangelien
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Verhältnis Jesu zu Frauen im Kontext des antiken Palästinas und dessen Relevanz für die heutige Frauenordination in der katholischen Kirche. Sie analysiert die Darstellung dieses Verhältnisses in den synoptischen Evangelien und berücksichtigt dabei soziokulturelle Einflüsse des Judentums, des Hellenismus und des römischen Reiches.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich hauptsächlich auf die synoptischen Evangelien (Markus, Matthäus, Lukas). Sie berücksichtigt aber auch die soziokulturellen Kontexte des antiken Palästinas, des Judentums, des Hellenismus und des römischen Reiches, um die Darstellung des Verhältnisses Jesu zu Frauen besser zu verstehen.
Welche Fragestellungen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Frauen im antiken Palästina, die Darstellung des Verhältnisses Jesu zu Frauen in den synoptischen Evangelien, die Interpretation von Jesu Haltung gegenüber Frauen, den Einfluss kultureller und religiöser Kontexte auf die Darstellung und die Relevanz der Evangeliendarstellung für die aktuelle Debatte um die Frauenordination.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Einleitung, Die Frauen zur Zeit Jesu, Jesus und die Frauen in den synoptischen Evangelien, Jesus Frauenfreund oder Menschenfreund?, und Schluss. Jedes Kapitel beleuchtet spezifische Aspekte des Verhältnisses Jesu zu Frauen und deren Kontext.
Wie wird die Objektivität der Quellen bewertet?
Die Arbeit betont die Herausforderungen einer objektiven Analyse aufgrund der ideologischen Färbung der evangeliischen Quellen und der begrenzten, von Männern verfassten Quellen. Sie weist auf die androzentrische und patriarchale Natur der historischen Quellen hin und diskutiert kritische Punkte feministisch-theologischer Literatur sowie die Gefahr des latenten Antijudaismus in manchen Argumentationen.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit interpretiert Jesus als Menschenfreund und setzt sich mit der Debatte um die Frauenordination auseinander. Die genaue Schlussfolgerung bezüglich der Frauenordination wird im letzten Kapitel präsentiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Frauenordination, Jesus, synoptische Evangelien, antikes Palästina, Judentum, Hellenismus, Römisches Reich, feministische Theologie, Patriarchat, Quellenkritik, Objektivität.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Theologen, Historiker, Studenten der Religionswissenschaften und alle, die sich für die Rolle der Frauen im frühen Christentum und die Debatte um die Frauenordination in der katholischen Kirche interessieren.
- Citation du texte
- Susanne Simon (Auteur), 2007, Jesus und die Frauen im Spiegel seiner Zeit und dessen Bedeutung für die Frauenordination, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88241