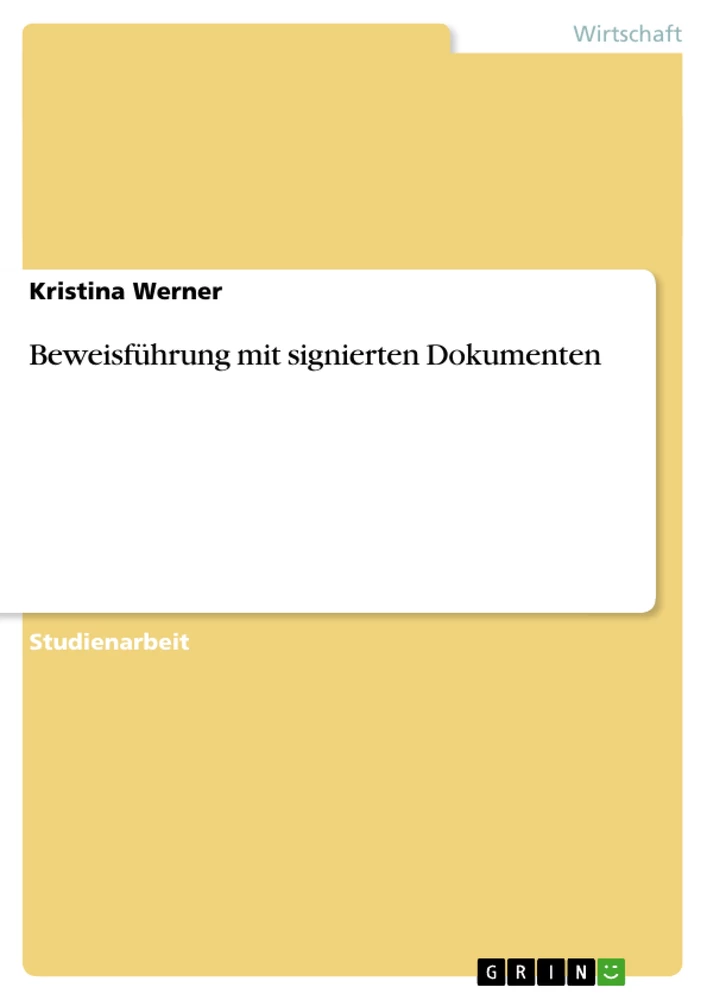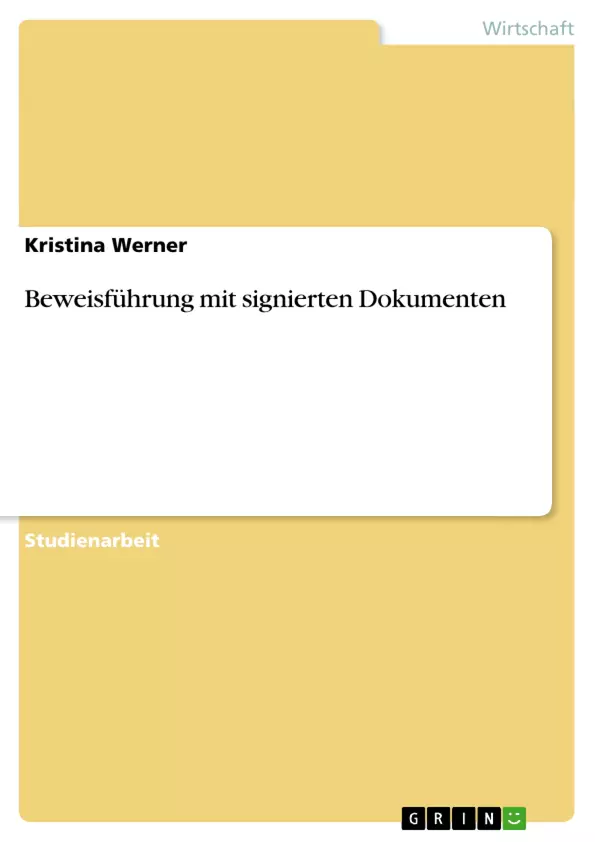Die Grundvoraussetzung einer gerichtlichen Durchsetzung rechtsgeschäftlicher Ansprüche stellt die Beweisbarkeit von Erklärungen dar. In der Regel bedarf es zur Beweiskraft in Papier verkörperte Urkunden. Sie dienen der dauerhaften Archivierung und verdeutlichen ebenfalls, wer die Erklärung ausgestellt hat. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung des elektronischen Geschäftsverkehrs kommen elektronische Dokumente entsprechend häufig zur Anwendung. Hierbei stellen sich allerdings Sicherheitsbedenken seitens der Nutzer ein, denn gerade wegen der Anonymität des Internets bedarf es einem erhöhten Maß an Vertrauen. Nun stellt sich die Frage, ob auch elektronischen Dokumenten, welche die Funktionen von Urkunden nicht vollends erfüllen und folglich keine Urkunden darstellen, dennoch Beweiskraft zukommt und diese entsprechend vertrauenswürdig erscheinen können. Solange echte elektronische Dokumente angenommen werden können, dürften sich keine Probleme ergeben. Wird die Echtheit jedoch angezweifelt, ist diese vom Empfänger des elektronischen Dokuments zu beweisen, wobei aufgrund der beliebigen Veränderbarkeit von elektronischen Dokumenten in Form von Text- und Bilddateien dieser Beweis sehr schwierig erscheint. Folglich können elektronische Dokumente nach herrschender Meinung lediglich mittels freier richterlicher Beweisführung gem. § 286 ZPO im Zivilprozess berücksichtigt werden.
Aufgrund dieser Problematik und der Gleichstellung von elektronischen Dokumenten mit Urkunden erscheint es notwendig, dass der Gesetzgeber entsprechend eingreift. Dies ist letztendlich auch wirksam mit Hilfe der Novellierung des Signaturgesetzes im Jahre 2001 geschehen. Demnach dienen elektronische Signaturen im elektronischen Geschäftsverkehr der Feststellung des Urhebers versendeter Daten, also seiner Authentizität, sowie der Unversehrtheit, d.h. der Integrität, dieser Daten. Gem. § 371a ZPO, welcher im Jahre 2005 neu eingeführt wurde, werden unter Hinzufügung von qualifizierten Signaturen Beweiserleichterungen gewährt, so dass die Vorschriften von Urkunden entsprechend anzuwenden sind.
Ziel dieser Arbeit ist es, mit einer Darstellung der Grundlagen von elektronischen Dokumenten und Signaturen deren Fähigkeit zur Beweisführung kritisch zu betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Elektronische Dokumente
- Einfache Signatur
- Fortgeschrittene Signatur
- Qualifizierte Signatur
- Akkreditierte Signatur
- Beweisführung mit signierten elektronischen Dokumenten
- Allgemeine Beweisführung mit elektronischen Dokumenten
- Beweiserleichterung für qualifiziert signierte Privatdokumente
- Anschein der Echtheit
- Begriffsbestimmung der Erklärung
- Ausstellername als Tatbestandsmerkmal
- Vorliegen einer qualifizierten elektronischen Signatur
- Umfang und Erschütterung des Anscheinsbeweises
- Beweiserleichterung für qualifiziert signierte öffentliche Dokumente
- Definition öffentlicher elektronischer Dokumente
- Vermutung der Echtheit
- Unterschiedliche Behandlung der Echtheitsermittlung
- Probleme der Beweiserleichterung
- Beweiswirkung von qualifiziert signierten elektronischen Erklärungen
- Beweiserleichterung für akkreditiert signierte Dokumente
- Beweisführung mit fortgeschrittenen signierten Dokumenten
- Schlussbetrachtung
- Unterschiede und Merkmale von Urkunden und elektronischen Dokumenten
- Verschiedene Signaturstufen und deren Bedeutung für die Beweisführung
- Beweiserleichterungen für qualifiziert signierte Dokumente
- Relevanz von elektronischen Signaturen im Kontext des elektronischen Geschäftsverkehrs
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Herausforderungen der Beweisführung mit signierten elektronischen Dokumenten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Beweisführung anhand von signierten elektronischen Dokumenten. Sie untersucht kritisch die Fähigkeit von elektronischen Dokumenten und Signaturen, im Rechtsverkehr Beweiskraft zu erlangen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einführung in das Thema und erläutert die Bedeutung der Beweisbarkeit von Erklärungen im Rechtsverkehr, wobei es insbesondere auf die Herausforderungen der Beweisführung mit elektronischen Dokumenten eingeht. Das zweite Kapitel behandelt die Unterschiede zwischen Urkunden und elektronischen Dokumenten und beleuchtet die Notwendigkeit der Einführung von elektronischen Signaturen zur Absicherung der Datenintegrität und -authentizität.
Im dritten Kapitel werden die verschiedenen Signaturstufen, darunter einfache, fortgeschrittene, qualifizierte und akkreditierte Signaturen, vorgestellt. In Kapitel 4 steht die Beweisführung mit signierten elektronischen Dokumenten im Vordergrund. Dabei werden vor allem die Beweiserleichterungen für qualifiziert signierte Dokumente, sowohl im Privat- als auch im öffentlichen Recht, ausführlich behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet Themen wie elektronische Dokumente, digitale Signaturen, Beweisführung, Beweiserleichterung, qualifizierte Signatur, elektronischer Rechtsverkehr, Urkunden, Authentizität, Integrität, Rechtssicherheit und digitale Transformation.
Häufig gestellte Fragen
Haben elektronische Dokumente vor Gericht die gleiche Beweiskraft wie Urkunden?
Elektronische Dokumente unterliegen oft der freien richterlichen Beweiswürdigung gemäß § 286 ZPO. Durch qualifizierte elektronische Signaturen werden jedoch Beweiserleichterungen gewährt, die sie Urkunden gleichstellen.
Welche Signaturstufen werden im Signaturgesetz unterschieden?
Es wird zwischen einfachen, fortgeschrittenen, qualifizierten und akkreditierten Signaturen unterschieden, wobei jede Stufe unterschiedliche Anforderungen an die Sicherheit und Beweiskraft stellt.
Was regelt der § 371a ZPO?
Der § 371a ZPO gewährt Beweiserleichterungen für Dokumente mit qualifizierten elektronischen Signaturen, sodass die Vorschriften über die Beweiskraft von Urkunden entsprechend anzuwenden sind.
Was ist der Zweck einer elektronischen Signatur?
Sie dient der Feststellung des Urhebers (Authentizität) sowie der Sicherstellung, dass die Daten nach der Signierung nicht verändert wurden (Integrität).
Warum ist die Beweisführung bei einfachen elektronischen Dokumenten schwierig?
Aufgrund der beliebigen Veränderbarkeit von Text- und Bilddateien ist der Echtheitsbeweis durch den Empfänger oft sehr schwer zu führen, wenn die Echtheit angezweifelt wird.
Was sind öffentliche elektronische Dokumente?
Dies sind Dokumente, die von einer Behörde oder einer mit öffentlichem Glauben versehenen Person innerhalb ihres Geschäftsbereichs erstellt wurden und bei qualifizierter Signatur eine Vermutung der Echtheit genießen.
- Quote paper
- Diplom-Ökonomin / Magistra Legum (LL.M) Kristina Werner (Author), 2006, Beweisführung mit signierten Dokumenten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88243